
Der Gelegenheitskritiker: Humor vom Feinsten
Der Gelegenheitskritiker: Der Protagonist dieser äußerst lesenswerten und sarkastischen Dialogsammlung, Herr K. ist Gelegenheitskritiker. Gelegenheitskritiker ist er aber nicht, weil er sonst anderen Beschäftigungen nachginge, sondern, „weil er nach Gelegenheiten suchen musste, Bücher besprechen zu können und dafür dringend benötigtes Geld (vornehmer: Honorar) zu erhalten. Er lebte von diesen Gelegenheiten.“ Da es sich davon allerdings mangels Auftragslage nicht besonders gut leben lässt, zieht er von Stuttgart nach Leipzig, denn Leipzig ist. Immer noch. Eigentlich suchte er aber auch einen „guten Platz für seinen Schreibtisch“ und seine Bücher und Bücherregale, denn auch in der neuen Wohnung, die viel geräumiger ist als die alte, stellt sich natürlich die Frage: kaufen oder selber bauen. Natürlich ist Herr K. eine Anspielung an einen ganz großen der Weltliteratur. Sie dürfen selbst raten, wer damit gemeint ist.
Stichhaltige Dialoge voller Häme
Bücherregale sind „die transzendentale Dimension und Fortentwicklung der Arbeit am Schreibtisch“ philosophiert er vor sich hin und beantwortet das Dilemma alsbald mit dem lapidaren Satz: „Bücherregale baut man sich selber.“ Schnell wird auch seine neue Wohnung zu einem Bücherlager: „Er lebte gerne zusammen mit den Büchern, das war die simple Antwort.“ Und warum ausgerechnet mit Lesen und Büchern sein Leben verbringen? Weil sich bei Herrn K. beim Lesen unmittelbar ein „leichtes Gefühl der Benommenheit“ einstellt: „Die Welt drehte sich in einem anderen Takt als er.“ Das tut immer wieder gut. Allein, das Problem ist die Auftragslage, denn Herr K. muss sich seine Auftraggeber immer wieder selbst suchen. Und so entspinnen sich immer wieder witzige Dialoge mit Vertretern des Rundfunks, die seine Rezensionen im Radio unter die Leute bringen. „Zyniker aller Länder vereinigt euch.“, heißt an einer Stelle des Buches, in Abwandlung des berühmten Marx-Zitates über die Proletarier. Von „mäandernder Prosa“ oder „Gesäusel“ kann hier gar keine Rede sein. Klaus Siblewski Humor sticht an vielen Stellen und ist präzise wie ein chirurgischer Eingriff. Sachen zum Lachen auf hohem Niveau.
Der Gelegenheitskritiker: Spott auf hohem Niveau
Spitzfindige Dialoge zu und über die Sinnhaftigkeit von Werken verschiedenster Autoren wie etwa Martin Walser, Martin Mosebach, Thomas Hettche, Fritz J. Raddatz gehören zur Grundausstattung der hier vorliegenden Lektüre, die nicht nur für Literaturkritiker und solche die es werden wollen amüsant zu lesen sind. Die Einsicht in Abläufe jenseits realistischer Zwänge sei eines der vornehmsten Felder der Literatur, so der Protagonist an einer Stelle. Er schreibe schließlich nicht über den Kleidungsstil von Autoren, sondern über deren Werk. Auch wenn man Rundfunkangestellte glauben, dass es dabei einen Zusammenhang gebe. Der pädagogische Auftrag des Rundfunks wird von Herrn K.s Gesprächspartnern immer wieder betont und natürlich ist sich Herr K. dieses Auftrags bewusst: Glänzende Kritiken über lahme Bücher und nicht lahme Kritiken über glänzende Bücher. Denn auch Literaturkritik ist schließlich ein Geschäft, das florieren muss.
Hardcover, gebunden, 240 Seiten
Format:125 x 205
ISBN: 9783701734252
Erscheinungsdatum: 19.09.2017
Residenz Verlag






 Ljubljana: 5 Routen durch die Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana, die „Geliebte“, bietet dieser Falter Reiseführer aus der Reihe City Walks. Neben den gut durchdachten Spaziergängen durch die Geschichte Ljubljanas wird aber auch eine Menge an praktischen Tipps geboten: Kultur, Sightseeing, Shoppingtipps und Öffnungszeiten von Museen sowie Nightlife.
Ljubljana: 5 Routen durch die Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana, die „Geliebte“, bietet dieser Falter Reiseführer aus der Reihe City Walks. Neben den gut durchdachten Spaziergängen durch die Geschichte Ljubljanas wird aber auch eine Menge an praktischen Tipps geboten: Kultur, Sightseeing, Shoppingtipps und Öffnungszeiten von Museen sowie Nightlife.



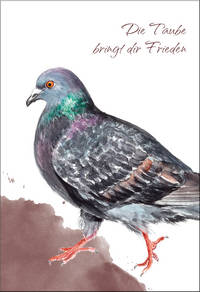 mit 60 Seiten, 49 Karten im Format 95 x 140 mm und vielen Informationen zu den Krafttieren, darunter Eule, Fuchs, Adler und 46 weitere, insgesamt also 49. Das ausführliche Booklet mit 60 Seiten erklärt, wie man mit die Karten benutzt und beschreibt jedes Tier mit seinen besonderen Eigenschaften. Man kann es dem Zufall überlassen, oder selbst wählen, das jeweils eigene Krafttier wird in jedem Fall helfen, das Neue Jahr gut beginnen zu lassen.
mit 60 Seiten, 49 Karten im Format 95 x 140 mm und vielen Informationen zu den Krafttieren, darunter Eule, Fuchs, Adler und 46 weitere, insgesamt also 49. Das ausführliche Booklet mit 60 Seiten erklärt, wie man mit die Karten benutzt und beschreibt jedes Tier mit seinen besonderen Eigenschaften. Man kann es dem Zufall überlassen, oder selbst wählen, das jeweils eigene Krafttier wird in jedem Fall helfen, das Neue Jahr gut beginnen zu lassen. Inspiration“, denn Kartenlegen dient ja hauptsächlich dazu, sich neuen Gedanken auszusetzen und sie für sich selbst zu adaptieren. Das kann oft zu Lösungen führen – oder noch mehr Problemen. Aber die Helfertiere haben ja die Aufgabe, Sie über diese Stromschnellen hinwegzuführen. Nach dem Mischen und Ziehen der Karten, sollte man sich den Text im Booklet dazu gut durchlesen und sich zu neuen Gedankengängen verführen lassen. „die Fragen müssen immer an die Realität angebunden sein“, schreiben die Herausgeber, „egal ob sie in die Vergangenheit oder Zukunft führt“.
Inspiration“, denn Kartenlegen dient ja hauptsächlich dazu, sich neuen Gedanken auszusetzen und sie für sich selbst zu adaptieren. Das kann oft zu Lösungen führen – oder noch mehr Problemen. Aber die Helfertiere haben ja die Aufgabe, Sie über diese Stromschnellen hinwegzuführen. Nach dem Mischen und Ziehen der Karten, sollte man sich den Text im Booklet dazu gut durchlesen und sich zu neuen Gedankengängen verführen lassen. „die Fragen müssen immer an die Realität angebunden sein“, schreiben die Herausgeber, „egal ob sie in die Vergangenheit oder Zukunft führt“.

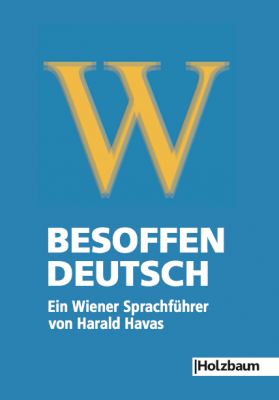


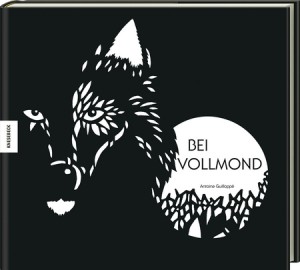
 des Waldes lauschen aufmerksam, ein Wolf öffnet seine Augen, Reineke Fuchs wird nervös und eine Wildschweinmutter grunzt durchs Unterholz. Ein nicht einzuordnendes Geräusch hat die Tiere des Waldes aufgeweckt. Der Vollmond steht in seiner ganzen weißen Pracht am Himmel und alle Tiere sind plötzlich still und lauschen gespannt in den Wald hinein. Was hat sie aufgeweckt? War es die Helligkeit des Vollmondes oder droht von irgendwoher Gefahr? Antoine Guilloppé zeigt alle Tiere des Waldes in Großaufnahme und man sieht sie vor sich, den Wolf, den Fuchs, einen Uhu, einen Hirsch, sogar eine Fledermaus huscht vorbei und ein Wildschwein grunzt einem flüchtendem Kaninchen nach.
des Waldes lauschen aufmerksam, ein Wolf öffnet seine Augen, Reineke Fuchs wird nervös und eine Wildschweinmutter grunzt durchs Unterholz. Ein nicht einzuordnendes Geräusch hat die Tiere des Waldes aufgeweckt. Der Vollmond steht in seiner ganzen weißen Pracht am Himmel und alle Tiere sind plötzlich still und lauschen gespannt in den Wald hinein. Was hat sie aufgeweckt? War es die Helligkeit des Vollmondes oder droht von irgendwoher Gefahr? Antoine Guilloppé zeigt alle Tiere des Waldes in Großaufnahme und man sieht sie vor sich, den Wolf, den Fuchs, einen Uhu, einen Hirsch, sogar eine Fledermaus huscht vorbei und ein Wildschwein grunzt einem flüchtendem Kaninchen nach. Doch dann tauch plötzlich der Bär auf. Was bringt er mit sich? Gefahr? Warum ist er so stumm, hat auch er Angst? Angst vielleicht ja, aber nicht um sich. Denn selbst die grobschlächtigsten Bestien haben ein Herz. Aber Bären sind keine Bestien. Was also hat er? Fühlt er? Eine Entdeckungsreise in den tiefen, tiefen Wald bei Vollmond, was kann es Schöneres zu entdecken geben? Antoine Guilloppé schafft es mit wenigen Worten aber großartigen Bildern die Sinne anzusprechen und sowohl Erwachsene als auch Kinder für eine weitere Entdeckungsreise zu begeistern.
Doch dann tauch plötzlich der Bär auf. Was bringt er mit sich? Gefahr? Warum ist er so stumm, hat auch er Angst? Angst vielleicht ja, aber nicht um sich. Denn selbst die grobschlächtigsten Bestien haben ein Herz. Aber Bären sind keine Bestien. Was also hat er? Fühlt er? Eine Entdeckungsreise in den tiefen, tiefen Wald bei Vollmond, was kann es Schöneres zu entdecken geben? Antoine Guilloppé schafft es mit wenigen Worten aber großartigen Bildern die Sinne anzusprechen und sowohl Erwachsene als auch Kinder für eine weitere Entdeckungsreise zu begeistern.
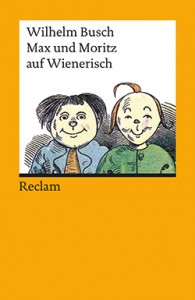

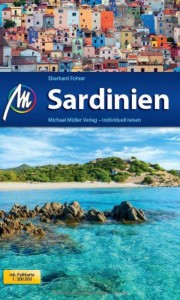 Reiseführer Sardinien in 15. Auflage: Der vorliegende Reiseführer gliedert Sardinien nach den vier Himmelsrichtungen und dem fünften Kapitel „Innersardinien“ in fünf lesens- und besuchenswerte Destinationen. Auf beinahe 700 Seiten wird Sardinien nicht nur als Ferien-, sondern vor allem auch Kulturregion vorgestellt, das jedem etwas zu bieten hat. Sardinien ist immerhin die zweitgrößte Insel des Mittelmeers und Italiens und die fünftgrößte Europas. Auf 24.090 km2 finden sich Gebirge wie die Punta la Marmora (1834m), der Bruncu Spina (1829m) und das Bergmassiv Supramonte bei Nuoro (1463m) ebenso wie Strand- und Wüstenlandschaften oder Wälder resp. die Macchia. Das italienische Festland ist ca. 190 km entfernt, Tunesien aber sogar nur 180 km. Und was Sardinien besonders attraktiv macht: es gehört zu den Ländern/Inseln mit der geringsten Bevölkerungsdichte: nur 1,66 Millionen Menschen leben auf Sardinien, die meisten davon arbeiten im benachbarten In- oder Ausland.
Reiseführer Sardinien in 15. Auflage: Der vorliegende Reiseführer gliedert Sardinien nach den vier Himmelsrichtungen und dem fünften Kapitel „Innersardinien“ in fünf lesens- und besuchenswerte Destinationen. Auf beinahe 700 Seiten wird Sardinien nicht nur als Ferien-, sondern vor allem auch Kulturregion vorgestellt, das jedem etwas zu bieten hat. Sardinien ist immerhin die zweitgrößte Insel des Mittelmeers und Italiens und die fünftgrößte Europas. Auf 24.090 km2 finden sich Gebirge wie die Punta la Marmora (1834m), der Bruncu Spina (1829m) und das Bergmassiv Supramonte bei Nuoro (1463m) ebenso wie Strand- und Wüstenlandschaften oder Wälder resp. die Macchia. Das italienische Festland ist ca. 190 km entfernt, Tunesien aber sogar nur 180 km. Und was Sardinien besonders attraktiv macht: es gehört zu den Ländern/Inseln mit der geringsten Bevölkerungsdichte: nur 1,66 Millionen Menschen leben auf Sardinien, die meisten davon arbeiten im benachbarten In- oder Ausland.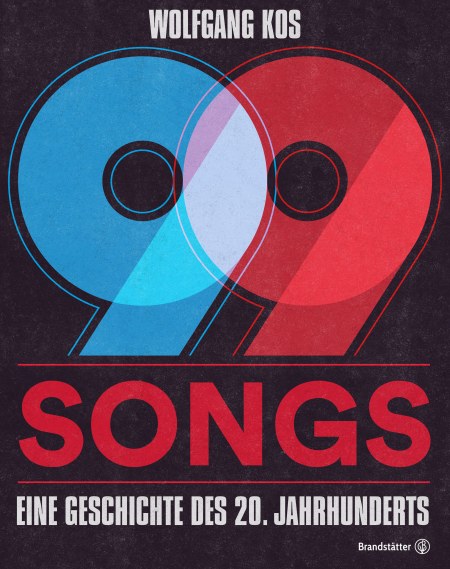
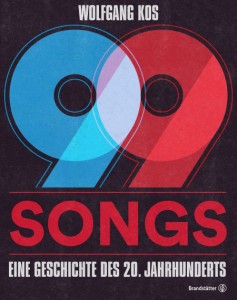 Der Autor will in seinem Buch am Beispiel seiner frei und völlig subjetkiv ausgewählten 99 Songs „gesellschaftliche Hintergründe, kollektive Sehnsüchte oder Konsumentwicklungen und Zeitbrüche erkunden“. Konsenslieder ebenso wie abseits der kommerziellen Warenproduktion entstandene Songs, die zwar keine Hits, aber dafür politische Identifikation bieten und bei Demonstrationen als Protestsongs einsetzbar waren ebenso wie Gassenhauer. Kos’ „99 Songs“ kommen aus unterschiedlichen Musikepochen und kulturellen Milieus und reichen stilistisch von der Oper, dem Musical zu Blues und Country, Schlager und 20er Jahre hin zum Great American Songbook der 30er und 40er, aber auch Chansons und Folk, Rock’n’Roll, Beat, Soul, Rock, Hip-Hop und Rap, partiell wird auch auf Tango, Bossa Nova, Reggae oder Pop aus Afrika zurückgegriffen, um sich dem Vorwurf des Eurozentrismus zu erwehren bevor er noch artikuliert wird. Und natürlich geht es auch um Sex. Und Liebe.
Der Autor will in seinem Buch am Beispiel seiner frei und völlig subjetkiv ausgewählten 99 Songs „gesellschaftliche Hintergründe, kollektive Sehnsüchte oder Konsumentwicklungen und Zeitbrüche erkunden“. Konsenslieder ebenso wie abseits der kommerziellen Warenproduktion entstandene Songs, die zwar keine Hits, aber dafür politische Identifikation bieten und bei Demonstrationen als Protestsongs einsetzbar waren ebenso wie Gassenhauer. Kos’ „99 Songs“ kommen aus unterschiedlichen Musikepochen und kulturellen Milieus und reichen stilistisch von der Oper, dem Musical zu Blues und Country, Schlager und 20er Jahre hin zum Great American Songbook der 30er und 40er, aber auch Chansons und Folk, Rock’n’Roll, Beat, Soul, Rock, Hip-Hop und Rap, partiell wird auch auf Tango, Bossa Nova, Reggae oder Pop aus Afrika zurückgegriffen, um sich dem Vorwurf des Eurozentrismus zu erwehren bevor er noch artikuliert wird. Und natürlich geht es auch um Sex. Und Liebe.
 Die Herausgabe der Erich Mühsam Tagebücher ist ein sehr aufwendiges Projekt des Verbrecherei Verlages, das sich derzeit bei Band 12, 1922-1924, befindet und noch bis zum Frühjahr 2019 mit Band 15 1924 fortgesetzt wird. Der gesamte Rahmen umfasst also die Jahre 1910-1924, runde 15 Jahre des anarchistischen Schriftstellers und Dichters Erich Mühsam. Seine Tagebücher erscheinen zugleich auch als Online-Edition und werden unter der gleichnamigen URL im Netz auch von einem Anmerkungsapparat mit kommentiertem Namensregister, Sacherklärungen, ergänzenden Materialien und Suchfunktionen ergänzt. So entsteht eine historisch-kritische Ausgabe, ein großes Vorhaben und „der erste wirklich überzeugende Versuch, Buch und Internet plausibel und produktiv zu kombinieren“, wie rbb Kulturradio über das ambitionierte Projekt schreibt. Auch die Ausstattung ist übrigens wunderschön: in schwarzes Leinen gebunden mit Lesebändchen genügt sich auch ästhetischen Anarchisten des Wortes.
Die Herausgabe der Erich Mühsam Tagebücher ist ein sehr aufwendiges Projekt des Verbrecherei Verlages, das sich derzeit bei Band 12, 1922-1924, befindet und noch bis zum Frühjahr 2019 mit Band 15 1924 fortgesetzt wird. Der gesamte Rahmen umfasst also die Jahre 1910-1924, runde 15 Jahre des anarchistischen Schriftstellers und Dichters Erich Mühsam. Seine Tagebücher erscheinen zugleich auch als Online-Edition und werden unter der gleichnamigen URL im Netz auch von einem Anmerkungsapparat mit kommentiertem Namensregister, Sacherklärungen, ergänzenden Materialien und Suchfunktionen ergänzt. So entsteht eine historisch-kritische Ausgabe, ein großes Vorhaben und „der erste wirklich überzeugende Versuch, Buch und Internet plausibel und produktiv zu kombinieren“, wie rbb Kulturradio über das ambitionierte Projekt schreibt. Auch die Ausstattung ist übrigens wunderschön: in schwarzes Leinen gebunden mit Lesebändchen genügt sich auch ästhetischen Anarchisten des Wortes.
 Aus einer ursprünglich im tropischen Regenwald lebenden „Urkrähe“ hätten sich die Krähenvögel in der Zeit vom späten Oligozän bis zum Miozän herausentwickelt und über die ganze Erde verbreitet. Die Kulturgeschichte des Menschen habe sich quasi unter der Beobachtung der Krähen vollzogen, denn beide haben sich entwicklungsgeschichtlich aus dem dichten Dschungel in offene Landschaften bewegt. Auf der Flucht vor Jägern hat sich diese Entwicklung allerdings einige tausend Jahre später wieder umgedreht, denn die Krähen sind vom Land in das Stadtgebiet geflüchtet, wo sie Schutz vor Freiwild-Erklärung des Menschen finden und so ihre Populationen wieder ansteigen konnten. Es gab nämlich eine Zeit da wurde tatsächlich Jagd auf die armen Vögel gemacht, weil diverse Vorurteile über sie kursierten. Diese zu bekämpfen, dazu trägt auch diese wunderschön illustrierte Krähenschau des Matthes & Seitz Verlages aus Berlin bei.
Aus einer ursprünglich im tropischen Regenwald lebenden „Urkrähe“ hätten sich die Krähenvögel in der Zeit vom späten Oligozän bis zum Miozän herausentwickelt und über die ganze Erde verbreitet. Die Kulturgeschichte des Menschen habe sich quasi unter der Beobachtung der Krähen vollzogen, denn beide haben sich entwicklungsgeschichtlich aus dem dichten Dschungel in offene Landschaften bewegt. Auf der Flucht vor Jägern hat sich diese Entwicklung allerdings einige tausend Jahre später wieder umgedreht, denn die Krähen sind vom Land in das Stadtgebiet geflüchtet, wo sie Schutz vor Freiwild-Erklärung des Menschen finden und so ihre Populationen wieder ansteigen konnten. Es gab nämlich eine Zeit da wurde tatsächlich Jagd auf die armen Vögel gemacht, weil diverse Vorurteile über sie kursierten. Diese zu bekämpfen, dazu trägt auch diese wunderschön illustrierte Krähenschau des Matthes & Seitz Verlages aus Berlin bei.