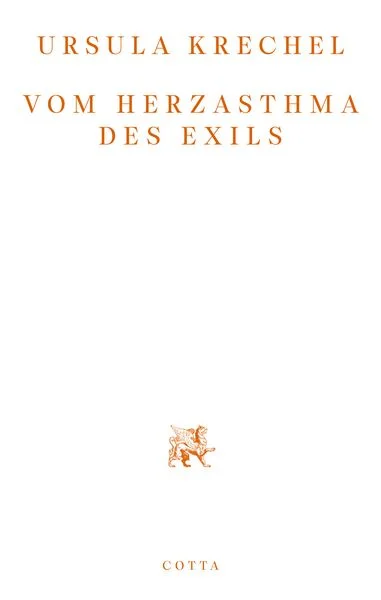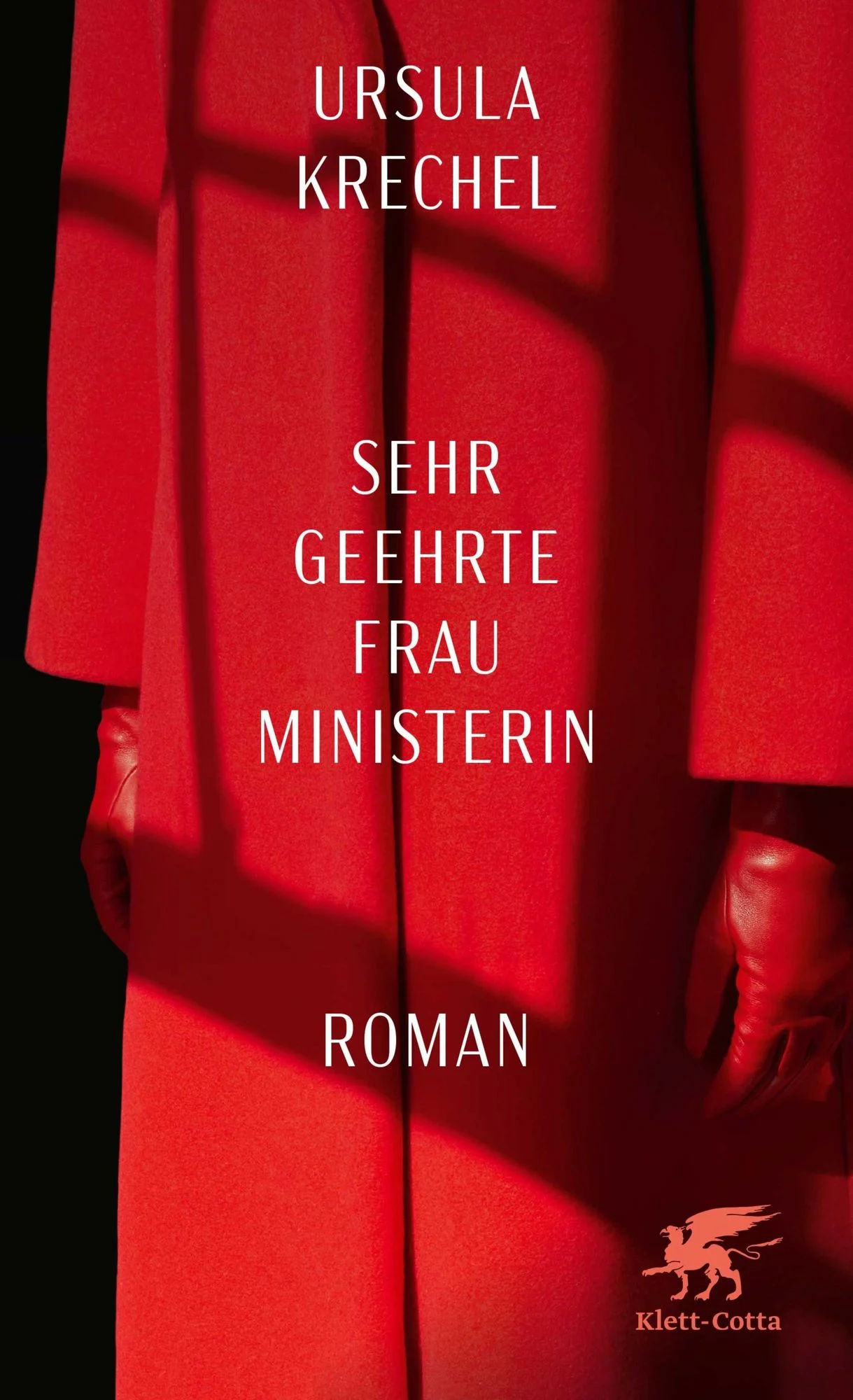Frau Krechels Stärke sind präzise Beschreibungen nach aufmerksamer Beobachtung. Zur Verleihung des Büchner Preises nennt der Tagesspiegel dies die „Innenansicht der Klassenverhältnisse“. Und Klassen sind nicht nur Herkunfts- oder Wohlstandsklassen, auch die von Rassen, Religionen oder politischen Meinungen werden beachtet.
Frau Krechels Stärke sind präzise Beschreibungen nach aufmerksamer Beobachtung. Zur Verleihung des Büchner Preises nennt der Tagesspiegel dies die „Innenansicht der Klassenverhältnisse“. Und Klassen sind nicht nur Herkunfts- oder Wohlstandsklassen, auch die von Rassen, Religionen oder politischen Meinungen werden beachtet.
Archiv
Vom Herzasthma des Exils
Sehr geehrte Frau Ministerin
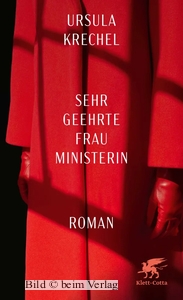 Narrativ unausgewogen
Narrativ unausgewogen
Nach sieben Jahren hat Ursula Krechel mit «Sehr geehrte Frau Ministerin» gerade ihren vierten Roman veröffentlicht, der auch wieder eine dezidiert feministische Thematik aufgreift. Es geht um drei Frauen der Jetztzeit, die mit ihren spezifisch weiblichen Problemen im Roman gespiegelt werden am Schicksal von Agrippina minor, der Mutter des römischen Kaisers Nero. Die in den Feuilletons ziemlich einhellig als eine der sprachmächtigsten deutschen Schriftstellerinnen gefeierte Autorin hat für ihr neues Buch ein hoch kompliziertes narratives Konstrukt gewählt, das in Anbetracht der Komplexität ihrer extrem verschachtelten Geschichte höchste Aufmerksamkeit beim Lesen erfordert.
Der dreiteilige Roman beginnt im ersten, mit «Eva» betitelten Teil mit der Geschichte der Verkäuferin Eva, die in der Essener Filiale einer auf Kräuter spezialisierten Ladenkette arbeitet. Trotz ihrer geradezu symbiotischen Beziehung hat sie als allein erziehende Mutter Probleme mit ihrem Sohn. Philipp hat sein Studium abgebrochen, verbringt antriebslos die meiste Zeit vor seinem Computer, hat nie Zeit für seine Mutter. In permanentem Wechsel zu diesem Erzählstrang springt der Plot in die Antike und erzählt häppchenweise die Geschichte von Nero in der Überlieferung von Tacitus. «Ab ovo», so der Titel des zweiten Teils, ‹von Beginn an› also, wird die Geschichte der Lateinlehrerin Silke erzählt, die als Kundin mit auffällig roter Mütze gelegentlich in Evas Kräuterladen auftaucht. Sie interessiert sich sehr für die «Annalen» von Tacitus und baut sie in ihren Unterricht mit ein, was ihr Schwierigkeiten mit den Eltern einbringt, die den Stoff für unangemessen halten als Schullektüre. Silke kann nach einer Operation keine Kinder mehr bekommen und interessiert sich ziemlich auffallend für Eva und ihren Sohn. Sie spioniere ihnen nach und wolle ein Buch über sie schreiben, mutmaßt Eva. Ein verstecktes Alter Ego der Autorin mithin, die den Schreibprozess und ihre Absichten häufig offen darlegt, den Leser in Wortfindungen und Überlegungen zur Thematik gezielt mit einbindet. Im dritten Teil dieses metafiktionalen Romans, listig mit «als ob» betitelt, steht die Ministerin im Blickpunkt. Schon der Buchtitel weist auf die vielen Briefe hin, die an sie gerichtet sind und Alltagsprobleme aufzeigen, für die es keine politischen Patentrezepte gibt. Auch hier wird die Erzählung, wie schon in den anderen Teilen, häufig durch Zitate von Tacitus unterbrochen. Die Karriere dieser dritten Protagonistin wird ebenso geschildert wie ihr arbeitsreicher Alltag, unter dem ihre Familie häufig zu leiden hat.
Als Kulturgeschichte der Frauen beschäftigt sich dieser Roman mit problematischen Beziehungen zwischen Müttern und Söhnen heutzutage ebenso wie in der Antike. Die realistisch dargestellten Schicksale der drei Protagonistinnen stehen exemplarisch für die Defizite in der heutigen Gesellschaft, denen Frauen trotz aller Fortschritte bei der Emanzipation nach wie vor ausgesetzt sind. Vielleicht als Trost gedacht, werden diese Probleme vor dem antiken Hintergrund aus der Kaiserzeit vor zweitausend Jahren geschildert, wo Mord und Totschlag unter den Regenten und ihren Neidern alltäglich waren, business as usefull! Aber auch eine so hochgestellte Person wie eine veritable Bundesministerin der Justiz ist heutzutage ihres Lebens nicht sicher, lehrt uns der Roman.
Geradezu gewalttätig wirkt aber auch dieser Roman selbst, wenn nämlich mitten im Satz plötzlich aus einer anderen Perspektive weitererzählt wird, und schwer zugänglich wird er neben den verwirrenden Perspektiv-Wechseln zudem durch die vielen wilden Zeitsprünge. Ein weiteres Manko sind die allzu ausufernden Schilderungen der geschlechts-spezifischen Rolle von Frauen, die sich gegen tradierte Ungerechtigkeiten wehren. Stilistisch topp, aber erzählerisch hochgradig konfus und als Lektüre quälend langweilig, ein narrativ unausgewogener Roman wie selten!
Fazit: mäßig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
Sehr geehrte Frau Ministerin
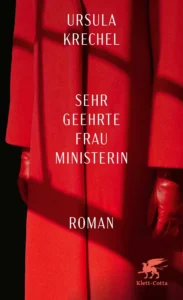 Dass ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, schien anfangs unwahrscheinlich. Erst ging es, in einem Kapitel mit dem Titel: „Eva,“ detailliert um den römischen Kaiser Nero und wie er seine Mutter Agrippina verbannen und umbringen ließ. Dabei erfuhr ich, dass Seneca sein Tutor war, den er aber auch verbannte. Aber, wollte ich das lesen?
Dass ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, schien anfangs unwahrscheinlich. Erst ging es, in einem Kapitel mit dem Titel: „Eva,“ detailliert um den römischen Kaiser Nero und wie er seine Mutter Agrippina verbannen und umbringen ließ. Dabei erfuhr ich, dass Seneca sein Tutor war, den er aber auch verbannte. Aber, wollte ich das lesen?
Geisterbahn
 Die Kirmeswelt als Antithese
Die Kirmeswelt als Antithese
Nach sechs Jahren ist von Ursula Krechel, deren vielseitiges Œuvre neben Lyrik und Dramatik eben auch Epik beinhaltet, wieder ein Roman erschienen, dessen metaphorischer Titel «Geisterbahn» den Inhalt sehr treffend umreißt. Es geht darin, genau wie in ihren letzten beiden Romanen, um Täter und Opfer, um Verfolgung, Vertreibung und Exil. Aber gleichberechtigt stehen bei ihr immer auch deren verheerende Folgen im Fokus, das Wiedererlangen der Würde für die Verfolgten, die Wiedergutmachung für die wenigen Überlebenden. Denn ihr Leben war ein einziger Schrecken, wie in der Geisterbahn eben. Den roten Faden der Handlung bildet dabei das Schicksal der Sinti-Familie Dorn, die durch die Hölle der Nazi-Repressionen geht und nach dem Krieg erleben muss, wie ihnen nicht nur die Neonazis erneut mit Verachtung, zuweilen mit offenem Hass begegnen. Aber auch wie unsensibel, geradezu verächtlich die Behörden der Nachkriegszeit mit ihnen umgehen, wie geringschätzig selbst die Polizei sie immer noch behandelt, all das wird umfassend thematisiert.
Anders als in «Landgericht», dem vor sechs Jahren mit dem Deutschen Buchpreis prämierten Roman, gibt es hier aber mehrere parallele Handlungsstränge, deren Figuren wir in fünf lose miteinander verflochtenen Abschnitten über drei Generationen hinweg durch Naziherrschaft und Zweiten Weltkrieg bis in die Jetztzeit hinein begleiten. Es beginnt in einer Schule in Trier, wo die kleine Anna aus einer Schaustellerfamilie Schwierigkeiten mit der Sprache hat, zuhause wird nun mal Romanes gesprochen. Ihre Familie betreibt ein Karussell und zieht damit über die Jahrmärkte im weiten Umkreis der Stadt. Nach der Machtergreifung sind sie zunehmenden Repressionen der Nazis ausgesetzt, die mit willkürlichen Anschuldigungen beginnen, in Zwangsarbeit, gewaltsamen Umsiedlungsaktionen und Zwangssterilisation eskalieren und für viele Mitglieder der Großfamilie im Vernichtungslager Auschwitz enden. Trier sei «zigeunerfrei», meldet schließlich der Nazi-Gauleiter stolz nach Berlin. Mit großem Fleiß hat Ursula Krechel wieder viele historische Details recherchiert und auch hier öfter mal aus Schriftstücken oder Formularen von Behörden zitiert, den seelenlosen Amtsjargon also authentisch eingebunden in ihre anrührende Geschichte.
Ziemlich irritierend war für mich die ambivalente Erzählsituation, denn obwohl es mit MEINVATER einen übereifrigen Polizisten als Figur gibt, der sich an den Schikanen und Quälereien der Sinti und Roma beteiligt, tritt erst ab der Hälfte des bis dahin auktorial erzählten Romans plötzlich ein Ich-Erzähler in Erscheinung. Dessen Namen wiederum erfährt man dann ebenfalls erst einiges später, ein ebenso neckisches wie überflüssiges Versteckspiel! Jener Bernhard also, weiß man dann, saß mit Anna auf der Schulbank, und die meisten der vielen Romanfiguren sind seine damaligen Klassenkameraden oder stammen aus deren Familien. Ganz nebenbei ist dieser Roman eine Hommage an die Geburtsstadt der Autorin, vor allem aber eine großartige Chronik einer historischen Katastrophe und ihrer Auswirkungen auf die Bürger Triers, in der Fiktion und Realität mit kaum wahrnehmbaren Übergängen kunstvoll verbunden sind. Neben den Dorns als Schausteller wird auch von den Geschwistern Orli und Willi Torgau erzählt, überzeugte Kommunisten, die ebenfalls Verfolgungen ausgesetzt sind, oder von dem Arzt Franz Neumeister, der als Opportunist den politischen Wandel nach dem Krieg unbeschadet übersteht und als Kinderpsychiater Karriere macht.
Die Lyrikerin ist sprachlich unverkennbar herauszuhören aus dieser anklagenden Prosa über eine beschämende Unmenschlichkeit, und auch die katholische Kirche als angeblicher Hort der Moral kommt dabei nicht ohne Blessuren davon. Ursula Krechels Sympathie gehört jedenfalls eindeutig der bunten, lebensfrohen, unschuldigen Kirmeswelt, die traumartige Antithese also zum «lupus est homo homini» bei Plautus, wie dieser großartige Roman sehr eindrucksvoll belegt.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Landgericht
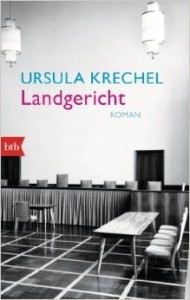 Auch posthum eine tragische Gestalt
Auch posthum eine tragische Gestalt
Oh Gott! Schon das Coverbild erzeugt Unbehagen, man riecht ja förmlich das Bohnerwachs. Soll man so einen Roman lesen, aus dem Gerichtsmilieu auch noch, ist denn die Nachkriegszeit nicht schon hinreichend thematisiert worden von Koeppen, Böll, Schlink und vielen anderen? Nein, ist sie nicht! Aber das weiß man erst, wenn man dieses Buch gelesen hat. Worum geht es? Ein hoffnungsvoller junger Richter wird als Jude Opfer des Naziterrors. Er verliert seine Stellung, muss seine beiden halbjüdischen Kinder nach England in Sicherheit bringen und schließlich selbst ins Exil nach Kuba flüchten. Seine nichtjüdische, als Unternehmerin in der Kinowerbung erfolgreiche Frau bleibt allein in Berlin zurück, wo man ihr mit Drohungen ihre Firma zum Schandpreis abtrotzt. Das Paar ist aus der Bahn geworfen worden, sie versuchen nach dem Ende dieses Albtraums in die bürgerliche Existenz zurückzufinden, die auseinander gerissene, sich fremd gewordene Familie wieder zu vereinen. Daran scheitern sie gründlich, und dieses Scheitern ist eine einzige Tragödie.
Ursula Krechel erzählt in Rückblenden von den glücklichen Berliner Jahren des Ehepaares, vom Exil des Protagonisten in Kuba, wo er unter demütigenden Umständen bei einem schmierigen Rechtsanwalt arbeitet, eine Geliebte findet und mit ihr ein Kind hat, das er aber nie sehen darf. Alles in Kornitzers Leben ist von Brüchen gekennzeichnet, er ist und bleibt ein Aus-der-Bahn-Geworfener, der sich nach Rückkehr und beruflicher Wiedereingliederung allmählich immer mehr in einen aussichtslosen Kampf mit der Bürokratie hineinsteigert, damit sogar seine Gesundheit ruiniert, nur um seine legitimen Ansprüche auf Wiedergutmachung durchzusetzen. Aber auch hierbei scheitert er letztendlich und stimmt schließlich resigniert einem Vergleich zu. Das eigentliche Leben hat er total versäumt, hat wertvolle Jahre sinnlos vertrödelt bei der Suche nach Gerechtigkeit in eigener Sache. Hier liegt für mich das eigentliche Dilemma Kornitzers, dieses überkorrekten Juristen, der an der kalten Logik von Gesetzen und Vorschriften scheitert, die er selbst, als Richter, akkurat und folgerichtig angewendet hat.
Was ist nun das Besondere an diesem Buch? Diese Geschichte geht einem unter die Haut, mir jedenfalls, und zwar wie schon lange keine andere mehr. Man ist tief betroffen, denn es gelingt der Autorin mühelos, einem die Protagonisten sehr nahe zu bringen, fast schon zu nahe. Es ist die Ohnmacht des Menschen vor den geschichtlichen Ereignissen, die Ironie des Schicksals, die bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen, die dieses Leben begleiten, und alles das wird hier in einer unspektakulären, ruhigen, fast juristisch sachlichen Sprache erzählt, der man gleichwohl die Empathie anmerkt, mit der die Figuren geradezu liebevoll beschrieben werden. In dieser schönen Prosa hat für mich des Öfteren die Lyrikerin durchgeschimmert, deren Sprache mir fast ein wenig zaghaft erscheint, indem sie zum Beispiel sehr häufig fußnotenartig in Klammern gesetzte Anmerkungen, Relativierungen, auch Zweifel in den Text einschiebt, sehr häufig mit einem Fragezeichen endend. Genau dieses Fragezeichen aber setzt beim Leser die Bereitschaft voraus, mitzudenken und auch weiterzudenken.
Noch eine Anmerkung zum Schluss des Romans: Kornitzer ist gestorben, da erhält Sohn George ein Schreiben mit dem Briefkopf «Biografisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933», das die Bitte enthält, einige Angaben zu Lebensdaten seines verstorbenen Vaters beizutragen, damit er in die geplante Enzyklopädie aufgenommen werden kann. Der von seinem Vater völlig entfremdete George aber bleibt merkwürdig untätig, zum Entsetzen seiner Frau, die absolut nicht verstehen kann, warum er ihm diese letzte Ehre nicht erweist. Das Handbuch erscheint schließlich, aber Dr. Richard Kornitzer kommt darin nicht vor, und so bleibt er auch posthum eine tragische Gestalt.
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de