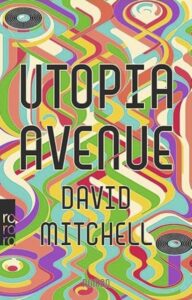 Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.
Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.
Stirnrunzeln? Zu schwierig? Machen wir es einfacher. Leonard Cohen, Janis Joplin.
Es schwant etwas?
Ok, nun ist es eigentlich kein Rätsel mehr: John Lennon, Mick Jagger, Jimi Hendrix, Bob Dylan.
In der Tat handelt es sich durchgehend um Bands oder Musiker, die solo oder in Musikgruppen in den späten Sechzigern, den Siebzigern oder sogar noch lange danach die weltweite Musikszene bestimmten. Kurzzeitig oder als Evergreens, wobei ein einzelner Herr in dieser Reihe mit den verbliebenen anderen rollenden Steinen bis zu einem Durchschnittsalter von circa 80 Jahren regelmäßig auf Welttournee ging. Doch das ist eine andere Geschichte.
Nach seinen diversen literarischen Welterfolgen hat sich David Mitchell in ein ganz anderes, unerwartetes Metier gewagt. Eben in diese Musikszene der „Wild Sixties“, der wilden Sechziger.
Der Plot: Ein talentierter und ehrgeiziger Produzent stellt in England – wo sonst – eine Band zusammen. Natürlich zieht man zu Beginn erfolglos über die Dörfer, aber wird schließlich – wie könnte es anders sein – zu Weltstars. Im Laufe des Karriere-Weges trifft man so ganz nebenbei alle oben angeführten Legenden der damaligen Musikwelt. „Cool“, denkt der Leser und spürt den Promi-Schauer den Rücken runterlaufen. Ach ja, ist ja nur eine Geschichte. Die Band gab es nie, sie ist rein fiktiv. Aber die anderen ja schon. Also wenigstens ein bisschen Gänsehaut darf dann doch sein.
Aber es wäre nicht ein Werk von David Mitchell, wenn es nicht doch die typischen Fantasie-Exzesse abseits des Haupt-Erzählstranges gäbe.
Jeder Protagonist der vierköpfigen Band erhält von Mitchell seinen ganz eigenen Charakter und seine ganz persönliche Story.
Da ist Dean, der Junge aus sozial schwachem Umfeld mit dem gewalttätigen Vater. Dean, der Frauenheld und der Angeklagte in einem Vaterschaftsprozess. Aber auch Dean, der begnadete Bassist, Komponist und Texter. Dean, der neben dem schon allseits selbstverständlichen Koks auch LSD-Versuchen nicht abgeneigt ist.
Jasper, der magische Gitarrist, der aber mit seiner Schizophrenie zu kämpfen hat. Jasper, der versucht, mittels Horologie und psychochirurgischer Seelentransplantation (was immer das ist), aus seinem Teufelskreis herauszukommen. An dieser Stelle erlaubt sich Mitchel ein wenig Story-Recycling. Jasper ist Niederländer und heißt mit Nachnamen De Zoet (gesprochen „de Zuut“). Klingelt was? In der Tat kommt sein Großvater bei der Analyse der Timeline aller Vorfahren kurzzeitig vor. Mitchells Buch aus dem Jahre 2014 „Die tausend Herbste des Jacob de Zoet“ lässt grüßen.
Da ist Elf, nicht nur die Quotenfrau der Band, sondern weibliches Rückgrat der Gruppe, aber auch der Familie, die unter dem plötzlichen Kindstod bei Elfs Schwester leidet. Irgendwann entdeckt sie im Verlauf auch noch ein eigenes unterdrücktes Geheimnis.
Am blassesten kommt Griff, der Schlagzeuger, weg, wie so viele Schlagzeuger der Welt (vielleicht abgesehen von Charlie Watts). Seine Persönlichkeit beschränkt sich auf den Tod des Bruders und ein paar Frauengeschichten. Und Schlagzeugspielen.
Die vier entwickeln sich gemeinsam weiter, werden musikalisch besser, touren durch England und die USA, geben Konzerte, schuften Tag und Nacht in Studios und lassen auch keine Party aus.
Alles in allem also alles genauso, wie man sich ein Bandleben in den späten Sechzigern so vorstellt. Ist das Buch von David Mitchell deshalb eine stereotype Flachpass-Geschichte?
Eigentlich eher nein. Denn es drängt sich der Eindruck auf, dass David Mitchell genau das wollte. In diesem Autor schlummerte ganz offensichtlich über all die Jahre genau dieses Werk, denn seine Begeisterung für den Zeitgeist der Sechziger und Siebziger mit der Hippie-Flower-Power-Anti-Vietnam-Bewegung, sein Detailwissen zu den historischen Ereignissen, weltpolitisch wie in den Straßen von San Francisco, und seine Faszination und seine Kompetenz für die Musik der damaligen Zeit sind unverkennbar. Da hat sich einer seine Leidenschaft von der Seele geschrieben. Man sieht förmlich seine strahlenden Augen und das ist manchmal ein wenig ansteckend.
Literarisch ist „Utopia Avenue“ allerdings nicht Mitchells bestes Werk und zum Beispiel mit „Wolkenatlas“ nicht vergleichbar. Stellenweise hat man fast das Gefühl, er hat bestimmte Passagen einem Ghostwriter oder aufstrebenden Jungautor übergeben. Geradezu plump wirkt sein(?) Stil, wenn er krampfhaft versucht, längere Dialoge aufzulockern. Ein Beispiel:
„Würde das nicht alles ändern?“
Ein Müllwagen rumpelt vorbei.
„Dein Leben wartet, Jasper!“
Der Auflockerungs-Müllwagen taucht immer mal wieder auf. Ebenso der zwitschernde Vogel oder das schreiende Kind auf der Straße vor dem Haus. Zwanghafte Bildeinschübe in einem einzigen Satz, die man in dieser Form nicht mal mehr in den Volkshochschulkursen für kreatives Schreiben in Wanne-Eickel oder Bad Ischl durchgehen lassen würde.
Dennoch ist David Mitchell in Summe ein durchaus unterhaltsames Buch gelungen. Die einleitend abgefragten Grundkenntnisse sind hilfreich, aber keine Conditio sine qua non.
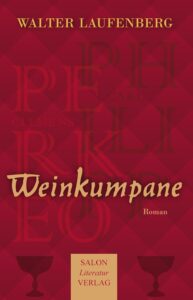

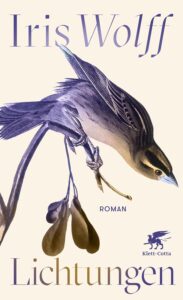 Das Buch beginnt auf frischer Fahrt: mit einer Fähre reisen Lev und Kato. Lev heißt Löwe und ist der Name des jungen Mannes, der mit Kato auf einer großen Reise ist. Der Roman ist aus seiner Sicht geschrieben, wenn auch nicht in Ich-Form. Kato lebt seit Jahren in Westeuropa, verdient gut mit ihrer Straßenmalerei, gemalt hatte sie schon als Kind. Lev hatte mit Waldarbeitern gearbeitet. Nun ist er auch hierhergekommen, weil sie geschrieben hatte: „Wann kommst du?“ Und sie haben sich wiedergefunden, an ihre früheren Gemeinsamkeiten angeknüpft und es genossen.
Das Buch beginnt auf frischer Fahrt: mit einer Fähre reisen Lev und Kato. Lev heißt Löwe und ist der Name des jungen Mannes, der mit Kato auf einer großen Reise ist. Der Roman ist aus seiner Sicht geschrieben, wenn auch nicht in Ich-Form. Kato lebt seit Jahren in Westeuropa, verdient gut mit ihrer Straßenmalerei, gemalt hatte sie schon als Kind. Lev hatte mit Waldarbeitern gearbeitet. Nun ist er auch hierhergekommen, weil sie geschrieben hatte: „Wann kommst du?“ Und sie haben sich wiedergefunden, an ihre früheren Gemeinsamkeiten angeknüpft und es genossen.
 „Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.
„Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.
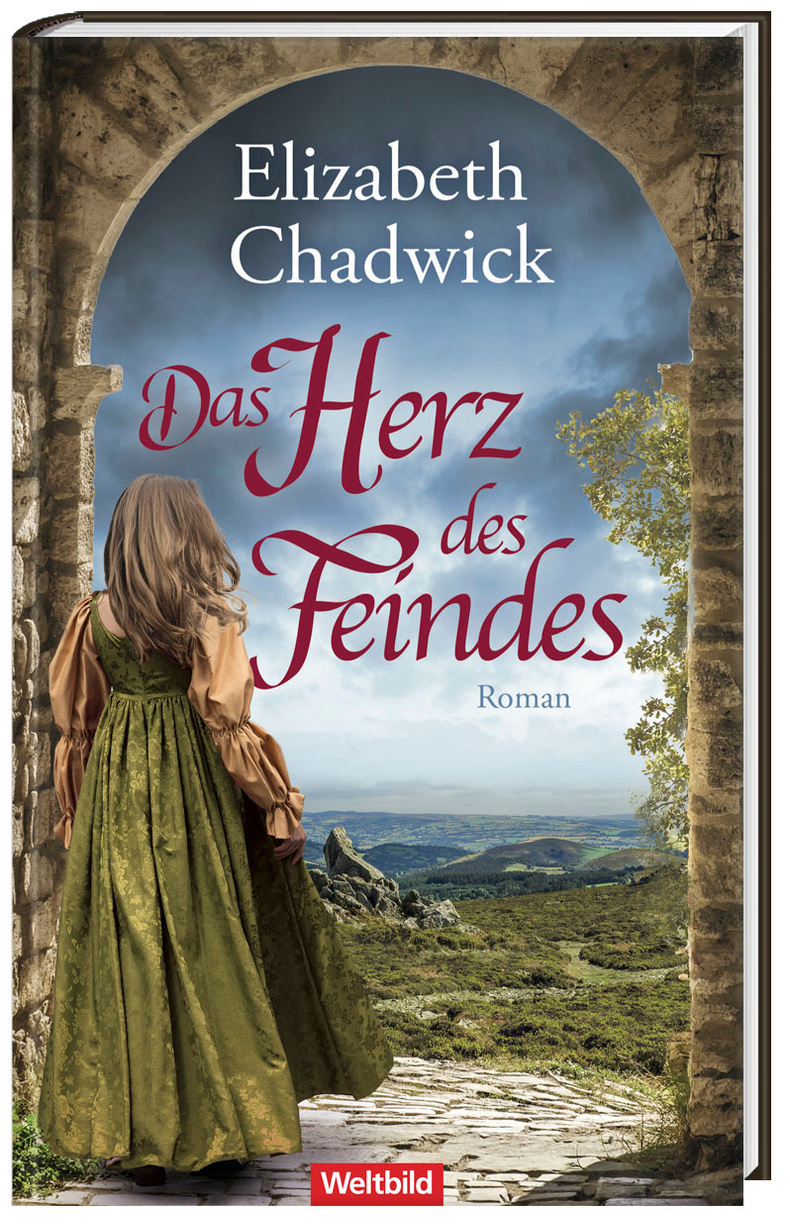 Kampf zwischen Normannen und Engländern, dazwischen eine „unmögliche“ Liebe
Kampf zwischen Normannen und Engländern, dazwischen eine „unmögliche“ Liebe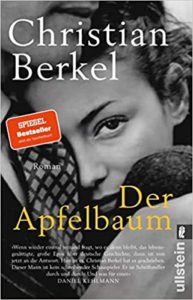 Einundneunzig Jahre alt ist die Mutter des Autors und träumt sich immer wieder in neue Abenteuer hinein, dabei will er doch, bewaffnet mit einem Kassettenrekorder, ihre wechselhafte Geschichte aufzeichnen, gerne auch das, was bisher verschwiegen wurde. Aus diesen Stückchen, die es zusammenzufügen gilt, will er seine eigene Geschichte „neu erfinden“, und nicht mehr davor weglaufen, heißt auf dem Umschlagdeckel.
Einundneunzig Jahre alt ist die Mutter des Autors und träumt sich immer wieder in neue Abenteuer hinein, dabei will er doch, bewaffnet mit einem Kassettenrekorder, ihre wechselhafte Geschichte aufzeichnen, gerne auch das, was bisher verschwiegen wurde. Aus diesen Stückchen, die es zusammenzufügen gilt, will er seine eigene Geschichte „neu erfinden“, und nicht mehr davor weglaufen, heißt auf dem Umschlagdeckel. Es scheint viel Geschichte in diesem Buch zu stecken. 30-jähriger Krieg. Der große Gaukler Tyll. Der zweite Prager Fenstersturz. Westfälischer Friede 1648. Genau genommen war‘s das aber auch schon. Denn ein geschichtlicher Roman ist Tyll nicht.
Es scheint viel Geschichte in diesem Buch zu stecken. 30-jähriger Krieg. Der große Gaukler Tyll. Der zweite Prager Fenstersturz. Westfälischer Friede 1648. Genau genommen war‘s das aber auch schon. Denn ein geschichtlicher Roman ist Tyll nicht.



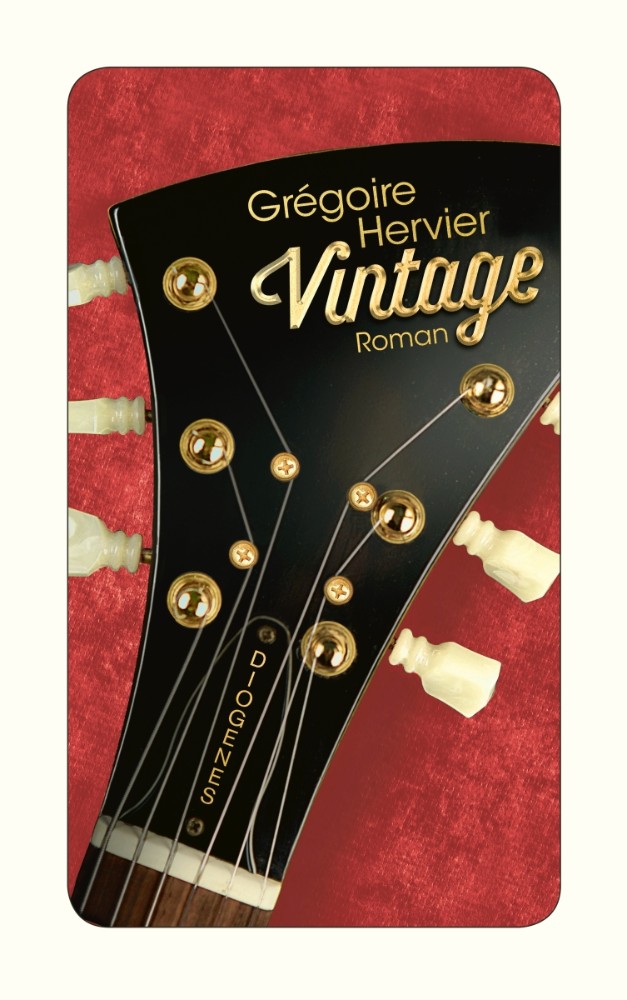
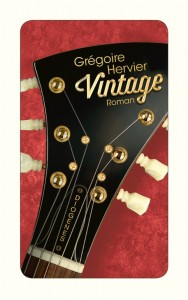 Der 25-jährige Thomas Dupré arbeitet in einem Gitarren-Shop in Paris als Aushilfe. Gitarren sind für ihn keine verstaubten, unantastbaren Reliquien, sondern „Waffen, an denen noch das Blut der Revolution klebt“, denn wie so viele seiner Altersgenossen, träumt auch Thomas davon ein Rockstar zu werden. Ein Vintage-Roman aus Frankreich? Da bekommt er eines Tages plötzlich das Angebot des Jahrhunderts: er soll für seinen Chef Alain de Chévigné eine Gitarre nach Inverness in Schottland liefern, denn der Käufer legt Wert auf Diskretion. Lord Charles Dexter Winsley – so sein voller Name – ist ein Gitarrensammler, der im mysteriösen Boleskine House nahe des Loch Ness, wo schon Aleister Crowley und Jimmy Page gewohnt haben sollen, mehrere Gitarren im Wert zwischen 300.000 und einer Million Dollar an den Wänden hängen hat, darunter etwa auch eine Les Paul Deluxe mit gebrochenem Hals zusammen mit einer Notiz „Für Charlie von Pete.“ Hervier macht damit eine zärtliche Verneigung vor Pete Townshend von The Who, der es bevorzugte, seinen Gitarren auf der Bühne den Hals zu brechen. „Man muss glauben, um zu sehen“, gibt Lord Winsley seinem neuen Schützling mit auf den Weg. Oder ist es etwa doch umgekehrt?
Der 25-jährige Thomas Dupré arbeitet in einem Gitarren-Shop in Paris als Aushilfe. Gitarren sind für ihn keine verstaubten, unantastbaren Reliquien, sondern „Waffen, an denen noch das Blut der Revolution klebt“, denn wie so viele seiner Altersgenossen, träumt auch Thomas davon ein Rockstar zu werden. Ein Vintage-Roman aus Frankreich? Da bekommt er eines Tages plötzlich das Angebot des Jahrhunderts: er soll für seinen Chef Alain de Chévigné eine Gitarre nach Inverness in Schottland liefern, denn der Käufer legt Wert auf Diskretion. Lord Charles Dexter Winsley – so sein voller Name – ist ein Gitarrensammler, der im mysteriösen Boleskine House nahe des Loch Ness, wo schon Aleister Crowley und Jimmy Page gewohnt haben sollen, mehrere Gitarren im Wert zwischen 300.000 und einer Million Dollar an den Wänden hängen hat, darunter etwa auch eine Les Paul Deluxe mit gebrochenem Hals zusammen mit einer Notiz „Für Charlie von Pete.“ Hervier macht damit eine zärtliche Verneigung vor Pete Townshend von The Who, der es bevorzugte, seinen Gitarren auf der Bühne den Hals zu brechen. „Man muss glauben, um zu sehen“, gibt Lord Winsley seinem neuen Schützling mit auf den Weg. Oder ist es etwa doch umgekehrt?

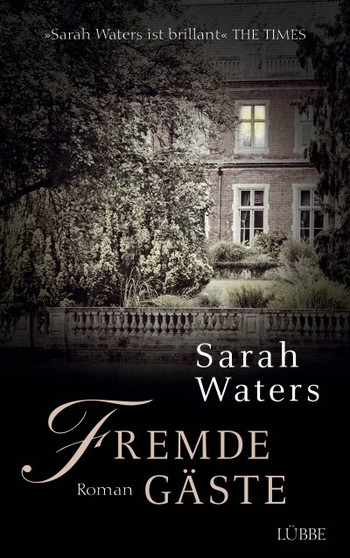
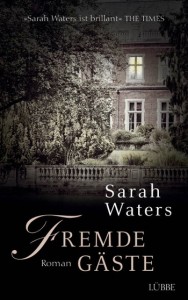 Die Damen Wray sehen sich in ihren schwierigen finanziellen Verhältnissen gezwungen, Mieter aufzunehmen. Ein junges Paar aus der Arbeiterklasse, Lilian und Leonard, zieht ein. Scheinbar modern sind sie, ausgelassen und jung, sie glauben an eine bessere Zukunft. Mit ihnen verändert sich alles, nicht nur die mühsam gewahrte Ruhe und Routine im Haus. Wecken Lilian und Leonard zunächst nur die Neugier der Damen Wray, üben beide bald schon auf Frances eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Sie zwingen sie, ihre eigenes Leben und einiges aus ihrer gar nicht so unbeschriebenen Vergangenheit neu zu überdenken. Hat sie ihre Verarmung, ihren Rückzug in traditionelle Werte und Pflichten nicht als eine Art Schutzschild mißbraucht?.Dazu kommt vor allem Leonards zupackende Art, mutig und ehrgeizig im Leben voranzukommen, die Frances zeigt, dass es auch in und an einem selbst liegt, was man aus seinem Leben macht.
Die Damen Wray sehen sich in ihren schwierigen finanziellen Verhältnissen gezwungen, Mieter aufzunehmen. Ein junges Paar aus der Arbeiterklasse, Lilian und Leonard, zieht ein. Scheinbar modern sind sie, ausgelassen und jung, sie glauben an eine bessere Zukunft. Mit ihnen verändert sich alles, nicht nur die mühsam gewahrte Ruhe und Routine im Haus. Wecken Lilian und Leonard zunächst nur die Neugier der Damen Wray, üben beide bald schon auf Frances eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Sie zwingen sie, ihre eigenes Leben und einiges aus ihrer gar nicht so unbeschriebenen Vergangenheit neu zu überdenken. Hat sie ihre Verarmung, ihren Rückzug in traditionelle Werte und Pflichten nicht als eine Art Schutzschild mißbraucht?.Dazu kommt vor allem Leonards zupackende Art, mutig und ehrgeizig im Leben voranzukommen, die Frances zeigt, dass es auch in und an einem selbst liegt, was man aus seinem Leben macht.