 Von Fischen und Menschen
Von Fischen und Menschen
Der zweite Roman von Angelika Overath trägt den rätselhaften Titel «Flughafenfische». Das Rätsel klärt sich bereits auf der ersten Seite, denn die titelgebenden Fische leben in einem riesigen Aquarium in der Transithalle eines nicht benannten internationalen Flughafens. In einem kammerspielartigen Setting lässt die Autorin im Gewimmel der Reisenden dort drei Menschen auftreten, deren Leben nicht unterschiedlicher sein könnte. Das verbindende Element dieser solitären Romanfiguren ist ihre inmitten der Menschenmassen irreal wirkende, ganz individuelle Einsamkeit.
Da ist zunächst Tobias, der nie verreist, Hüter eines künstlich angelegten Korallenriffs, das mit seinen zwanzig Kubikmetern Wasser wie ein dekorativer Raumteiler eine in den südlichen Ozeanen beheimatete Tier- und Pflanzenwelt beherbergt. Übermüdet von einem strapaziösen Langstreckenflug wartet Elis in diesem Transitbereich auf ihren verspäteten Anschlussflug. Sie ist eine erfolgreiche Fotografin, die rund um den Erdball jettet, mit den unterschiedlichsten Aufträgen für Artikel in angesagten Hochglanz-Magazinen. In ihrem Kopf wirbeln verschiedene Reisebilder aus Afrika und Asien schlaglichtartig durcheinander. Sie ist verblüfft, als sie plötzlich im lauten Trubel des Airports das Ruhe ausstrahlende Aquarium mit seinen stummen Bewohnern sieht. Fasziniert bleibt sie stehen, um durch die Scheiben dem munteren Treiben der bunten, exotischen Lebewesen eines Riffs zuzusehen. Ebenfalls durch Fenster abgetrennt sitzt in der Nähe im Raucherfoyer ein hoch angesehener, namenlos bleibender Professor der Biochemie, der als Vielflieger von Kongress zu Kongress eilt. Gerade eben hat er eine SMS von seiner Frau erhalten, die ihm nach dreißig Ehejahren überraschend mitteilt, dass sie sich ab sofort von ihm getrennt hat. Zigaretten rauchend grübelt er nun über seine Versäumnisse nach, lässt sein vollständig der Karriere gewidmetes Leben selbstkritisch Revue passieren.
Neben diesen beiden rastlosen Globetrottern stellt Tobias den Gegenentwurf des bodenständigen Mannes dar, der die Erfüllung seines Lebens ausschließlich in der liebevollen Betreuung der ihm anvertrauten Aquariums-Bewohner findet. Als Elis ihn anspricht, erzählt er ihr bereitwillig vom schwierigen Aufbau des künstlichen Riffs, das nur unter ganz bestimmten Bedingungen existieren kann. Es habe mehr als ein Jahr gedauert, bis all die diffizilen Parameter der chemischen Zusammensetzung des Wassers, seiner Temperatur und der erforderlichen Strömungs-Verhältnisse penibel justiert waren. Und auch die fragile Lebensgemeinschaft von Fischen, Krebsen, Muscheln, Anemonen, Schwämmen, Algen sowie der zugehörigen Unterwasser-Flora stellt ein hochkompliziertes System dar, in dem es für einzelne Spezies immer wieder mal zu Rückschlägen kommt.
Der ansonsten dialogfreie Roman aus dem Airport-Kosmos bleibt auch hier völlig unpersönlich, die Zwei am Aquarium kommen sich nicht wirklich näher, sie bleiben sich als Zufalls-Bekanntschaft letztendlich Fremde. Angelika Overaths in 18 Kapiteln erzählte, klug durchdachte Geschichte lebt von der bewundernswerten Beschreibungskunst seiner Autorin, die zuweilen sogar poetische Züge annimmt. In parataktischer Form beschreibt sie kenntnisreich und anschaulich eine nur Wenigen zugängliche, aquatische Welt, die inmitten des umweltfeindlichen Flugwahns wie ein, allerdings unbeachtet bleibendes, Mahnmal wirkt. Ihre immer wieder auf die Unterwasserwelt bezogene Metaphorik erscheint mit der Zeit allerdings etwas aufdringlich. Die nur als «Raucher» bezeichnete, als einzige in Ich-Form sinnierende Figur des Professors wirkt zudem deplaziert, seine Ehe-Thematik stellt keine gelungene, plausible Ergänzung dar. Und Tobias und Elis reden nicht wirklich miteinander, sie tauschen lediglich wechselseitig Monologe aus. Thematik und Impetus dieses Romans verblassen in Anbetracht der stilistischen Erzählkunst seiner Autorin, die hier als ‹L’art pour l’art› nutzlos verschwendet wird. Schade!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Von einem Paradies ins andere
Von einem Paradies ins andere
 Jim Morrison: Der König der Eidechsen. 50 Jahre ist Mr. Mojo Risin‘ tot und dieses Mal wohl endgültig. Das Akronym unter dem er sich wieder melden wollte, Mr. Mojo Risin‘, taucht auch in dem Titelsong der letzten Langspielplatte der Doors, „L.A. Woman“ auf: „Mr. Mojo Risin‘, got to keep on rising“ heißt es dort bedrohlich. Jim Morrison, dessen weltliche Überreste auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise ruhen, ist wohl zu ewigen Wiedergeburt verdammt. Dem Stehaufmännchen des Rock huldigt die vorliegende bebilderte, überarbeitete und erweiterte Ausgabe mit dem Titel „Jim Morrison. König der Eidechsen“.
Jim Morrison: Der König der Eidechsen. 50 Jahre ist Mr. Mojo Risin‘ tot und dieses Mal wohl endgültig. Das Akronym unter dem er sich wieder melden wollte, Mr. Mojo Risin‘, taucht auch in dem Titelsong der letzten Langspielplatte der Doors, „L.A. Woman“ auf: „Mr. Mojo Risin‘, got to keep on rising“ heißt es dort bedrohlich. Jim Morrison, dessen weltliche Überreste auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise ruhen, ist wohl zu ewigen Wiedergeburt verdammt. Dem Stehaufmännchen des Rock huldigt die vorliegende bebilderte, überarbeitete und erweiterte Ausgabe mit dem Titel „Jim Morrison. König der Eidechsen“.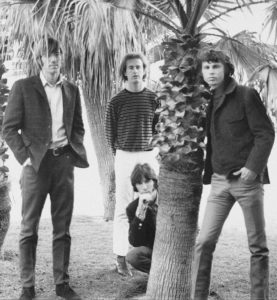


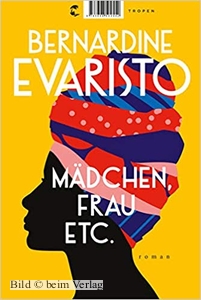 Dreadlocks etc.
Dreadlocks etc. Ein Krimi-Märchen
Ein Krimi-Märchen
 Sterndeuter dürfen sich freuen
Sterndeuter dürfen sich freuen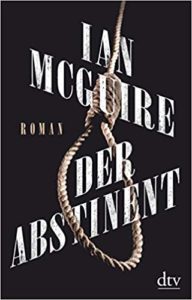

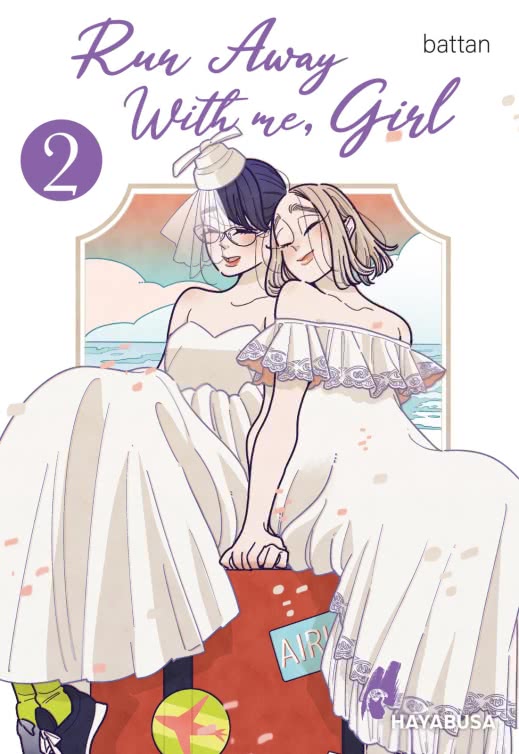
 Zu viel Yang, zu wenig Yin
Zu viel Yang, zu wenig Yin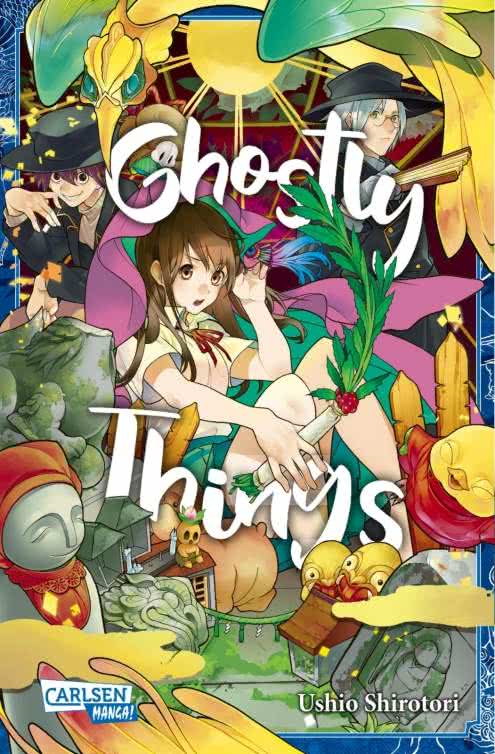 Mystery mit Nachhaltigkeit
Mystery mit Nachhaltigkeit Haushalt praktisch und nachhaltig mit gut verständlichem, reichhaltigem (Detail-)Wissen
Haushalt praktisch und nachhaltig mit gut verständlichem, reichhaltigem (Detail-)Wissen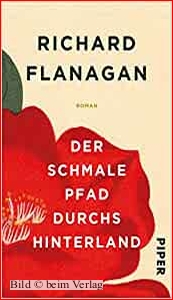 Beklemmende Lektüre
Beklemmende Lektüre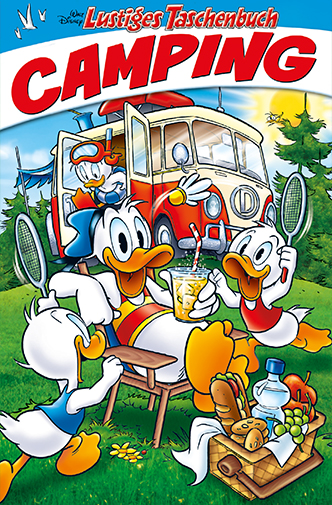 Sommer, Sonne, (günstiges) Camping
Sommer, Sonne, (günstiges) Camping