 Oberflächliche Vater/Sohn-Geschichte
Oberflächliche Vater/Sohn-Geschichte
Das Romandebüt von Jens Petersen mit dem Titel «Die Haushälterin» wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet und für den Deutschen Buchpreis 2005 nominiert. Es blieb bis dato der einzige Roman dieses Schriftstellers und Arztes, dessen Erzählungen hingegen in verschiedenen Anthologien veröffentlicht wurden. In seinem preisgekrönten Roman beschreibe er, wie die Aspekte-Jury des ZDF befand, «unsentimental, geradlinig und doch vielschichtig die Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung auf Messers Schneide».
Dieser Generationen-Roman ist auch die Geschichte einer ersten Liebe. Der sechszehnjährige Ich-Erzähler Philipp, der früh seine Mutter verloren hat, muss nun auch noch erleben, dass sein Vater, der Kernkraftwerke gewartet hat, arbeitslos wird und zu trinken anfängt. Der Haushalt der Beiden in einer ehemals prächtigen Jugendstilvilla verwahrlost zusehends. Immer öfter kommen nun auch fremde Frauen ins Haus und stehen plötzlich morgens in der Küche, was den Jungen ziemlich verstört. Sein Vater benutze seine diversen Liebschaften offensichtlich nur «wie eine Arznei gegen das Sterben», stellt er ernüchtert fest. Als der alkoholisierte Vater bei einem Sturz die Kellertreppe herunterfällt und einen komplizierten Beinbruch erleidet, engagiert Philipp kurz entschlossen eine Haushälterin. Die 23jährige Ada ist eine Studentin aus Polen, die auch als Übersetzerin arbeitet. Sie kümmert sich nun zweimal die Woche um den Haushalt und bringt ihn sehr schnell wieder ‹auf Vordermann›. Außerdem erweist sie sich auch als hervorragende Köchin, ein Glücksfall für die beiden eher stümperhaften Selbstversorger, und mit ihr kommt nun wieder Leben ins Haus. Die burschikose Ada kümmert sich auch um den Garten und springt für den durch seine Verletzung gehandicapten Vater als Chauffeur ein. Für den mitten in der Adoleszenz steckenden, eher verschlossenen Philipp ist sie der allererste Kontakt zum weiblichen Geschlecht. Sie geht ganz ungezwungen mit ihm um, lässt sich von ihm duzen, geht mit ihm schwimmen, sie besuchen zusammen eine Party, und einmal küsst sie ihn sogar. Aber wie er schon bald merkt, hat sie ganz offensichtlich einen Freund in Polen. Und was ihn noch viel mehr trifft, auch sein Vater macht ihr völlig ungeniert den Hof und überschüttet sie mit Geschenken, bietet ihr schließlich sogar ein Zimmer im Haus an. Als Nebenbuhler seines Vaters um die Gunst der lebenslustigen Ada hat Philipp keinerlei Chance, das wird ihm bald klar.
Die führwahr nicht seltene Thematik dieses Romans von der Rivalität zwischen Vater und Sohn um die gleiche Frau wird hier kühl und nüchtern in einer dem jugendlichen Erzähler angepassten Sprache geschildert. Die Figuren sind glaubwürdig charakterisiert, wobei besonders Ada sehr sympathisch wirkt, was daran liegen mag, dass man nicht alles über sie weiß. Es wird nämlich nicht alles auserzählt in diesem melancholischen Roman, manches ist nur vage angedeutet oder bleibt völlig offen. Thematisiert wird hier auch die generationsbedingt schwierige Kommunikation zwischen dem dominant auftretendem Vater und seinem eher unbedarften Sohn, die den Heranwachsenden immer wieder vor neue Probleme stellt und ihn sogar zu einigen Kurzschluss-Handlungen verleitet.
Es liegt ein Anflug von Tristesse über diesem Adoleszenz-Roman, der geradezu beiläufig von den Schwierigkeiten und Fallstricken beim Erwachsenwerden erzählt. Dabei ist jedoch immer auch ein hintergründiger Humor zu erkennen, der diesen Debütroman zu einer eher amüsanten Lektüre macht. Leider jedoch bleiben die psychologischen Hintergründe der Figuren-Konstellation völlig im Dunkeln, obwohl ja gerade darin die eigentliche Problematik der wechselseitigen Beziehungen zwischen den drei Protagonisten liegt. Durch diesen Mangel an gedanklicher Tiefe bekommt die flockig leicht erzählte Geschichte den eher trivialen Charakter eines oberflächlichen Unterhaltungs-Romans, der von der grenzenlosen Naivität seines jugendlichen Helden lebt.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de

 Pikareske Road Novel
Pikareske Road Novel Jeder Tag eine neue Herausforderung
Jeder Tag eine neue Herausforderung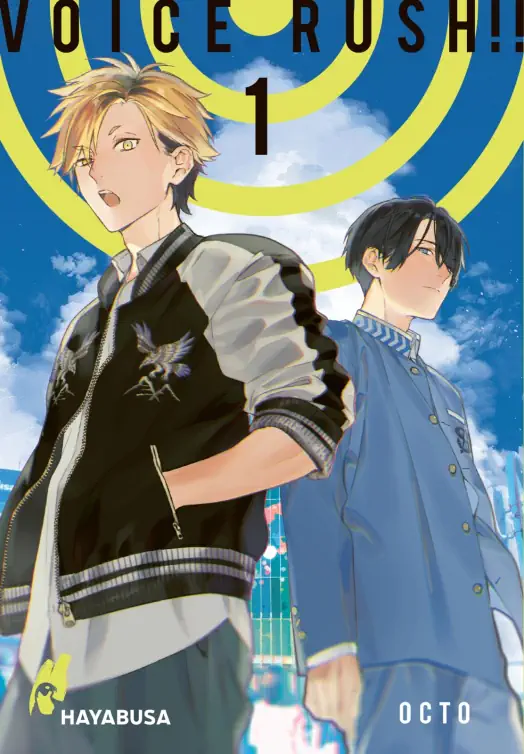
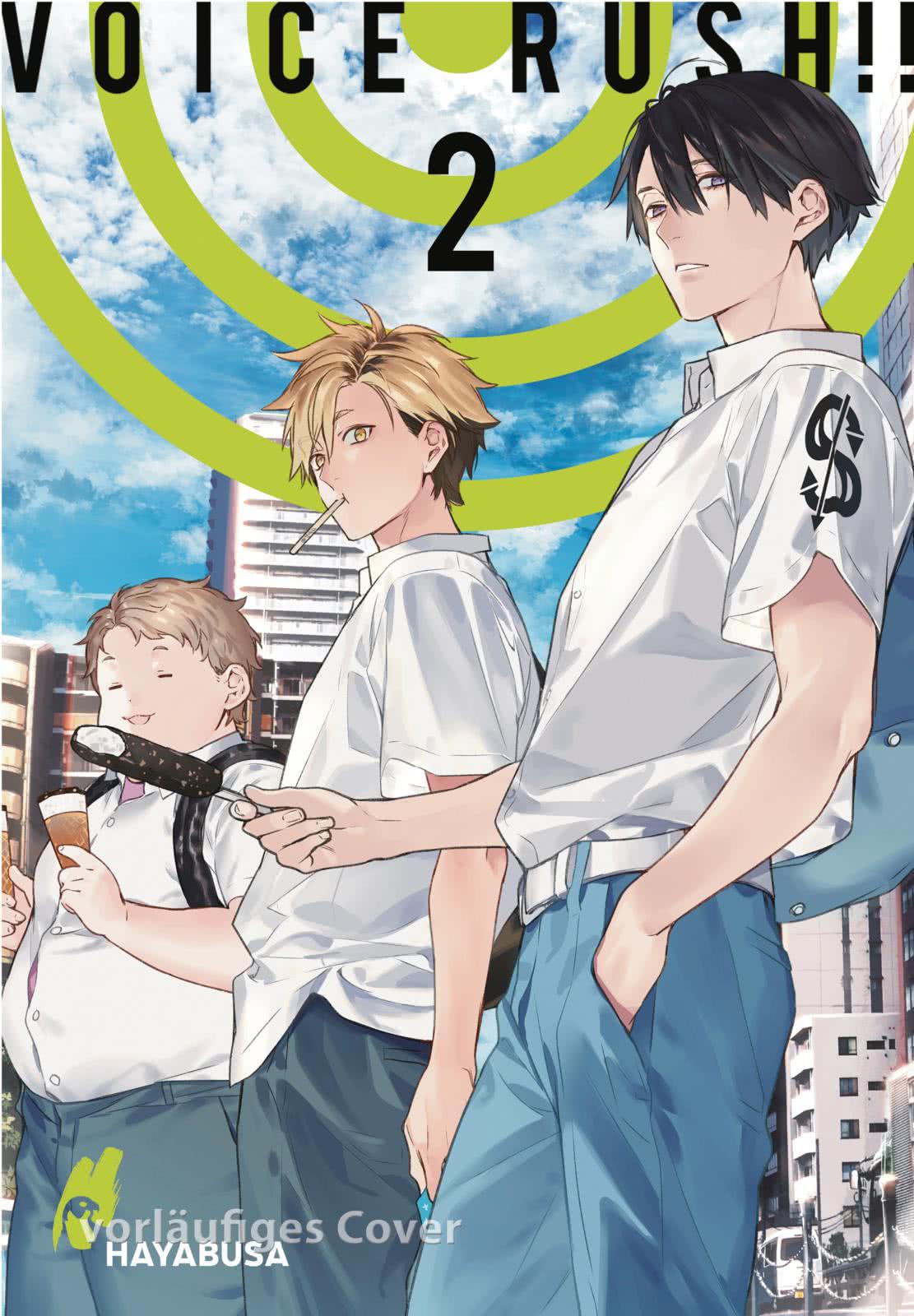
 Die Mär der 68er-Generation
Die Mär der 68er-Generation
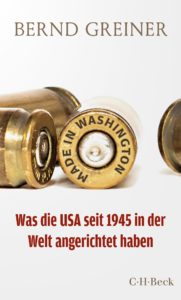 Made in Washington. “Keine andere Nation ist seit 1945 derart rabiat aufgetreten“, schreibt der Mitarbeiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg in seinem Vorwort und die Bilanz der Außenpolitik der Supermacht USA der letzten 100 Jahre fällt in der Tat ernüchternd aus. Keine andere Nation hat mehr Militärstützpunkte als die USA und gibt mehr Geld für Rüstung aus.
Made in Washington. “Keine andere Nation ist seit 1945 derart rabiat aufgetreten“, schreibt der Mitarbeiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg in seinem Vorwort und die Bilanz der Außenpolitik der Supermacht USA der letzten 100 Jahre fällt in der Tat ernüchternd aus. Keine andere Nation hat mehr Militärstützpunkte als die USA und gibt mehr Geld für Rüstung aus.
 Batman – Die Maske im Spiegel 3. Im dritten Teil der aufsehenerregende Neuinterpretation des Batman Mythos von Zeichner Andrea Sorrentino und Autor Mattson Tomlin spielt ein Doppelgänger eine undurchsichtige Rolle. Das “Black Label” in dessen Rahmen die vorliegenden Episoden um den Dunklen Ritter stattfinden ist immer wieder für Überraschungen gut.
Batman – Die Maske im Spiegel 3. Im dritten Teil der aufsehenerregende Neuinterpretation des Batman Mythos von Zeichner Andrea Sorrentino und Autor Mattson Tomlin spielt ein Doppelgänger eine undurchsichtige Rolle. Das “Black Label” in dessen Rahmen die vorliegenden Episoden um den Dunklen Ritter stattfinden ist immer wieder für Überraschungen gut. Es ist ein wunderbares kleines Büchlein, das sich, wie der Titel schon aussagt, an alle Mütter wendet. Die 55 Tipps für mehr Gelassenheit im Familienalltag sind nach dem Drei-Säulen-Konzept aufgebaut: Freude – Zeit – Liebe. Zu jeder Säule gibt es wertvolle Tipps, die kurz und prägnant ausformuliert sind. Und beim Lesen gibt es immer wieder einen Aha-Effekt. Dazu kommt, dass das Büchlein in jede Mama-Handtasche passt und damit jederzeit zur Hand genommen werden kann: am Spielplatz, beim Kinderarzt usw.
Es ist ein wunderbares kleines Büchlein, das sich, wie der Titel schon aussagt, an alle Mütter wendet. Die 55 Tipps für mehr Gelassenheit im Familienalltag sind nach dem Drei-Säulen-Konzept aufgebaut: Freude – Zeit – Liebe. Zu jeder Säule gibt es wertvolle Tipps, die kurz und prägnant ausformuliert sind. Und beim Lesen gibt es immer wieder einen Aha-Effekt. Dazu kommt, dass das Büchlein in jede Mama-Handtasche passt und damit jederzeit zur Hand genommen werden kann: am Spielplatz, beim Kinderarzt usw. Brief an einen Toten
Brief an einen Toten


 Der ewige Kampf um Dagoberts Geldspeicher – aber nicht nur
Der ewige Kampf um Dagoberts Geldspeicher – aber nicht nur