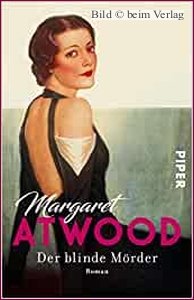 Ambivalente Familiensaga
Ambivalente Familiensaga
Die im englischsprachigen Raum vielfach geehrte, kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood hat für den Roman «Der blinde Mörder» im Jahre 2000 ihren ersten Booker Prize erhalten. Im Jahre 2019 erhielt sie dann ihren zweiten, sie gehört damit zu den vier Autoren, die ihn zweimal verliehen bekamen. Obwohl also hochgeehrt im englischen Sprachraum, ist die Rezeption im deutschen eher verhalten, insbesondere das Feuilleton zeigt sich hier skeptisch. Warum eigentlich?
Wie immer bei Atwood stehen in dieser drei Generationen umfassenden Geschichte die Frauen und ihre Rolle in der Gesellschaft im Mittelpunkt. In Rückblenden erzählt die 84jährige Iris als Ich-Erzählerin, wie sie und ihre jüngere Schwester Laura in den 1930er Jahren als wohlbehütete Töchter eines erfolgreichen Fabrikanten in Ontario aufwachsen. Als in der Depression die Firma an den Rand des Ruins gerät, heiratet Iris auf Druck des Vaters den neureichen Geschäftsmann Richard. Die fünfzehnjährige, als schwierig geltende Laura hat derweil eine heimliche Affäre mit Alex, einem gesuchten kommunistischen Aktivisten, dem eine Brandstiftung angelastet wird. Aber auch Iris verfällt ihm sexuell. Er lebt im Untergrund und zieht später mit einer kanadischen Brigade in den Krieg. Gegen Kriegsende fällt er, und als Laura erfährt, dass er auch mit Iris ein Verhältnis hatte, bringt sie sich um. Die schon einige Zeit getrennt von ihrem Mann lebende Iris entdeckt ein skandalträchtiges Roman-Manuskript von Laura mit dem Titel «Der blinde Mörder». Darin wird auktorial und mit namenlosen Figuren sehr freimütig von ihrer skandalösen Affäre erzählt, die hier als zweite Erzählebene eingeflochten ist. Nicht genug damit, ist in dieser Binnen-Geschichte eine weitere enthalten, in der Alex nach dem Sex der Geliebten Teile seiner dystopischen Story erzählt, mit Frauen in einer grotesk untergeordneten Sklavenrolle, er hält sich damit finanziell über Wasser. Ergänzend werden für die politischen Hintergründe und gesellschaftlichen Ereignisse immer wieder fiktive Zeitungs-Meldungen eingefügt, die dem Erzählten einen authentischen Touch verleihen. Das Ganze ist das handgeschriebene Manuskript von Iris, die 1999 stirbt. Sie wendet sich damit direkt an ihre in der Welt herumgeisternde Enkelin, um ihr all ihre Erinnerungen nun eben in Schriftform zu hinterlassen, wenn sie ihr schon nicht persönlich davon erzählen kann.
Mit ihrer kunstvoll verschachtelten Erzähl-Struktur breitet die Autorin in diesem Roman das üppige Panorama einer tragischen Familien-Geschichte vor dem Leser aus, angereichert mit einem interessanten sozialen und historischen Hintergrund. Gleichzeitig ist diese Saga vom allmählichen Niedergang einer einst stolzen, reichen und glücklichen Familie auch ein opulentes Sittenbild des zwanzigsten Jahrhunderts, das motivisch unwillkürlich an Thomas Mann erinnert. Der Roman ist überfrachtet mit Nebensächlichem, man weiß als Leser genau, dass die Zigaretten in einer silbernen Schatulle im Wohnzimmer verwahrt werden, weil man es gefühlt hundert Mal gelesen hat. Für männliche Leser fast unerträglich sind die ausufernden Schilderungen der Garderobe aller weiblichen Figuren, ihr Seelenleben wird hingegen sträflich vernachlässigt. Besonders die Ich-Erzählerin Iris bleibt als Mensch farblos, eine blutleere Figur ohne nennenswerte Entwicklung, und das über Jahrzehnte hinweg.
Beeindruckend jedoch ist die funkelnde Sprache, in der hier erzählt wird, angereichert mit stimmigen Metaphern und wunderbar schwarzem Humor, der besonders in der Rahmen-Geschichte der betagten Iris mit sarkastischen Anmerkungen überzeugt. Die für klare Worte bekannte Autorin spart auch nicht mit harscher gesellschaftlicher Kritik, so wenn sie zum Beispiel vom protzigen abstrakten Gemälde eines Neureichen spricht, «zusammengesetzt aus kostspieligen bunten Klecksen». Da verzeiht man dieser ambivalenten, aber auch unterhaltsamen Familiensaga dann gern ihre unübersehbaren, kleinen Schwächen.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
