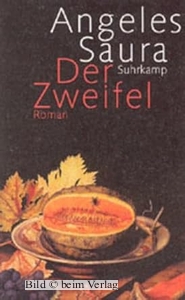 Wissenschaftlicher Super-GAU
Wissenschaftlicher Super-GAU
Der Debütroman der spanischen Schriftstellerin Ángeles Saura mit dem Titel «Der Zweifel» ist ein Kabinettstück aus der Szene der Kunsthistoriker, das tiefe Einblicke in diese akademische Disziplin bietet. Es geht um die Zuordnung eines Gemäldes aus der Barockzeit, um das ein bitterer Streit entbrennt, der tragisch endet, weil er die Existenz des Protagonisten in Frage stellt, Der nämlich hat seinen Lebenssinn in der Entdeckung und nachfolgend gründlichen Erforschung eines wenig bekannten Malers aus diese Epoche gefunden und sich damit einen weltweiten Ruf als Experte aufgebaut.
Das Lebenswerk des 84jährigen Kunstkritikers Don César Rinconeda gerät in Gefahr, als eine skandinavische Wissenschaftlerin Kontakt mit ihm aufnimmt und behauptet, das in seinem Besitz befindliche und mit F. M. signierte, lange verschollene letzte Bild «Bodegón de Ysalbos» des Barockmalers Francisco Meltán sein in Wahrheit nicht von ihm, sondern von der italienischen Malerin Fransquina Mazzanzini. Don César hatte das Bild vor 66 Jahren in einem heruntergekommenen Palazzo entdeckt und es den von seinem Wert nichts ahnenden Besitzern für lächerlich wenig Geld abgekauft. Unmittelbar nach der Kontaktaufnahme reist die Forscherin, auf seine Einladung hin, aus dem hohen Norden in die glühende Sommerhitze Kastiliens. Sie will ihm anhand von Dokumenten beweisen, dass seine Zuordnung des «Bodegón de Ysalbos» falsch ist. Der plötzlich aufgetretene, titelgebende «Zweifel» Don Césars an seiner Zuordnung ist fortan sein ärgster Feind, diese Ungewissheit bestimmt ab sofort all sein Denken und Handeln.
Ein unglaublicher Schock für ihn, denn er sieht sein ganzes Lebenswerk in Gefahr, das er ja überwiegend dem damals noch kaum bekannten Barockmaler gewidmet hat. Francisco Meltán wurde durch ihn erst in der Kunstwelt bekannt, erntete viel Anerkennung und wurde für seine ganz spezielle Malweise sogar berühmt. Anhand der vorgelegten Dokumente und Disketten der Skandinavierin wird Don César die Tragweite dieses Besuchs erst richtig bewusst, die vorgetragenen Zweifel erweisen sich als durchaus begründet. Akribisch beginnt er sofort, schriftlich einen perfekten Plan zu entwerfen, was denn genau für ihn in dieser neuen Situation zu tun bleibt, um seine wissenschaftliche Blamage zu vermeiden und sein Lebenswerk dauerhaft zu retten.
Der kammerspielartige Plot des schmalen Bändchens beschränkt sich zeitlich auf den einen Tag des Besuchs, der im Leben Don Césars mit einem Schlag alles verändert hat. Es ist zudem ein Einpersonenstück, das da konsequent in Form des Inneren Monologs erzählt wird. Man erlebt ein sprachliches und auch ein gedankliches Feuerwerk, das zuweilen an Don Quijote erinnert mit seiner Selbst-Überschätzung und Welt-Fremdheit. Genau dem ist auch Don César als Wissenschaftler zum Opfer gefallen, wie er nun entsetzt erkennen muss. Mit Monstersätzen über ganze Seiten hinweg erfordert der fast ausschließlich als innere Stimme angelegte Erzählstil des Romans, volle Aufmerksamkeit des Lesers. Zudem wird man mit einer Fülle von hochgestochenen, akademischen Fremdwörtern konfrontiert, denen man, zumal in einem Roman, kaum je schon mal begegnet ist. Ángeles Saura erzählt ihre Geschichte mit viel Witz und nicht zu übersehender, feiner Ironie. Sie beschreibt akribisch genau das Refugium des eigenwilligen Wissenschaftlers in Kastilien, sein mit allerlei Andenken und Sammlerstücken angefülltes Haus, in dem er als Witwer abgeschottet von der Welt allein lebt. In seinen Grübeleien setzt die Autorin, wie im Klappentext stimmig beschrieben, «männliche und weibliche, südlich-barocke und nordisch-aufklärerische Sicht gegeneinander». Das Ergebnis ist ein kontemplativ ungemein anregender Roman auf hohem Niveau, der fulminant von einem wissenschaftlichen Super-GAU berichtet.
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de

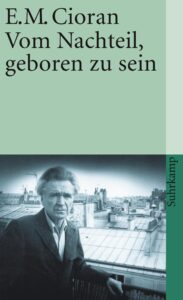 E.M. Cioran. Um den 1911 in Rasinari bei Hermannstadt in Siebenbürgen als Sohn eines griechisch-orthodoxen Priesters geborenen rumänischen Schriftsteller ist es ruhig geworden. 2024, zum 30. Jahrestag seines Todes, erschien beim Suhrkamp Verlag eine Biographie mit dem Titel “Cioran, der Ketzer” von Patrice Bollon, die ihn ausgehend von dem verhängnisvollen Irrtum seiner Jugendzeit bis hin zu seinem bedeutenden Werk als Schriftsteller und Stilisten der französischen Sprache zeigt.
E.M. Cioran. Um den 1911 in Rasinari bei Hermannstadt in Siebenbürgen als Sohn eines griechisch-orthodoxen Priesters geborenen rumänischen Schriftsteller ist es ruhig geworden. 2024, zum 30. Jahrestag seines Todes, erschien beim Suhrkamp Verlag eine Biographie mit dem Titel “Cioran, der Ketzer” von Patrice Bollon, die ihn ausgehend von dem verhängnisvollen Irrtum seiner Jugendzeit bis hin zu seinem bedeutenden Werk als Schriftsteller und Stilisten der französischen Sprache zeigt. Am besten lässt sich der existentialistische Skeptiker anhand zweier anderer Bücher beim Suhrkamp Verlag entdecken. Mit “Vom Nachteil, geboren zu sein” (1979) und “Syllogismen der Bitterkeit” (1952) lässt sich der Verfasser zahlreicher Aphorismen als Meister der Klarheit, der Eleganz und der Gelassenheit erkennen, der frei von seinen Jugendsünden voller antisemitischer und hitlerfreundlicher Äußerungen vor allem den späteren Philosophen entdecken lässt. Cioran hatte von 1928 bis 1931 das Studium der Philosophie an der Universität Bukarest belebt, bis 1939 waren schon fünf Bücher in rumänischer Sprache von dem erst 28-Jährigen erschienen.
Am besten lässt sich der existentialistische Skeptiker anhand zweier anderer Bücher beim Suhrkamp Verlag entdecken. Mit “Vom Nachteil, geboren zu sein” (1979) und “Syllogismen der Bitterkeit” (1952) lässt sich der Verfasser zahlreicher Aphorismen als Meister der Klarheit, der Eleganz und der Gelassenheit erkennen, der frei von seinen Jugendsünden voller antisemitischer und hitlerfreundlicher Äußerungen vor allem den späteren Philosophen entdecken lässt. Cioran hatte von 1928 bis 1931 das Studium der Philosophie an der Universität Bukarest belebt, bis 1939 waren schon fünf Bücher in rumänischer Sprache von dem erst 28-Jährigen erschienen.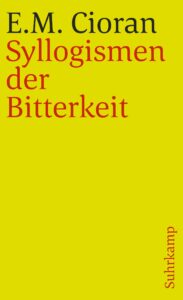 In der gleichnamigen Sammlung (im Französischen Original: Syllogismes de l’Amertume) widmet sich Cioran Themen die mit den Überschriften “Atrophie des Worts”, dem “Zirkus der Einsamkeit”, dem “Taumel der Geschichte” oder den “Quellen des Leeren” zusammengefasst wurden. Er schreibt auch “Über Musik”, den “Sog der Geschichte” oder den “Okzident”. “Wie sehr liebe ich die Geister zweiten Ranges, die aus Taktgefühl im Schatten des Genies der anderen lebten und ihr eigenes aus reiner Scheu ablehnten”, schreibt Cioran da einen Gedanken auf, der seine eigenen “stummen Tiefen” schon erahnen lässt. Im mit “Zirkus der Einsamkeit” übermittelten Kapitel geht es in seinen Aphorismen schon konkreter zur Sache: “Ich lebe nur, weil es in meiner Macht steht zu sterben, wann es mir belieben wird: ohne die /Idee/ des Selbstmords hätte ich mich schon längst getötet.” Die Verzweiflung bleibt für ihn Reportage, die Hoffnung Fiktion. Dennoch ziehe man aus dieser Fiktion die Nahrung zu leben. “Ohne Gott ist alles nichts; und Gott?”, schreibt der bei Priestern aufgewachsene Cioran, “Höchstes Nichts”.
In der gleichnamigen Sammlung (im Französischen Original: Syllogismes de l’Amertume) widmet sich Cioran Themen die mit den Überschriften “Atrophie des Worts”, dem “Zirkus der Einsamkeit”, dem “Taumel der Geschichte” oder den “Quellen des Leeren” zusammengefasst wurden. Er schreibt auch “Über Musik”, den “Sog der Geschichte” oder den “Okzident”. “Wie sehr liebe ich die Geister zweiten Ranges, die aus Taktgefühl im Schatten des Genies der anderen lebten und ihr eigenes aus reiner Scheu ablehnten”, schreibt Cioran da einen Gedanken auf, der seine eigenen “stummen Tiefen” schon erahnen lässt. Im mit “Zirkus der Einsamkeit” übermittelten Kapitel geht es in seinen Aphorismen schon konkreter zur Sache: “Ich lebe nur, weil es in meiner Macht steht zu sterben, wann es mir belieben wird: ohne die /Idee/ des Selbstmords hätte ich mich schon längst getötet.” Die Verzweiflung bleibt für ihn Reportage, die Hoffnung Fiktion. Dennoch ziehe man aus dieser Fiktion die Nahrung zu leben. “Ohne Gott ist alles nichts; und Gott?”, schreibt der bei Priestern aufgewachsene Cioran, “Höchstes Nichts”.
 Nachtfrauen. Die beiden Geschwister Mira und Stanko stehen vor einer herausfordernden Aufgabe. Ihre Mutter ist alt und soll auf den Auszug aus ihrem Haus im kärntnerischen Jaundorf vorbereitet werden. Da weder Mira noch Stanko sich um sie kümmern können, wird es für die alte Dame zu gefährlich alleine zu leben.
Nachtfrauen. Die beiden Geschwister Mira und Stanko stehen vor einer herausfordernden Aufgabe. Ihre Mutter ist alt und soll auf den Auszug aus ihrem Haus im kärntnerischen Jaundorf vorbereitet werden. Da weder Mira noch Stanko sich um sie kümmern können, wird es für die alte Dame zu gefährlich alleine zu leben.

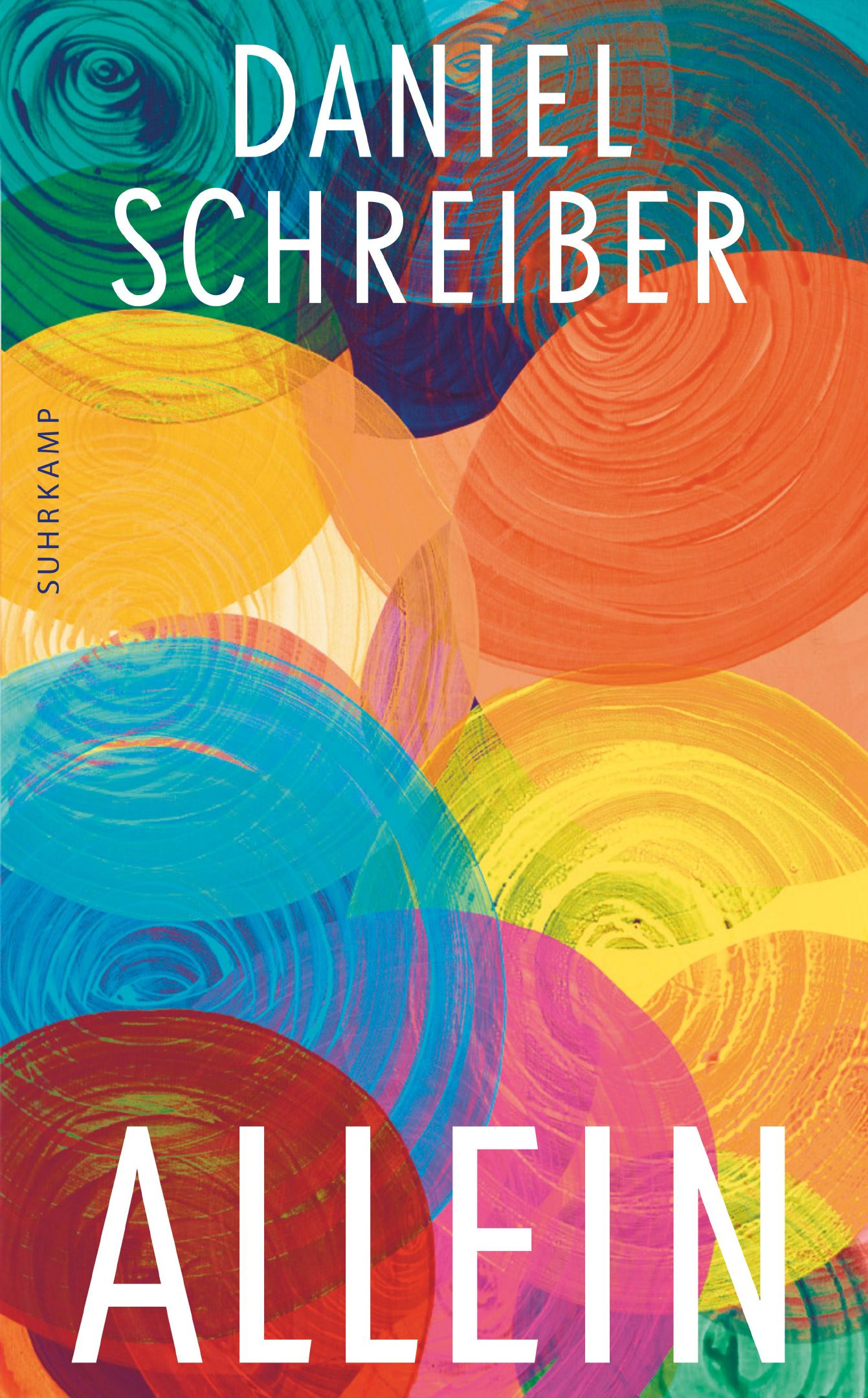

 Erinnerungen
Erinnerungen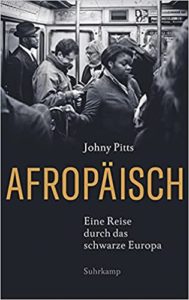 Afropäisch: Mit einem Interrailticket reist der Autor durch Europa, startet an einem 1.10. und muss genau am 31.3. zurück sein, denn er reist auf eigene Kosten, schläft dabei in Hostels, manche Einschränkungen des Komforts inbegriffen. So wird er auch Menschen begegnen, die nicht zu den Besserverdienenden gehören. Nach Plan besucht er europäische Hauptstädte und kleinere Orte im Süden Frankreichs und Spaniens: er folgt damit „seiner afropäischen Achse“. Mal reist er wie ein Flaneur, lässt sich von Zufallsbekanntschaften Geschichten erzählen, deren Informationen wird dann nachgeforscht, mal flicht er eigene Erlebnisse und Gelesenes ein.
Afropäisch: Mit einem Interrailticket reist der Autor durch Europa, startet an einem 1.10. und muss genau am 31.3. zurück sein, denn er reist auf eigene Kosten, schläft dabei in Hostels, manche Einschränkungen des Komforts inbegriffen. So wird er auch Menschen begegnen, die nicht zu den Besserverdienenden gehören. Nach Plan besucht er europäische Hauptstädte und kleinere Orte im Süden Frankreichs und Spaniens: er folgt damit „seiner afropäischen Achse“. Mal reist er wie ein Flaneur, lässt sich von Zufallsbekanntschaften Geschichten erzählen, deren Informationen wird dann nachgeforscht, mal flicht er eigene Erlebnisse und Gelesenes ein. 
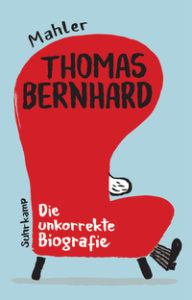

 Selbstverteidigung – Eine Philosophie der Gewalt. In ihrem Prolog zum Buch stellt die Philosophie-Professorin eine Foltermethode des beginnenden 19. Jahrhunderts den Geschehnissen um die Ermordung von Rodney King durch das LAPD im 20. Jahrhundert gegenüber. In beiden Fällen galt, dass je mehr sich der „Delinquent“ wehrte, desto mehr wurde er geschlagen oder gefoltert. Der Prozess um die Polizisten endete mit einem Freispruch. Rodney King hatte sich verteidigt, doch indem er sich verteidigte, wurde er unverteidigbar. Der Inhalt des Zeugen-Videos wurde in seiner Bedeutung einfach umgedreht. Schuldumkehr.
Selbstverteidigung – Eine Philosophie der Gewalt. In ihrem Prolog zum Buch stellt die Philosophie-Professorin eine Foltermethode des beginnenden 19. Jahrhunderts den Geschehnissen um die Ermordung von Rodney King durch das LAPD im 20. Jahrhundert gegenüber. In beiden Fällen galt, dass je mehr sich der „Delinquent“ wehrte, desto mehr wurde er geschlagen oder gefoltert. Der Prozess um die Polizisten endete mit einem Freispruch. Rodney King hatte sich verteidigt, doch indem er sich verteidigte, wurde er unverteidigbar. Der Inhalt des Zeugen-Videos wurde in seiner Bedeutung einfach umgedreht. Schuldumkehr. Ein Klassiker par excellence
Ein Klassiker par excellence
 Postdemokratie als Begriff bezieht sich auf die Tatsache, dass heute (Erstauflage 2008) mehr Nationalstaaten als jemals zuvor demokratische Verfahren zur Bestimmung ihrer Regierung praktizierten. Allerdings mag deswegen noch kein Optimismus aufkommen, denn die Art und Weise wie diese durchgeführt wurden steht auf einem anderen Blatt. Dennoch spricht der Begriff, Postdemokratie, für die Phase der Demokratie in der wir uns seither befinden und die u.a. durch Politikverdrossenheit, Sozialabbau und Privatisierung gekennzeichnet ist.
Postdemokratie als Begriff bezieht sich auf die Tatsache, dass heute (Erstauflage 2008) mehr Nationalstaaten als jemals zuvor demokratische Verfahren zur Bestimmung ihrer Regierung praktizierten. Allerdings mag deswegen noch kein Optimismus aufkommen, denn die Art und Weise wie diese durchgeführt wurden steht auf einem anderen Blatt. Dennoch spricht der Begriff, Postdemokratie, für die Phase der Demokratie in der wir uns seither befinden und die u.a. durch Politikverdrossenheit, Sozialabbau und Privatisierung gekennzeichnet ist. Auch in seinem Folgewerk, „Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus“, stellt Crouch unbequeme Fragen. Es sind die gigantischen transnationalen Konzerne, unter denen die Demokratie und das Marktmodell leiden. Crouch entwirft aber auch ein Modell des Widerstands: indem wir uns auf unsere Werte und unsere Macht als Verbraucher besinnen. Das ist Crouchs optimistische Vision einer sozialen und demokratischen Marktwirtschaft, die er in diesem Essay der Hegemonie der Konzerne entgegenhält.
Auch in seinem Folgewerk, „Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus“, stellt Crouch unbequeme Fragen. Es sind die gigantischen transnationalen Konzerne, unter denen die Demokratie und das Marktmodell leiden. Crouch entwirft aber auch ein Modell des Widerstands: indem wir uns auf unsere Werte und unsere Macht als Verbraucher besinnen. Das ist Crouchs optimistische Vision einer sozialen und demokratischen Marktwirtschaft, die er in diesem Essay der Hegemonie der Konzerne entgegenhält. Reminiszenz an die alte Welt
Reminiszenz an die alte Welt Glücklich ist, wer vergisst
Glücklich ist, wer vergisst Pathologische Skepsis
Pathologische Skepsis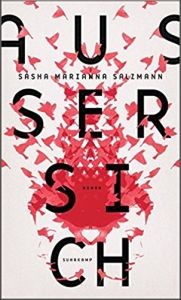 Пошёл ты!
Пошёл ты!