 Mehr Essay als Roman
Mehr Essay als Roman
Niemand bedient den aktuellen literarischen Trend des Dorfromans so erfolgreich wie Juli Zeh, die fünf Jahre nach ihrem Erfolg mit «Unterleuten» nun mit «Über Menschen» wieder das Großstadtleben Berlins dem Landleben in einem öden brandenburgischen Kaff gegenüberstellt. Dieser Gesellschafts-Roman konzentriert sich, anders als sein Vorgänger von 2016, auf nur wenige Figuren aus einem fiktiven Ort namens Brackendorf. Thematisch widmet er sich außer dem Corona-Wirrwar dem latenten Alltags-Rassismus und einem missionarisch betriebenem Umweltschutz. Sie hoffe, hat die Autorin erklärt, dass ihr Buch helfe, Barrieren zu überwinden.
Zeitlich ist der Roman im ersten Lockdown Anfang 2021 angesiedelt, als die 36jährige Werbetexterin Dora sich von ihrem Freund trennt, der als glühender Klima-Aktivist immer abstrusere Thesen vertritt und ihr damit den Alltag vergällt. Zusätzlich genervt von den Einschränkungen des Lockdowns, hat sie kurz entschlossen ein schon lange leerstehendes Haus in dem 285-Seelen-Dorf gekauft und ist mit ihrer Hündin, die transgender-gemäß den Namen «Jochen-der-Rochen» trägt, in das auch für sie so verheißungsvolle Landleben geflüchtet. Wie nicht anders zu erwarten wird sie jedoch als Städterin sogleich mit den profanen Alltagsproblemen des Landlebens konfrontiert, aber auch mit mentalen Hürden, die es im Zusammenleben mit den wenigen Nachbarn zu überwinden gilt. Ihren ersten Kontakt hat sie über die hohe Trennmauer hinweg mit ihrem direkten Nachbarn, der wütend ist, weil ‹Jochen› im Kartoffelbeet gegraben hat, weshalb er die Hündin nun im hohen Bogen über die Mauer zurückwirft auf Doras Grundstück. Er sei übrigens der Dorfnazi, erklärt er ihr lapidar, und werde von allen ‹Gote› genannt. Im Wald trifft Dora auf Franzi, die, wie sich herausstellt, Gotes zehnjährige Tochter ist und beim Vater lebt. Ferner macht sie Bekanntschaft mit dem Floristen Tom und dem Kabarettisten Steffen, einem schwulen Männerpaar, das dekorative Pflanzen-Gestecken herstellt. Der Verkauf floriert, in Zukunft wollen sie damit auch im Internet tätig werden, wobei die inzwischen arbeitslos gewordene Dora ihnen helfen soll. Der Nachbar Heinrich von gegenüber, der den Spitznamen R2-D2 trägt, macht sich ungefragt über Doras verwilderten Garten her, während Gote, der früher Schreiner war, ihr unaufgefordert Möbel baut und in ihr leeres Haus stellt. Und Sadie schließlich steht mit einem Sack Saatkartoffeln vor der Tür, die beim Händler derzeit nirgends zu bekommen sind, und erzählt beim Kaffee, dass sie als alleinerziehende Mutter permanent in Nachschicht arbeiten muss, um finanziell über die Runden zu kommen
Soweit die Dorfidylle mit ihren vielen Klischees, die den Hintergrund bilden für die sozialen Verwerfungen, die Juli Zeh mit ihrem Roman aufzeigen will. Als Hauptübel entlarvt sie die permanente Unzufriedenheit der Menschen, die fast alles haben, sich aber trotzdem ständig an irgendwas stören, über irgendwas aufregen, anderen unbedingt ihre Meinung aufzwingen wollen. Schon kleinste Beeinträchtigungen des Wohlergehens werden da als Katastrophe wahrgenommen und erbittert bekämpft. Mit analytischem Scharfblick zeigt die Autorin durch ihr obskures Figuren-Ensemble nicht nur, wie solch verhärtete Fronten entstehen, sondern auch, wie sie sich fast von allein auflösen, wenn Menschlichkeit ins Spiel kommt, die ja schließlich in jedem stecke. Das gerät ihr allerdings oft gar zu rührselig und märchenhaft, aber Empathie für ihre Figuren kommt trotzdem nicht auf.
Irritierend ist am Ende die erkennbare Absicht der Autorin, die Untaten ihres Protagonisten Gote durch seine tückische Erkrankung zu relativieren. Und dass nun ausgerechnet Doras Vater dafür als medizinische Koryphäe in der Charité gilt, strapaziert den Zufall denn doch zu arg. Das Gedankengut dieses Romans wäre besser in einem brillant formulierten Essay verarbeitet worden, für einen Roman nämlich fehlt neben dem Impetus vor allem ein tragfähiger Plot.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Politisches Terra incognita
Politisches Terra incognita Von echten Werten und der Rückkehr des Lebensmutes
Von echten Werten und der Rückkehr des Lebensmutes

 Auf der Suche nach dem Bindemittel
Auf der Suche nach dem Bindemittel Das glücklichste Buch
Das glücklichste Buch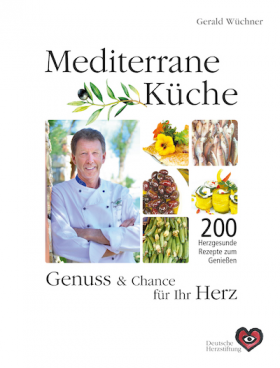 Bewegung ist Leben, Lebensmittel sind Mittel zum Leben
Bewegung ist Leben, Lebensmittel sind Mittel zum Leben Kunst als Ersatzheimat
Kunst als Ersatzheimat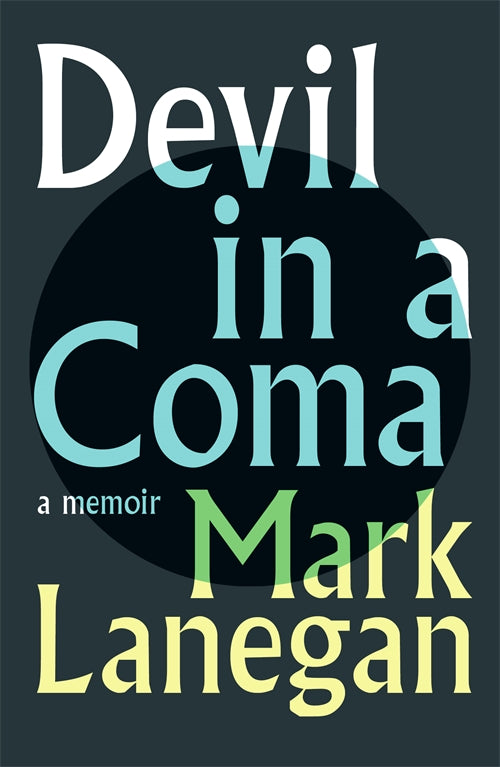


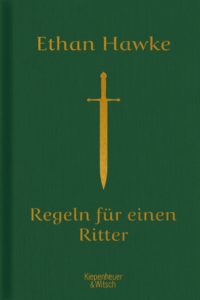


 Demokratie? Echt? Und wenn ja: Für wen?
Demokratie? Echt? Und wenn ja: Für wen? Irrlichternde Erzählerstimme
Irrlichternde Erzählerstimme
 50 Jahre Der Pate. 14. März 1972: Weltpremiere “Der Pate“. Der Pate auch als The Godfather im deutschen Sprachraum bekannt wird 50. Gemeint ist weder die Figur des Vito “Don” Corleone” noch die Romanvorlage, sondern der Film von Francis Ford Coppola, der 1972 veröffentlicht wurde. Der Roman selbst kam wenige Jahre vorher, 1969, auf den Markt. Ein guter Grund für eine Re-Lektüre. “Jeder kennt den grandiosen Film. Nur wenige wissen: Der Film ist so gut, weil die Romanvorlage genial ist. Jetzt zum Wiederentdecken!” So wirbt der Verlag für seine schöne Ausgabe in scharlachrotem Cover. Mit Blutstropfen am Revere.
50 Jahre Der Pate. 14. März 1972: Weltpremiere “Der Pate“. Der Pate auch als The Godfather im deutschen Sprachraum bekannt wird 50. Gemeint ist weder die Figur des Vito “Don” Corleone” noch die Romanvorlage, sondern der Film von Francis Ford Coppola, der 1972 veröffentlicht wurde. Der Roman selbst kam wenige Jahre vorher, 1969, auf den Markt. Ein guter Grund für eine Re-Lektüre. “Jeder kennt den grandiosen Film. Nur wenige wissen: Der Film ist so gut, weil die Romanvorlage genial ist. Jetzt zum Wiederentdecken!” So wirbt der Verlag für seine schöne Ausgabe in scharlachrotem Cover. Mit Blutstropfen am Revere. “Das ist eigentlich das Einzige, worum es bei connect geht. Um Nähe. Der Name sagt es ja schon und viel mehr steckt tatsächlich nicht dahinter. Verbindungen zwischen Menschen schaffen. Das ist alles.” (Dev)
“Das ist eigentlich das Einzige, worum es bei connect geht. Um Nähe. Der Name sagt es ja schon und viel mehr steckt tatsächlich nicht dahinter. Verbindungen zwischen Menschen schaffen. Das ist alles.” (Dev)