Der in Berlin lebende Brite Adam Fletcher schwelgt in Worten und Begriffen. Bereits beim Titel seines Buches „A Picnic For Perverts“ fragt sich der Rezensent, ob damit wohl ein gemeinsames Mahl von Perversen beschrieben wird oder der Autor den Begriff der Pervertierung verwendet und damit im übertragenen Sinne ein Picknick von Entstellten, Missbrauchten, Verdrehten, Verhunzten, Verstümmelten und Verkorksten meint. Um sicher zu gehen, befragt er den Verfasser. Der antwortet, sein Titel habe keinen Bezug zum Buch und wäre lediglich ein Hinweis auf sein ungewöhnliches Verständnis von Humor.
Dabei greift schon der erste der Texte in dem Band den Begriff „Picnic For Perverts“ auf. Es ist ein Brief an Tom Six, den Regisseur des niederländischen Horrorfilms „Der Menschliche Tausendfüßler“. In diesem unter Horrorfans heiß diskutierten Streifen näht ein verrückter deutscher Chirurg zwei Amerikanerinnen und einen Japaner, die er gefangen hält, zusammen, indem jeweils die Nase des einen in das Arschloch des anderen gesteckt wird.
Nachdem er sich während der Vorführung in eine Tüte seines Lieblings-Popcorns mit Käsegeschmack, das er bei der Gelegenheit wärmstens empfiehlt, übergeben hat, fragt Fletcher in seiner in den Brief eines begeisterten Studenten gekleideten Rezension, warum jemand ein derartig ekelhaftes und unnützes Werk in eine Welt setzt, die bestenfalls „A Picnic For Perverts“ sei. Und er ergründet den Sinn des Films, dem er unterstellt, er müsse einfach einen tieferen Sinn haben. Schließlich entdeckt er ihn in der Erkenntnis, dass wir doch alle irgendwie in die Münder unserer Mitmenschen scheißen. Wie die Charaktere des Films unlösbar aneinander geschmiedet sind, so sei die gesamte Menschheit in ihrem Schicksal miteinander verwoben.
In „Quadrup“, der umfangreichsten Geschichte des Bandes, wird der Leser auf einen weit entfernten Planeten gleichen Namens entführt. Er begegnet dem Propagandisten eines Managementprogramms gegen die Bevölkerungsexplosion, denn die Quadruper vermehren sich rasend und sollen deshalb überredet werden, auf den Planeten Erde umzusiedeln, auf dem es vergleichsweise ausreichend Raum gibt.
Nun stellt sich diese Werbeaktion für Umsiedlungswillige äußerst schwierig da, denn auf der Erde ist alles anders als auf Quadrup – und es ist vor allem aus der Sicht der lebenslustigen Planetenbewohner wesentlich schlechter. Man lebt auf der Erde eingepfercht in ein System, das sowohl die Arbeit – als auch die Freizeit reglementiert. Es ist verboten, abgesehen von den Hochburgen einiger Spezialreligionen, mehr als eine Frau zu haben. Kurz, es gibt keinen vernünftigen Grund, Quadrup zu verlassen.
So liest sich der Dialog zwischen dem Umsiedlungswerber und seinem „Opfer“ wie eine karnevalistische Büttenrede über die Unzulänglichkeit des Daseins auf dem Planeten Erde. Doch schließlich wandert wie von Zauberhand ein irdischer Schokoladenriegel in den Mund des umworbenen Bewohners von Quadrup. Und siehe da: Der Mann wechselt für den zu erwartenden Genuss der Süßigkeit in Permanenz vom Paradies in die Hölle und unterschreibt. (Hat der Autor beim Verfassen dieser Geschichte gar das Beispiel mancher DDRler vor Augen, die ihre Seele für ein Bündel Bananen verkauften?)
Auf diese Parodie folgt eine Parabel, die im dreiaktigen Bauprinzip der aristotelischen Dramatik verfasst wurde: Das Schaf Trudy, wer möchte es im verwehren, macht sich nach zehn Jahren gedankenlosem Grasen Sorgen um seine Zukunft. Es macht sich auf den Weg zu Periwinkels Farm, um sich einem Vorstellungsgespräch zu stellen. In modernen Zeiten einen Job als Schaf in einer Schafherde zu finden, ist schwer, und Trudy zittert vor dem Bewerbungsausschuss, dem sie sich stellen muss. Zusätzlich verunsichert wird sie durch Jimmy, einen Gorilla, der ebenfalls den Job haben möchte, weil Gorillas aus der Mode gekommen sind und ihr Habitat weitgehend vernichtet wurde.
Vor dem unerbittlichen Prüfungsausschuss hinterlässt Trudy keinen besonders günstigen Eindruck. Sie kann zwar enorm viel Gras fressen und Wolle produzieren und entspricht damit den formalen Anforderungen der Stelle. Leider weiß sie jedoch weder etwas über die Geschichte und Bedeutung der Farm noch hat sie als Herdentier je zuvor spezielle Führungseigenschaften bewiesen. Auch als Teammitglied hat sie nie ein anderes Ziel verfolgt, als mit den anderen gemeinsam Gras zu vertilgen.
Sammy, der Gorilla, hat sich hingegen zuvor im Internet über die Farm informiert und kann einen ausführlichen Vortrag halten, der in einem verlogenen Lobgesang auf die dort produzierten Eier mündet. Er kann ein wichtiges Zertifikat in Schafkunde vorweisen, wenngleich er eingestehen muss, dass er keine Wolle auf seinen Körper wachsen lassen kann, obwohl er über das Thema des Wachstums von Schafwolle auf Körpern promoviert hat. Zusätzlich kann er hervorragende Führungseigenschaften vorweisen und beantwortet die Frage der Kommission nach seinen Schwächen mit „Übereifer“ und „Arbeitswut“.
Keine Frage. Der Job als Schaf geht an Jimmy, den Gorilla. Trudy, das Schaf, sucht sich darauf einen Job in einem Wolfsrudel, dem sie als Lockvogel dient. Als das Rudel erfährt, dass auf Periwinkels Farm ein besonders riesiges Schaf weidet, wird der Bauernhof überfallen und Trudy trifft ihren einstigen Mitbewerber wieder, der in einem übergroßen weißen Wollmantel versucht, einen guten Job als Schaf zu machen. Als Trudy ihm von ihrer Mission erzählt, weist Jimmy sie fassungslos darauf hin, dass er ein Gorilla sei, den Wölfe nicht mögen. Sie verspricht ihm, sein Geheimnis zu wahren und gibt ihr Bestes, in ein Geheul einzustimmen, das die Meute zum Festmahl ruft …
Mal absurd, mal philosophisch geht es auf diese Weise weiter in Fletchers kruder Zusammenstellung. Er liefert Hochgenuss für den, der schwarzen Humor liebt und Freude am akrobatischen Spiel mit Worten hat. Mir hat die Lektüre enorm viel Spaß geschenkt, es ist eines der abwechslungsreichsten Bücher, die mir in jüngerer Zeit vor die Füße gefallen sind, wenn auch mein Englisch dem Sprachwitz des Autors nicht immer standgehalten hat.
Diskussion dieser Rezension im Blog der Literaturzeitschrift

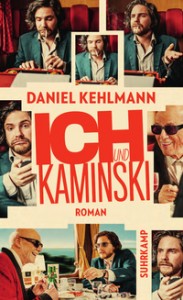 Sebastian Zöllner, ein von Freunden und Freundin verlassener, erfolgloser Journalist, setzt kurz vor seiner endgültigen Pleite alles auf eine Karte, um einen guten Job in der Kunstszene zu ergattern. Er will ein Buch, ein bleibendes Quellenwerk, über einen uralten, zurückgezogen lebenden Maler schreiben, der als einer der Großen seiner Zunft gilt: Manuel Kaminski, ein von Picasso und Matisse gelobter Malerfürst.
Sebastian Zöllner, ein von Freunden und Freundin verlassener, erfolgloser Journalist, setzt kurz vor seiner endgültigen Pleite alles auf eine Karte, um einen guten Job in der Kunstszene zu ergattern. Er will ein Buch, ein bleibendes Quellenwerk, über einen uralten, zurückgezogen lebenden Maler schreiben, der als einer der Großen seiner Zunft gilt: Manuel Kaminski, ein von Picasso und Matisse gelobter Malerfürst.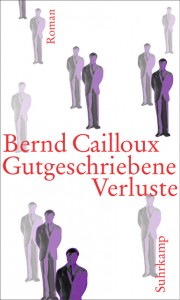 In seinem autobiographischen Werk »Gutgeschriebene Verluste« thematisiert Bernd Cailloux Einsamkeit als Gruppenerlebnis. Er beginnt und endet seine als Roman gewandeten Memoiren in einem Schöneberger Szene-Café, das er als »Treffpunkt der Übriggebliebenen« charakterisiert. Dort trifft der Erzähler auf ein werweißwie zusammengewürfeltes kontaktscheu-cooles Publikum, allesamt Virtuosen der Distanz. Wie einer anderen Rezension entnommen werden kann, handelt es sich dabei konkret um »Literatur-Professoren, die in der FAZ schreiben, Herausgeber von intellektuellen Zeitschriften, Maler, Suhrkamp-AutorInnen, taz-Redakteure, sonstige Künstler und eine Frau mit 2/5 Stelle bei einem Rundfunksender«.
In seinem autobiographischen Werk »Gutgeschriebene Verluste« thematisiert Bernd Cailloux Einsamkeit als Gruppenerlebnis. Er beginnt und endet seine als Roman gewandeten Memoiren in einem Schöneberger Szene-Café, das er als »Treffpunkt der Übriggebliebenen« charakterisiert. Dort trifft der Erzähler auf ein werweißwie zusammengewürfeltes kontaktscheu-cooles Publikum, allesamt Virtuosen der Distanz. Wie einer anderen Rezension entnommen werden kann, handelt es sich dabei konkret um »Literatur-Professoren, die in der FAZ schreiben, Herausgeber von intellektuellen Zeitschriften, Maler, Suhrkamp-AutorInnen, taz-Redakteure, sonstige Künstler und eine Frau mit 2/5 Stelle bei einem Rundfunksender«. Chris Karlden ist als Autor ein bislang unbeschriebenes Blatt. Der Saarländer legt mit »Monströs« seinen Erstling vor und trifft damit gleich voll ins Schwarze. Aus dem Nichts schob der Self-Publisher seinen Psychothriller in die Top Ten von Amazons Bestenliste.
Chris Karlden ist als Autor ein bislang unbeschriebenes Blatt. Der Saarländer legt mit »Monströs« seinen Erstling vor und trifft damit gleich voll ins Schwarze. Aus dem Nichts schob der Self-Publisher seinen Psychothriller in die Top Ten von Amazons Bestenliste. Jürgen Henschel stand in der Tradition der Arbeiterfotografen der Zwanziger Jahre. Stets begleitete »der Mann mit der Leiter« die Proteste der jungen Westberliner Generation, die sich 1968/69 in schweren Auseinandersetzungen entluden. Er war Chronist der APO und der anschließenden Protestbewegungen »von unten«.
Jürgen Henschel stand in der Tradition der Arbeiterfotografen der Zwanziger Jahre. Stets begleitete »der Mann mit der Leiter« die Proteste der jungen Westberliner Generation, die sich 1968/69 in schweren Auseinandersetzungen entluden. Er war Chronist der APO und der anschließenden Protestbewegungen »von unten«.
