
Als alle Charlie sein wollten
Das Leben des französischen Journalisten Philippe Lançon, der für die Tageszeitung „Libération“ und das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ schreibt, veränderte sich am 7. Januar 2015 auf fundamentale Art und Weise: Am Morgen jenes Tages verübt die Organisation „Al-Quaida im Jemen“ einen Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris. Sie töten elf Menschen und verletzen mehrere.
Philippe Lançon überlebte den Anschlag nur knapp und wurde an Händen und Armen schwer verletzt – vor allem aber im Gesicht. Sein Mund und sein kompletter Unterkiefer wurden weggeschossen, übrig blieb ein klaffendes Loch. Er muss sich 17 Operationen unterziehen. Fast das gesamte Jahr 2015 verbrachte er in der Chirurgie des Hôpital de la Pitié-Salpêtrière und zur Anschlussheilbehandlung im Hôpital des Invalides.
„Der Fetzen“ beginnt mit drei hinführenden Kapiteln („Was ihr wollt“, „Fliegender Teppich“, „Die Konferenz“) und kommt dann zur Sache selbst: eine detaillierte Beschreibung des 7. Januar 2015, der Tag des Attentats. Es war ein Jazzbuch, das Philippe das Leben gerettet hat. Philippe wollte eigentlich schon aufbrechen, doch er blieb noch zwei Minuten stehen, um dem Comiczeichner Jean Cabut – der beim Anschlag ermordet wurde – ein neues Jazzbuch zu zeigen:
„Wenn ich nicht stehengeblieben wäre, um es ihm zu zeigen, wäre ich zwei Minuten früher gegangen und, ich habe es hundertfach durchgerechnet, im Flur oder im Treppenhaus auf die beiden Mörder gestoßen. Sie hätten mir wahrscheinlich eine Kugel oder mehrere in den Kopf gejagt, und ich wäre den anderen Palinuri, meinen Gefährten, ans Ufer der grausamen Bewohner und in die einzig existierende Hölle gefolgt; die, in der man nicht mehr lebt“ (Seite 74f.).
Der Roman endet in den Novembertagen 2015, als Philippe die erste USA-Reise seit dem Anschlag unternimmt. In New York erreichen in die Berichte von den Anschlägen vom 13. November 2015 des sog. „Islamischen Staates“ (IS) in Paris, bei denen 130 Menschen getötet und mehr als 680 verletzt wurden. Seine Chirurgin Chloé, die weiß, dass Philippe gerade nicht in Frankreich weilt, schreibt ihm eine SMS um ein Uhr morgens:
„Ich bin froh, Sie weit weg zu wissen. Kommen Sie nicht so bald wieder“ (Seite 548).
Mit dieser SMS endet der Roman von Philippe Lançon.
Zum Zeitpunkt des Anschlages im Jahr 2015 war Charlie Hebdo eine Zeitschrift, die eigentlich bereits am Ende war, Philippe spricht offen vom „Niedergang“ – sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Dieser Rückblick auf die Zeit vor 2015 ist wichtig, denn der nach dem Anschlag entstehende Hype unter dem Slogan „Ich bin Charlie“ kommt nicht ganz ohne Heuchelei aus. Philippe erläutert, dass „Charlie Hebdo“ bis zur Affäre um die Mohammed-Karikaturen um Jahr 2006 eine maßgebliche Rolle in der Kulturlandschaft gespielt hat. Doch danach distanzierten sich die meisten Zeitungen von der Wochenzeitschrift, weil sie die Mohammed-Karikaturen veröffentlich hatte. Die Zeitung wurde um ihre Stammleserschaft gebracht. Entsprechend deutlich waren die Worte von Philippe:
„Abwechselnd kam man sich vor wie in einer Teestube oder in der Replik einer stalinistischen Zell. Diese fehlende Solidarität war nicht nur eine berufliche und moralische Schande. Indem sie Charlie isolierte und anprangerte, machte sie die Zeitung zu einer Zielscheibe der Islamisten“ (Seite 65).
Man kann durchaus die These vertreten: Hätte es den Anschlag nicht gegeben, es würde „Charlie Hebdo“ heute nicht mehr geben. Der Anschlag veränderte alles – auch die betriebswirtschaftliche, ökonomische Situation der Wochenzeitschrift:
„Am 7. Januar 2015 gegen 10 Uhr 30 waren in Frankreich nicht viele Leute Charlie“ (Seite 66).
Nur wenige Minuten später kam es zu einer radikalen Veränderung. Viele wollten Charlie sein.
Zwei Leben
Die fundamentale Art und Weise, auf die sich das Leben von Philippe durch den Anschlag veränderte besteht darin: der alte Philippe ist tot. Der 7. Januar 2015 war die „Stunde Null“ für Philippe. Seine alte Identität war weggefetzt worden. Sehr detailliert beschreibt er das Attentat und die unmittelbaren Minuten und Stunden danach. Es sind jene Bilder, die sich durch den Rest des Buches hindurchziehen. In seiner eigenen Blutlache liegend setzt sich der Anblick seines Kollegen und Freundes Bernard in seinen Gedanken fest, der tot auf dem Bauch lag und dessen Gehirn aus dem Schäden hervorquoll:
„Bernard ist tot, sagt mir derjenige, der ich war, und ich antwortete, ja, er ist tot, und genau hier wurden wir eins, an jenem Punkt, an dem dieses Gehirn hervorquoll, das ich am liebsten wieder in den Schädel zurückgestopft hätte und von dem ich mich nicht mehr losreißen konnte, denn seinetwegen habe ich in diesem Moment endlich gespürt und begriffen, dass etwas nicht rückgängig zu Machendes geschehen war“ (Seite 87).
Ist der neue Philippe ein Opfer? Ist er ein Held?
Ein Krankenpfleger sagt einmal zu Philippe, dass es nun in seiner Familie einen Helden gebe (Seite 196). Doch Philippe beschreibt, dass er sich nicht als Held fühlt und sich gleichzeitig schämt, die ihm von den Umständen zugewiesene Rolle nicht spielen zu können. Er gibt offen zu, dass er die typischen Schuldgefühle des Patienten habe. Er ist in allem abhängig und kann nicht einmal die Abhängigkeit kontrollieren. Eine besondere Abhängigkeit durchzieht sich im ganzen Roman zu seiner Chirurgin Chloé, die seinen neuen Unterkiefer gemacht hat. Chloé wird von Philippe idealisiert – oft stellt der Leser sich die Frage: Hat sich Philippe in Chloé verliebt? Doch diese Romantik bleibt uns Lesern dankenswerter Weise erspart.
Philippes Buch ist weder eine Heldengeschichte noch die Anklageschrift eines Opfers. Philippe ist Überlebender. Sein neuer Unterkiefer, den er ab sofort „Schnitzel“ nennt, wird mühsam aus einem seiner Wadenbeine rekonstruiert.
Bereits sieben Tage nach dem Attentat veröffentlicht Philippe einen Beitrag in „Libération“. Zum ersten Mal in seiner damals dreißigjährigen Berufstätigkeit berichtete er in einer Zeitung über sich selbst. Nicht zuletzt diese Zeilen sind eine sehr lohnenswerte Lektüre, denn sie erinnern uns an den Wert der Pressefreiheit:
„Dieses Attentat hat mir in Erinnerung gerufen, wenn nicht erst entschlossen, weshalb ich meinen Beruf bei diesen beiden Zeitungen ausübe – weil ich die Freiheit hochhalte und für sie eintreten möchte, in Form von Nachrichten oder Karikaturen, in guter Gesellschaft und in allen möglichen Formen, die, selbst wenn sie missraten sind, kein Urteil verdienen“ (Seite 215).
Philippe hat diese Freiheit mit dem Drittel seines Gesichts bezahlt.
Rekonstruktion durch Literatur: Kann Literatur wirklich Leben retten?
Das Ziel von „Der Fetzen“ ist eine Rekonstruktion in einem doppelten Sinne. Zum einen geht es für Philippe darum, dem Leser und dem „neuen Philippe“ nachzuzeichnen, wie sein Unterkiefer mühsam aus seiner Wade („Sekundärtransplantation“) rekonstruiert. wird. Zum anderen geht es für Philippe aber um eine viel tiefergehende Rekonstruktion, nämlich die bereits angedeutete, seelische und geistige Rekonstruktion als neuer Philippe.
Damit die seelische und geistige Rekonstruktion als neuer Philippe gelingt, schreibt er diesen Roman. Literatur hat ihm das Leben gerettet. Um zu verstehen, wie Literatur wirklich Leben retten kann, bringen wir kurz Denis Scheck ins Spiel: In seinem „Vorwort zu einem frivolen Unternehmen“ zu seinem „Kanon“ über die „100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“ berichtet Denis Scheck über ein Gespräch mit Stefan Raab. Raab gilt als sehr belesen, liest keine Belletristik. Raab stellte Scheck die kritische Frage, warum solle er sich denn mit Literatur aufhalten solle und nie begriffen habe, weshalb er sich für erfundene Probleme erfundener Figuren interessieren müsse. Für Scheck gibt es keinen Zweifel daran, dass wir nur lesend die Welt verstehen und uns in ihr zurechtfinden können:
„Im Spiel der Kunst, nicht zuletzt im Gedankenspiel der Literatur entwickeln wir jene Systeme der Wahrnehmung, unserer moralischen Werte und ethischen Orientierung, die es uns erlauben, uns in dieser Welt zurechtzufinden. Nur lesend verstehen wir diese Welt – und fühlen uns sogar gelegentlich von der Welt verstanden“ (Quelle: Denis Scheck 2019: Schecks Kanon. Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur von „Krieg und Frieden“ bis „Tim und Strupi“, München: Piper, Seite 8).
Weit über das Verstehen der Welt hinaus hat die Literatur das Potenzial, Leben zu retten:
„Literatur hat mir das Leben gerettet. Oft. Literatur hat mich beschützt und bewahrt, aber auch ausgesetzt und aus der Passivität ins Leben gestoßen“ (Seite 9).
Literatur und vor allem sein Dialog mit einer riesigen Werkgeschichte hat Philippe nicht das Leben gerettet. Der alte Philippe ist tot. Literatur hat das Leben des neuen Philippe gerettet. Es war eine Rettung durch Verwandlung. Dass dieser Prozess der Verwandlung in den neuen Philippe sehr schwierig war, veranschaulicht er unter anderem mit der Hilfe von Marcel Proust:
„Nichts ist schmerzlicher als dieser Gegensatz zwischen der Verwandlung der Menschen und der Starrheit der Erinnerung, wenn wir begreifen, dass das, was in unserem Gedächtnis so viel Frische bewahrt hat, im Leben keine Frische haben kann“ (Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, zitiert Seite 406).
Für Philippe war die Identitätssuche als neuer Philippe auch deshalb so schwer, weil er die Beständigkeit der Menschen nicht ertragen konnte, die ihn im Krankenhaus besuchten – unter anderem der damalige Staatspräsident François Hollande. Seine Besucher steckten für immer in den Tagen vor dem 7. Januar 2005 fest. Doch diese Zeit gibt es für Philippe nicht mehr. Der neue Philippe lebt weder die verlorene noch die wiedergefundene Zeit; er lebt die unterbrochene Zeit.
Literatur gibt jedem nicht nur das richtige Gefühl, sondern auch die richtige Orientierung: Du bist nicht alleine. Wir sind alle Opfer. Wir sind alle Helden. Jeder führt große Armeen an. Literatur liefert Verständnis. Literatur befriedigt Bedürfnisse. Literatur macht jeden zum Erwachsenen. Jeder ist ein Dichter. Jeder erobert Königreiche. Literatur lässt den Einsamen nicht alleine. Literatur ist Flucht in die Realität. Wir sind alle Verlierer. Wir sind alle Königskinder.
„Karussell der prophetischen oder didaktischen Kommentare“
In jedem Buch gibt es die persönliche Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle ist jene Passage, auf die ich gewartet habe. Jene, in der Philippe über den „Sinn“ des Anschlags nachdenkt, Genauer: Über die Frage der (moralischen) Legitimität von politisch motivierter Gewalt bzw. „Terrorismus“ – diesen Begriff verwendet Philippe sehr sparsam. Es ist die einzige Stelle im ganzen Buch, in der Philippe diese Thema anschneidet:
„Ich las praktisch keine Zeitungen, hatte immer noch kein Fernsehen abonniert, und das Radio langweilte mich wie das in den Tiefen eines Sees brummende Geräusch eines Außenbordmotors. Als ich in einer Wochenzeitschrift, die mir jemand mitgebracht hatte, das Interview mit einem französischen Intellektuellen las, der nicht nur mit der Gewalt liebäugelte, sondern von deren inspirierenden und revolutionären Potenzial sichtlich fasziniert war, bestätigte das meinen Reflex – denn man kann es weder Willen noch Überlegung nennen -, das Karussell der prophetischen oder didaktischen Kommentare zu fliehen. Das Denken hatte etwas Skrupelloses, wenn es dem Ereignis, dem es unterworfen war, einen unmittelbaren Sinn zuschrieb. Die Fliege schwang sich zum Adler auf, nur war das keine Fabel, sondern die Wirklichkeit, die triste Wirklichkeit des intellektuellen Hochmuts: Diese Leute hielten sich für Kant, der Benjamin Constant antwortet, oder für Marx, der den Staatsstreich Louis Napoleons analysiert. Sie abstrahieren vorschnell“ (S. 374).
Einfacher ausgedrückt oder auf den Punkt gebracht: Philippe ruft den Gewaltliebhabern zu: „Ich habe es an meinem eigenen Körper erlebt, ihr Schwätzer. Ihr könnt mich mal!“
Die Lieblingsstelle ist ein wohltuender Abgesang Philippes auf den intellektuellen „Diskurse“ – Intellektuelle führen ja Diskurse und nicht bloß Debatten -, die auch im Sinnlosen, Zerstörerischen, Barbarischen und schier Unglaublichen eine eigene Rationalität erkennen möchten. Natürlich gibt es keine Denkverbote und jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Auch die Rechtfertigung von Gewalt mag eine eigene Meinung sein. Was allerdings zum Himmel stinkt, ist der intellektuelle Hochmut zahlreicher Analysen, die den Horizont der 1970er Jahre, als über die Rote-Armee-Fraktion und das „Recht auf Gegen-Gewalt“ philosophiert wurde, nicht wirklich verlassen haben und immer noch dem revolutionären Traum der „Verdammten dieser Erde“ nachtrauern. Die gleichen Intellektuellen versuchen nun, in die Talkshows zu gelangen, wenn sie versuchen, den „neuen Terrorismus“ zu verstehen.
Liebe Gewaltliebhaber, lasst euch doch mal etwas Neues einfallen!
„Und die Gewalttätigen reißen es an sich“
Die Titelseite von „Charlie Hebdo“ vom 7. Januar 2015 thematisierte den am gleichen Tag erschienenen Roman „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq. In der Redaktionskonferenz am Morgen des 7. Januar 2015 war „Unterwerfung“ dementsprechend das zentrale Streitthema. Philippe erinnert sich, wie er und sein Freund Bernard die Einzigen waren, die das Buch verteidigten: „Fast alle schwiegen oder attackierten es“ (Seite 67).
Es dauert bis zum Ende des Romans, als Philippe auf Houellebecq trifft. Philippe war seinem Gesprächsthema vom 7. Januar 2015 noch nie begegnet. Philippe beschreibt Houellebecq als „zerstörte, mineralische und mitfühlende“ Erscheinung. Als jemand, der aussieht, mit alters- und geschlechtslosem Gesicht, wie jemand, der „die Verzweiflung der Welt auf sich nahm“. Houellebecq wechselte mit Philippe ein paar unverständliche Wörter und zitierte dann die Bibel:
„Und die Gewalttätigen reißen es an sich“ (Seite 540).
Warum verwendet Houellebecq, der Mann mit alters- und geschlechtslosem Gesicht, diesen Vers aus dem Matthäus-Evangelium, wenn er Philippe Lançon, dem Mann mit unterkieferlosen Gesicht, begegnet?
Machen wir einen kleinen „theologischen Ausflug“, der auch für den Nicht-Gläubigen aufschlussreich sein könnte: Ich interpretiere diese Aussage von Houellebecq als ein großes Lob an Philippe – aber zugleich als eine versteckte, unheimliche Warnung. Um diese Interpretation zu belegen, schauen wir uns den kompletten Vers an, denn Houellebecq hat nur die zweite Hälfte des Verses zitiert:
„Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn, und Menschen versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reißen“ (Neue Genfer Übersetzung).
Kein anderer Prophet wird von Jesus so sehr gelobt wie Johannes der Täufer: „Unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes der Täufer“ – so lautet es im Vers unmittelbar vor dem „Houellebecq-Vers“. Johannes der Täufer war der Vorläufer des Messias. Seine Predigten an das Volk unterschieden sich fundamental von den Predigten der Pharisäern und Schriftgelehrten. Doch das einfache Volk mochte ihn, wollte Buße tun und sich von ihm taufen lassen. Das gefiel den stolzen und hochmütigen Pharisäern und Schriftgelehrten nicht. Er wurde für seinen aufrichtigen Glauben ins Gefängnis gesteckt und hingerichtet: durch Enthauptung.
Houellebecq vergleicht damit Philippe mit dem Vorläufer des Messias. Offensichtlich ein großes Lob. Er war der Lieblingsprophet von Jesus. Doch er wurde enthauptet. Philippe wurde zwar nicht enthauptet, aber ein Drittel seines Gesichts wurde weggefetzt. Was kann also noch Schlimmeres für Philippe kommen? Hoffentlich wird Philippe nie mehr Gewalt angetan.
Fazit: schwere Kost, aber es lohnt sich
Darf man das Buch eines Mannes kritisieren, dem ein Drittel des Gesichts weggefetzt wurde?
Durch die Lektüre des Buches lernt man Philippe kennen. Und wenn man sich darauf einlässt, ihn wirklich kennenzulernen, dann kann man behaupten, dass der neue Philippe sich über diese Frage ärgern würde. Vielleicht aber auch eher über sich selbst, weil die Lektüre seines Buches den Leser emotional dazu bringt, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Philippe ist Literaturkritiker und wahrscheinlich würde er einen Roman wie „Der Fetzen“, wenn er nicht von ihm selbst geschrieben worden wäre, heftig kritisieren. Literaturkritik kann oder sollte zwar ausreichende Sensibilität haben, sollte jedoch nicht ins Sentimentale verfallen.
In diesem Sinne wagen wir uns mutig an eine ketzerische Frage: Ist „Der Fetzen“ wirklich ein Roman?
Julia Encke bezeichnete den „Fetzen“ in einer Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (19.03.2019) als ein Buch „das kein Roman und doch ergreifender, dichter und literarischer ist als so viele der neuen Romane dieses Frühjahrs.“ In der Tat besteht die literarische Qualität des „Fetzens“ besteht nicht zuletzt darin, dass man Jahre brauchen würde, um die ganze Literatur und Werke aufzuarbeiten, die er in seinem Roman zitiert: Franz Kafka, Thomas Mann, Baudelaire, Marcel Proust, Honoré de Balzac usw. Vielleicht bewirkt der reiche Schatz an Literatur, der im „Fetzen“ steckt“ auch Ärger beim Leser: Wie viele der in „Der Fetzen“ zitierten Werke stehen schon lange ungelesen im eigenen Bücherregal?
An der Universität hat mal ein Dozent im Fachbereich Politikwissenschaft einen Satz geprägt, der bei mir hängen geblieben ist: „Lesen Sie Karl Marx, Max Weber und Sigmund Freud. Das reicht aus, um die nächsten 15 Jahre lang nur noch Déjà-vu-Erlebnisse zu haben.“ Und genau dieses Gefühl hatte ich bei der Lektüre von Philippes „Roman“ nicht.
Reicht das als Grund aus, ihn zur Lektüre zu empfehlen?
Die Antwort ist ein klares „Ja“.
Genre: Erzählung, RomanIllustrated by Tropen
 Desavouierendes Hohngelächter
Desavouierendes Hohngelächter Bilanz eines verbiesterten Dichterlebens
Bilanz eines verbiesterten Dichterlebens
 Es ist, wie es ist
Es ist, wie es ist
 Literarisch eine Offenbarung
Literarisch eine Offenbarung Biografie in zwei konträren Zeitreisen
Biografie in zwei konträren Zeitreisen Wenn lesen glücklich macht
Wenn lesen glücklich macht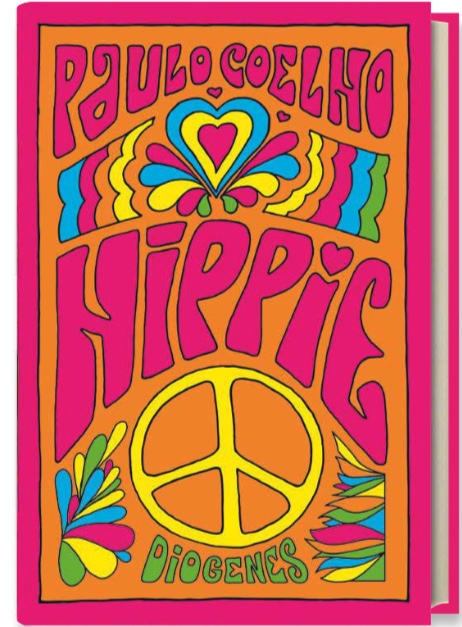
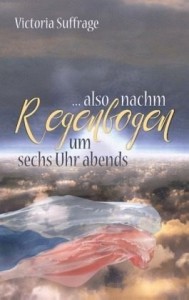 Victoria Suffrage legt mit „also nachm Regenbogen um sechs Uhr abends“ eine ungewöhnlich eindringliche und einfühlsame Erzählung über Abschiednehmen, Altwerden, Vergehen und Vergessen vor, die als Kammerspiel beginnt und als Roadmovie endet.
Victoria Suffrage legt mit „also nachm Regenbogen um sechs Uhr abends“ eine ungewöhnlich eindringliche und einfühlsame Erzählung über Abschiednehmen, Altwerden, Vergehen und Vergessen vor, die als Kammerspiel beginnt und als Roadmovie endet. Peregrina
Peregrina