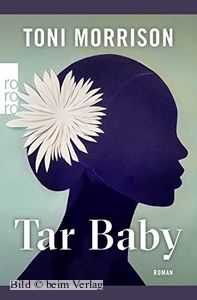 Auf der Suche nach Identität
Auf der Suche nach Identität
Der vierte Roman der amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison mit dem Titel «Tar Baby» ist in der aktuellen deutschen Ausgabe mit einem Vorwort der Autorin ergänzt worden. Darin schildert die erste farbige Nobelpreisträgerin die familiären Umstände, die sie dazu gebracht hätten, dieses Buch zu schreiben. Auslöser war demnach eine uralte Geschichte aus Afrika von einer Puppe aus Teer, die den Gruß eines Kaninchens nicht erwidert hat. Als das Kaninchen die Puppe wütend tritt, bleibt es an dem klebrigen Teer hängen und kann sich nicht mehr davon befreien. Dieses Teerbaby ist für die Autorin das Sinnbild einer toughen, schwarzen Frau, die sich nicht unterkriegen lässt, wie sie im Interview erklärt hat.
Im ersten von zehn Kapiteln wird die Geschichte einer abenteuerlichen Flucht erzählt, die einen farbigen Seemann auf eine abgelegene Karibikinsel verschlägt. Son ist von einem vorbeifahrenden Schiff gesprungen und wäre beim Schwimmen an Land beinahe ertrunken. Unterschlupf findet er in einem einsam gelegenen Haus, in das er sich nachts einschleicht. Wobei er beinahe erwischt worden wäre, er konnte sich gerade noch in die Kleiderkammer der Hausherrin retten. Der mehr als siebzigjährige Valerian Street hat vor Jahren seine Bonbonfabrik in Amerika verkauft und sich mit Margaret, seiner deutlich jüngeren Frau, in ein großes, feudales Landhaus zurückgezogen, sein karibisches Refugium. Betreut wird das weiße Ehepaar von dem farbigen Butler Sydney und dessen Frau, die als Köchin fungiert. Als die Hausherrin überraschend auf Son stößt und schreiend um Hilfe ruft, will Sydney den Eindringling auf der Stelle erschießen, wird in letzter Sekunde aber vom Hausherrn daran gehindert. Der lädt den Farbigen vielmehr zu einem Drink ein und bietet ihm schließlich sogar großzügig auch noch Unterkunft an.
Im Haus wohnt besuchsweise seit einigen Monaten auch Jadine, die 25jährige, ebenfalls farbige Nichte des Butler-Ehepaares. Sie wurde nach der Schule vom Hausherrn gefördert, er hat ihr ein Studium als Kunsthistorikerin in Paris finanziert, das sie inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat. In Paris wurde die äußerst attraktive junge Frau als farbiges Model entdeckt und hat sich deshalb entschlossen, zunächst nicht als Dozentin an der Universität zu bleiben. Sie ist stattdessen nach New York gegangen, um dort als gut bezahltes Model zu arbeiten. Nach anfänglichem Streit kommen sie und der Eindringling Son sich schnell näher und haben bald schon rauschhaften Sex miteinander. Er erzählt ihr schließlich sogar den kriminell bedingten Grund für seine Flucht aus den USA. Es ist kurz vor Weinachten, der erwachsene Sohn der Streets wird sehnsüchtig erwartet. Wegen widriger Wetterverhältnisse sind aber kurzfristig alle Flüge gestrichen worden, und auch andere Gäste müssen absagen. So sitzen schließlich nur die Streets, das Butlerehepaar sowie Jadine und Son beim Festschmaus am Esstisch zusammen, wo der traditionelle Truthahn aber ausnahmsweise diesmal durch eine Gans ersetzt ist. Es kommt zum Eklat, als gesprächsweise durch die Köchin, die für den einzigen Sohn wie eine zweite Mutter war, angedeutet wird, dass Mrs. Street ihn als Baby und Kleinkind mit Nadeln gestochen und ihm sogar Brandwunden zugefügt hat. Überstürzt reisen Jadine und Son nach New York ab.
In Person der auf einem derart speziellen Gebiet wie der Mode erfolgreichen, schwarzen Protagonistin kumulieren die unterschwellig vorhandenen, rassistischen Töne, die der Plot thematisiert und der Buchtitel symbolisiert. Sie fühlt sich von den konventionellen Vorstellungen und sozialen Bedingtheiten anderer farbiger Frauen bedrängt. Und auch die heiße Affäre mit Son scheitert schließlich an derartigen rassisch geprägten, konträren Lebens-Einstellungen und -Bedingungen. Nicht nur die Farbigen in diesem Roman befinden sich auf der Suche nach ihrer Identität, alle müssen sich letztendlich fragen, ob sie denn wirklich authentisch handeln. Stilistisch überzeugend ist die poetische Sprache der Autorin, mit der sie – auch in kontemplativen Dialogen – starke Bilder erzeugt beim Lesen ihrer extrem breit angelegten, interessanten Rassismus-Story.
Fazit: erfreulich
Meine Website: https://ortaia-forum.de
 Magerer Plot und stilistisches Können
Magerer Plot und stilistisches Können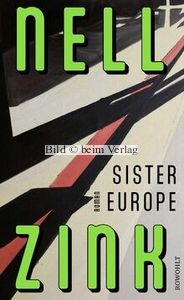 Parodie auf den Literaturbetrieb
Parodie auf den Literaturbetrieb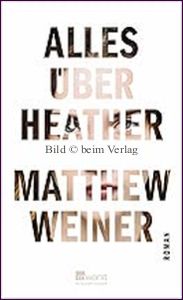 Eine unerhörte Begebenheit
Eine unerhörte Begebenheit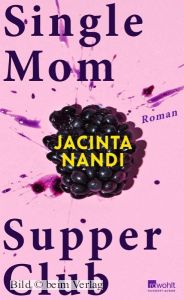

 Im Klappentext steht die Frage: “Arbeitest Du noch, oder erbst Du schon?“ Und im Text dann die Aufforderung, sich die Eltern gut auszusuchen; zu wessen Narrativ passt das? Darum geht es hier, wenn die Geschichte der Erbschaftssteuer im letzten Jahrhundert bearbeitet wird. Wer erbt unter den derzeitigen Bedingungen am wenigsten: da sind Frauen, Ost-Deutsche, als Folge der Arbeit der Treuhand, die (treuhänderisch) nur 5% der Betriebe in die Hände Ost-Deutscher legte. Und wie wird das begründet?
Im Klappentext steht die Frage: “Arbeitest Du noch, oder erbst Du schon?“ Und im Text dann die Aufforderung, sich die Eltern gut auszusuchen; zu wessen Narrativ passt das? Darum geht es hier, wenn die Geschichte der Erbschaftssteuer im letzten Jahrhundert bearbeitet wird. Wer erbt unter den derzeitigen Bedingungen am wenigsten: da sind Frauen, Ost-Deutsche, als Folge der Arbeit der Treuhand, die (treuhänderisch) nur 5% der Betriebe in die Hände Ost-Deutscher legte. Und wie wird das begründet?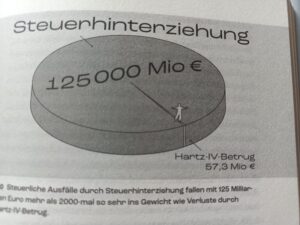 Erst wird in einer „kurzen“ Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer, das RAN, das Repertoire an Narrativen beschrieben, und das während der verschiedenen Phasen der Wirtschaftsdoktrinen: der Keynesianer, Ordoliberalen und Neoliberalen. Es zeigt sich, wie die Pro- bzw. Contranarrative wechseln, entsprechend der jeweils gängigen Doktrin.
Erst wird in einer „kurzen“ Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer, das RAN, das Repertoire an Narrativen beschrieben, und das während der verschiedenen Phasen der Wirtschaftsdoktrinen: der Keynesianer, Ordoliberalen und Neoliberalen. Es zeigt sich, wie die Pro- bzw. Contranarrative wechseln, entsprechend der jeweils gängigen Doktrin.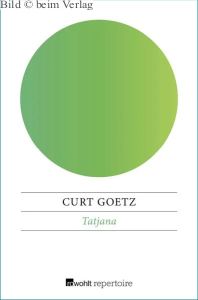
 Konfuse innere Monologe
Konfuse innere Monologe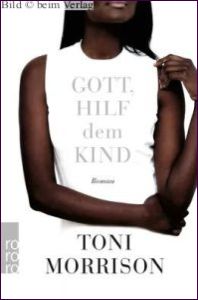 Überambitioniert und thematisch überfrachtet
Überambitioniert und thematisch überfrachtet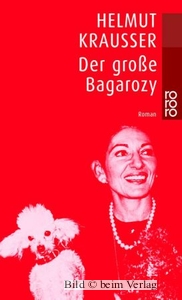
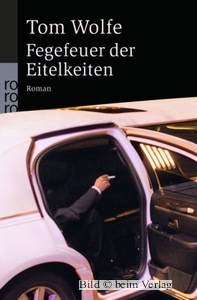 Am Ende gibt es fast nur Verlierer
Am Ende gibt es fast nur Verlierer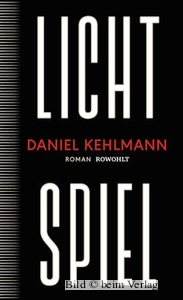 Wenig nachhaltiges Biopic
Wenig nachhaltiges Biopic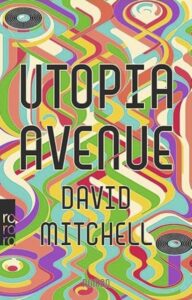 Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.
Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.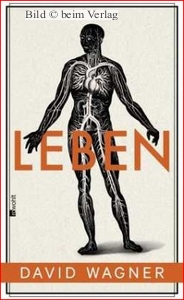
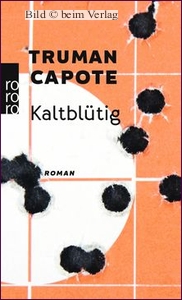 Ohne den genre-typischen Horror
Ohne den genre-typischen Horror