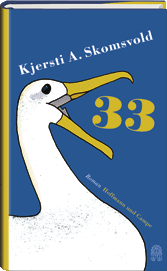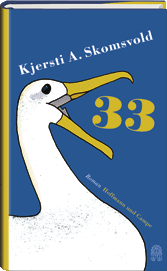Eine ungewöhnliche Thematik
Eine ungewöhnliche Thematik
Der Debütroman der französischen Schriftstellerin Hélène Grémillon befasst sich mit der literarisch seltenen Thematik einer Leihmutterschaft. Er wurde in 19 weitere Sprachen übersetzt und hat trotz seines irreführenden deutschen Titels «Das geheime Prinzip der Liebe» auch hierzulande einen Hype ausgelöst. Erstaunlich, denn es handelt sich eben nicht um einen der auflagenstarken, typisch kitschigen Liebesromane. Ganz im Gegenteil, mit seiner eher ungewöhnlichen Thematik verbinden sich vielmehr komplizierte, vielschichtige psychologische Aspekte, als da sind: Die herzliche Freundschaft zweier ungleicher Frauen, die Liebe zwischen Mann und Frau als schier unerschöpfliches Thema, ferner Eifersucht, aber auch zerstörerisches Misstrauen und letztendlich Hass, der zuletzt düstere Rachegefühle auslöst. Le Confident, so der Originaltitel, bedeutet wörtlich ‹Der Vertraute› oder Mitwisser, und genau darum geht es auch in diesem Roman. Die streng geheim gehaltene Leihmutterschaft mündet hier in einen erbitterten Krieg der beiden beteiligten Frauen um das Kind, das auf diesem unkonventionellen Wege entstanden ist.
Der Roman beginnt mit dem vorangestellten Hinweis ‹Paris 1975›: «Eines Tages bekam ich einen Brief. Einen langen Brief ohne Unterschrift.» Die 35jährige Verlegerin Camille findet unter den Beileidsbriefen zum Tode ihrer Mutter Annie einen längeren Text, der sich mit der einstigen Leihmutterschaft ihrer verstorbenen Mutter beschäftigt und mit Louis unterschieben ist. Immer mehr solcher Briefe folgen, sie rätselt, wer der Briefschreiber ist und warum er ihr schreibt. Es geht in diesen Briefen um die junge Malerin Annie, die vor dem Zweiten Weltkrieg aus der Champagne nach Paris gekommen ist, um dort Malerei zu studieren, und die in der zehn Jahre älteren Madame M eine wohlhabende Gönnerin findet. Die schenkt ihr nicht nur immer wieder neue Materialien für ihre Kunst, sondern stellt ihr auch einen Raum in ihrer großzügigen Wohnung als Atelier zur Verfügung und engagiert einen bekannten Künstler als Lehrer für sie. Als Madame M ihr in einem vertraulich en Gespräch ihre Verzweiflung darüber gesteht, dass sie offensichtlich keine Kinder bekommen kann, macht Annie ihr spontan das Angebot, für sie als Leihmutter ein Kind auszutragen. Auch der überraschte Ehemann ist schließlich bereit, seiner Frau auf diesem ziemlich ungewöhnlichen Wege ihren sehnlichen Kinderwunsch zu erfüllen.
Mit «Die Ahnung» ist ein diesem Roman stimmig vorangestelltes Zitat von Frederico Garcia Lorca übertitelt, und tatsächlich ahnt man als Leser im Verlauf der Geschichte sehr schnell, dass die hoffnungsvoll arrangierte, streng geheime Leihmutterschaft wahrscheinlich kläglich scheitern wird. Als Annie schließlich schwanger ist, zieht Madame M mit ihr in ihr einsam gelegenes Ferienhaus und verbirgt sie dort vor allen Leuten. Sie selbst aber beginnt, demonstrativ eine eigene Schwangerschaft vorzutäuschen, und als das Kind von Annie als Hausgeburt ohne Hilfe heimlich auf die Welt kommt, gibt Madame M beim Standesamt das Baby als ihr eigenes Kind aus, – und niemand durchschaut den Schwindel!
Erzählt wird all das und die darauf folgenden, erbitterten Kämpfe um das Kind in einem örtlich und zeitlich vielfach verschachtelten Plot aus ganz verschiedenen Perspektiven. In denen werden die diametral entgegenstehenden Vorstellungen und Ansprüche der einstigen engen Freundinnen an die Mutterschaft in aller Schärfe ausgetragen. Es ist seine extreme stilistische Verschachtelung, die diesen Roman als Lektüre überaus schwierig macht. Nach und nach legt die Autorin in ihrem puzzleartigen Plot ein Handlungs-Teilchen an das andere und schließt so die vielen Leerstellen ihrer Geschichte, die dem Leser dann allmählich verständlicher werden. Um auch jeden Zweifel zu zerstreuen, dass ihr Roman wirklich keine Herz-Schmerz-Liebes-Geschichte ist, lässt die Autorin ihn ganz unversöhnlich in einem harten, tragischen Ende ausklingen, mit dem man so nicht gerechnet hat als Leser.
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de


 Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau
Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau

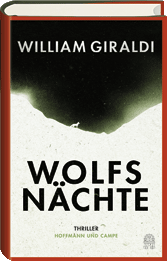
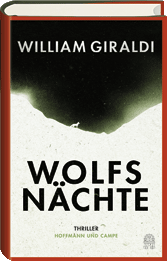 Die Winter sind unbarmherzig in Alaska. In einem dieser unerbittlichen Winter ist es so kalt, dass die Wölfe sich aus den Wäldern wagen und die Kinder aus den Dörfern holen, um ihren Hunger zu stillen. Die Stimmen der Trauernden heulen mit den Wölfen und den Winden um die Wette. Die Menschen haben keine Möglichkeit, das zurückzufordern, was die Natur grausam als ihr Recht entschieden hat. Doch haben die Wölfe auch den sechsjährigen Bailey Slone aus dem gottverlassenen Dorf Keelut auf dem Gewissen?
Die Winter sind unbarmherzig in Alaska. In einem dieser unerbittlichen Winter ist es so kalt, dass die Wölfe sich aus den Wäldern wagen und die Kinder aus den Dörfern holen, um ihren Hunger zu stillen. Die Stimmen der Trauernden heulen mit den Wölfen und den Winden um die Wette. Die Menschen haben keine Möglichkeit, das zurückzufordern, was die Natur grausam als ihr Recht entschieden hat. Doch haben die Wölfe auch den sechsjährigen Bailey Slone aus dem gottverlassenen Dorf Keelut auf dem Gewissen?