 Eigentum. “Bist bes auf mi, Mutti?” Neu erschienen als Taschenbuch ist auch der (vor-)letzte Roman des Sprachkünstlers Wolf Haas. Der Erfinder der “Brenner”-Krimireihe fischt dieses Mal in ganz anderen Gewässern. Genauer gesagt in fremden “Lechn“, hochdeutsch: Lehen. Denn immer strebt der Mensch nach Besitz, nach Eigentum und selbst wenn es dann nur 1,7 m2 werden, ist zumindest etwas zum Vererben da.
Eigentum. “Bist bes auf mi, Mutti?” Neu erschienen als Taschenbuch ist auch der (vor-)letzte Roman des Sprachkünstlers Wolf Haas. Der Erfinder der “Brenner”-Krimireihe fischt dieses Mal in ganz anderen Gewässern. Genauer gesagt in fremden “Lechn“, hochdeutsch: Lehen. Denn immer strebt der Mensch nach Besitz, nach Eigentum und selbst wenn es dann nur 1,7 m2 werden, ist zumindest etwas zum Vererben da.
Lehen und Leute
Teilweise im Dialekt seiner Mutter (der Autor ist in Maria Alm am Steinernen Meer geboren) verfasst, dann wieder umgangssprachlich, österreichisch, sogar hochdeutsch bereitet Wolf Haas Leserinnen und Lesern wieder eine ganz besondere Lektüre. Zwei Tage vor dem Tod seiner Mutter, will er noch das Wichtigste aufschreiben, aber was ist angesichts des Todes noch wichtig? Der Autor tut es in gebohnert Manier: mit viel Humor und witzigen Wendungen, Sprachakrobatik und viel Kunstfertigkeit. “Ich will das hinschreiben, solange sie noch lebt, danach möchte ich mich nicht mehr damit beschäftigen“, schreibt er, “(…)dann machte ich diese verdammten Geschichten auch endlich begraben, was geht es mich an, dass ein Mensch, den ich gekannt habe, sein kleines Lechn immer wieder gegen ein größeres Lehn getauscht hat.” Die ironische Verkürzung des Lebens seiner Verwandten am Land auf “Geschichten” ist natürlich nur eine Schmerzvermeidungsstrategie. Aber anders als der eingangs zitierte Liedtext vermuten lässt, war seine Mutter gar nicht böse und schon gar nicht böse auf ihn, den Wolf. Sie war böse auf die Leute. “La gente“, wie der Sohnemann beflissen hinzufügt. Denn eigentlich hätte sie sich gar nicht vor denen jahrzehntelang verstecken müssen. Im Dorf war ohnehin nur mehr am Friedhof was los. Dort begleitet er sie nun hin und verabschiedet sich von ihr.
“Lass weg, Haas!“
Seine Mutter hatte viele Jobs, als Servierkraft zum Beispiel. Oder bei der Briefzensur während des Krieges. Dann hat sie nach dem Krieg auch in der Schweiz gearbeitet. Acht Jahre. Aber das Geld, das sie nach Hause schickte wurde in ein Haus investiert, das sie dann nicht mehr bewohnen durfte. Ihr Vater starb 1956, der älteste Sohn 1957. Als sie Jahrzehnte später von der Raika aus ihrem Haus vertrieben wird, mit 89 Jahren, wird das Haus aber gar nicht abgerissen, sondern in ein Hotel integriert. Die geplante Poetikvorlesung muss der Autor dann aber doch absagen, als seine Mutter wirklich stirbt, in dem Haus, in dem sie ihre Kinder geboren hatte. Haas findet nur lakonische Worte, als er am Friedhof ein Grab für sie bestellt. “Unsere Mutter, die ihr Leben lang auf den ersten Quadratmeter hingespart hatte, sollte ihr schlussendlich 1,7 Quadratmeter angewachsenes Grundstück voll ausnützen. Die 1,7 Quadratmeter in bester Lage stand ihr zu, platzsparende Konzepte sollten andere umsetzten.” Nachdem sie ihren Traum, ein eigenes Grundstück zu erwerben, nicht verwirklichen konnte, hatte etwas von ihr Besitz ergriffen, schreibt ihr Sohn: “Niedergeschlagenheit“. Sie besaß nichts, aber sie war ein bißchen besessen, meint er, denn sie konnte eigentlich alles, nur nicht mit den Leuten. La gente. Die Hochzeiten und Taufen werden weniger und man sieht die Verwandtschaft schließlich nur mehr bei Begräbnissen, moniert der Sohn, das Gemeinsame der drei Ereignisse seien selbstverständlich die Tränen.
Wolf Haas
Eigentum
2025, Taschenbuch, Klappenbroschur, 160 Seiten, 12,5×18,7cm
ISBN: 978-3-328-11156-6
Pinguin Verlag
€ 14,00

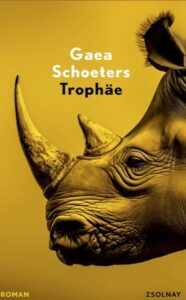
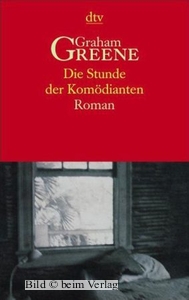 Wohl kaum nobelpreisfähig
Wohl kaum nobelpreisfähig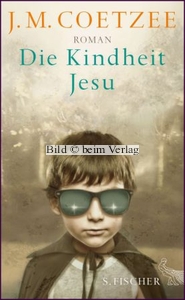 Vom Circulus vitiosus des Begehrens
Vom Circulus vitiosus des Begehrens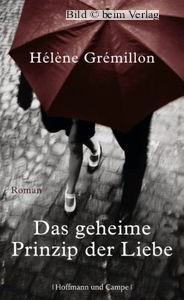 Eine ungewöhnliche Thematik
Eine ungewöhnliche Thematik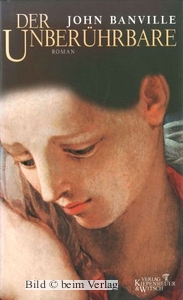 Sprachgewaltiger Nicht-Thriller
Sprachgewaltiger Nicht-Thriller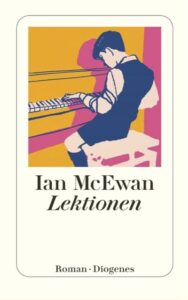
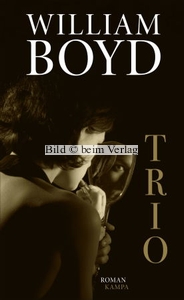 Drei Romane in einem
Drei Romane in einem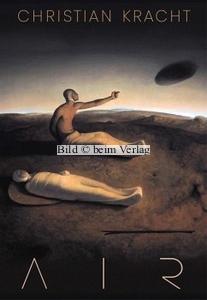 Nur der narrativen Ästhetik verpflichtet
Nur der narrativen Ästhetik verpflichtet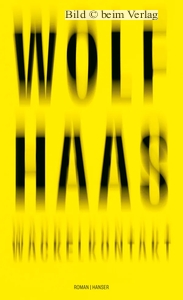
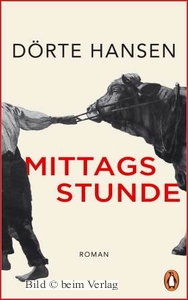 Flurbereinigung auf den Mädchenköpfen
Flurbereinigung auf den Mädchenköpfen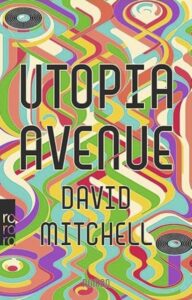 Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.
Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.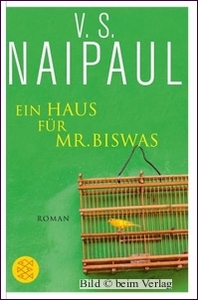 Lesespaß aus kontrapunktischer Ironie
Lesespaß aus kontrapunktischer Ironie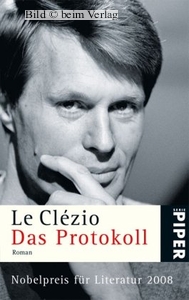
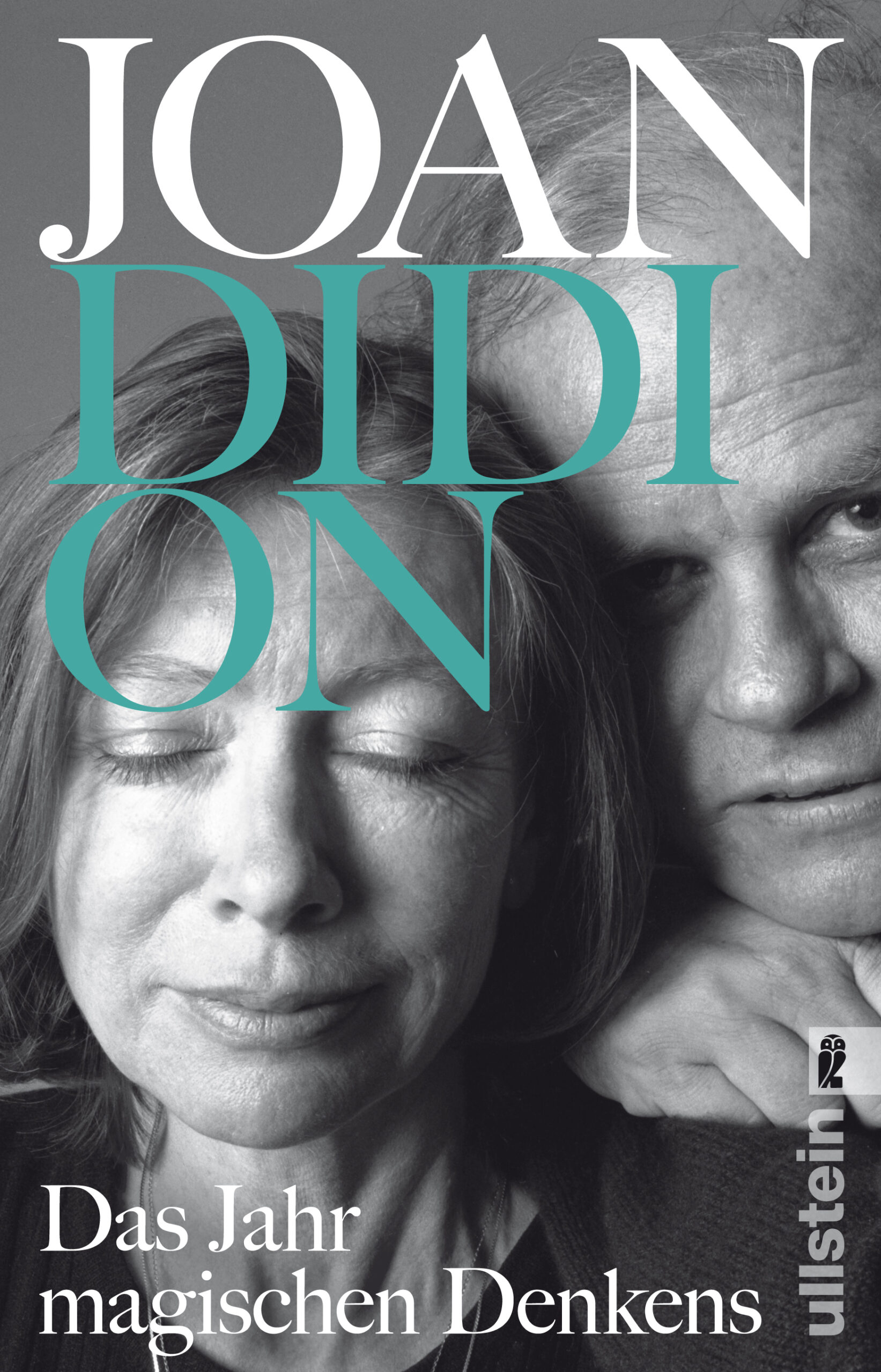
 Joan Didion’s Verlust und Trauer. Die amerikanische Journalistin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin widmet sich in zwei Romanen ihres Spätwerks den Themen Verlust und Trauer auf eine unnachahmliche, ganz feinsinnige Art und Weise. Während ihre Tochter Quintana auf der Intensivstation liegt, verstirbt ihr Ehemann, der Schriftsteller John Gregory Dunne, an einer Herzerkrankung. Ein doppelter Verlust, der von Normalsterblichen nicht zu bewältigen ist. Von Schriftstellern vielleicht durch das Schreiben.
Joan Didion’s Verlust und Trauer. Die amerikanische Journalistin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin widmet sich in zwei Romanen ihres Spätwerks den Themen Verlust und Trauer auf eine unnachahmliche, ganz feinsinnige Art und Weise. Während ihre Tochter Quintana auf der Intensivstation liegt, verstirbt ihr Ehemann, der Schriftsteller John Gregory Dunne, an einer Herzerkrankung. Ein doppelter Verlust, der von Normalsterblichen nicht zu bewältigen ist. Von Schriftstellern vielleicht durch das Schreiben.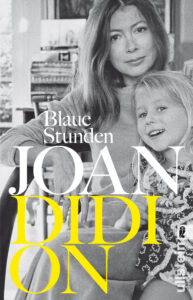 „In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne, nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert (und das wird sie, sie endet), erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit: das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei.“ Das Ende des Versprechens, das Joan Didion hier so poetisch anspricht, bezieht sich auf die kürzer werdenden Tage, aber natürlich auch das kürzer werdende Leben, das allzu schnell an einem vorbeifliegt wie ein nichts. Erst erzählt sie von ihrem Haus in Brentwood Park, Kalifornien, wo die geborene New Yorkerin mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnte, bevor sie nach rund 20 Jahren (1988) nach New York rückübersiedelte.
„In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne, nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert (und das wird sie, sie endet), erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit: das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei.“ Das Ende des Versprechens, das Joan Didion hier so poetisch anspricht, bezieht sich auf die kürzer werdenden Tage, aber natürlich auch das kürzer werdende Leben, das allzu schnell an einem vorbeifliegt wie ein nichts. Erst erzählt sie von ihrem Haus in Brentwood Park, Kalifornien, wo die geborene New Yorkerin mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnte, bevor sie nach rund 20 Jahren (1988) nach New York rückübersiedelte.