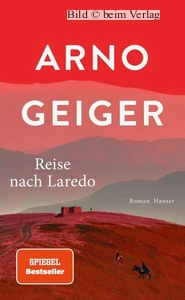
Schade eigentlich
In seinem neuen Buch «Reise nach Laredo» hat Arno Geiger die beiden Genres historischer Roman und eskapistischer Roadtrip trickreich miteinander verbunden. Sein Protagonist ist der sterbenskranke Kaiser Karl V, der sich nach seiner Abdankung 1556 in seinen Palast neben dem Kloster Yuste in Spanien zurückgezogen hat. Zwei Jahre später, in der letzten Nacht vor seinem Tod, träumt er von einer Reise ans Meer, die den Hauptteil dieser Erzählung von der späten Selbstfindung eines Menschen bildet. Er war in den 58 Jahren seines Lebens wie in einer Blase eingebunden in eine völlig abgehobene, höfische Gesellschaft fernab vom realen Leben.
Schon die erste Szene zeigt den alten Kaiser nackt, als ein Mensch wie jeder andere auch. Der übergewichtige, kaum noch gehfähige und von opiumhaltigem Laudanum abhängige alte Mann wird mit einer speziellen Vorrichtung in einen Zuber mit warmem Wasser gehoben, um sich darin reinigen zu können, bevor er zu Bett geht. In der folgenden Nacht träumt Karl, wie er einen Jungen aus dem Garten zu sich heranwinkt und mit ihm ein Gespräch beginnt. Der aufgeweckte Elfjährige ist sein illegitimer Sohn, der als Page zum Palast gehört, aber natürlich nicht weiß, dass der abgedankte Kaiser sein Vater ist. Karl fordert ihn auf, um Mitternacht mit zwei gesattelten Pferden an der Klosterpforte auf ihn zu warten, sie würden sich beide heimlich auf eine weite Reise begeben, – Geronimo ist hellauf begeistert. Auf der beschwerlichen Flucht begegnet Karl allerlei Menschen, er durchlebt schwierige Situationen und Entbehrungen und zahlt einen hohen Tribut für seinen Drang nach Freiheit, ohne es aber jemals zu bedauern oder gar an Umkehr zu denken.
Zu einer kritischen Situation kommt es, als sie einer Gruppe von Ganoven begegnen, die ein junges Geschwisterpaar von Cagots in ihrer Gewalt haben, also Angehörigen einer rechtlosen Minderheit, die sich durch einen Gänsefuß aus rotem Stoff an der Kleidung kennzeichnen musste. Das Mädchen kommt ihnen nackt und laut schreiend entgegengelaufen, der ältere Bruder ist an seinen Wagen gebunden und wird bestialisch ausgepeitscht. Karl geht dazwischen, zieht schließlich sogar seine Pistole. Ungewollt löst sich ein Schuss, und einer der Männer hat plötzlich ein Loch im Hut, – woraufhin die brutalen Kerle eiligst Reißaus nehmen. Eine alte Bäuerin nimmt sich des geschundenen jungen Cagots an und pflegt ihn mit verschiedenen Kräutern gesund. Zu viert ziehen sie anschließend gemeinsam weiter und landen schließlich in der Toten Stadt, wo ehemals Silber abgebaut wurde. Dort bleiben sie für längere Zeit in einem Wirtshaus, Karl beginnt zu trinken und wird von dem heimtückischen Wirt beim Kartenspiel ausgenommen, bis er schließlich pleite ist. Verzückt entdeckt Geronimo im Hof der Wirtschaft einen Greif, den er als Symbol der Freiheit bisher nur als Motiv in einem Wandteppich des Palastes kennt. Nach heftigem Streit mit dem Wirt, in dem auch der Greif eine Rolle spielt, ziehen Karl und Geronimo weiter und landen schließlich am Atlantik, in dessen Wellen der Traum endet.
Vor allem gehe es ihm, hat der Autor im Interview erklärt, um Karl als Mensch, als «Privatmann», der in seinem privilegierten Leben niemals auf das nackte Menschsein zurückgeworfen war, er ist «ein Versehrter», fügte er hinzu. Wie reagiert einer, der Krone, Macht und Ruhm hinter sich gelassen hat und Freundschaft, Liebe und Freiheit erstmals erlebte? Und der erfährt, wie hart und entbehrungsreich dieses einfache Leben wirklich ist. Dabei hilft thematisch die Figur des lebensfrohen Geronimo als unbescherter Gegenpart zum eingeengten, angepassten höfischen Dasein, wie es Karl immer nur erlebt hat. Was die philosophischen «Weisheiten» anbelangt, mit denen der trübsinnig machende Roman zahlreich aufwartet, erweisen sie sich meist als belanglose Plattitüden. Den Leser erwartet letztendlich ein stilistisch anspruchslos erzählter, langweiliger Plot ohne Erkenntnisgewinn. Schade eigentlich!
Fazit: mäßig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
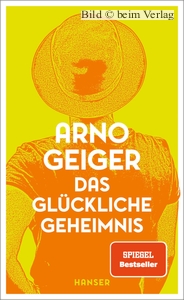 Altpapier, Sex und Poetik
Altpapier, Sex und Poetik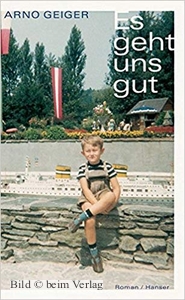 Funkelnde Diskurse
Funkelnde Diskurse Zwischen Hoffnung und Horror
Zwischen Hoffnung und Horror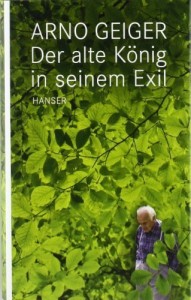 Die ersten Alzheimer-Symptome können durchaus noch alltäglich sein, vorübergehender Verlust von Gedächtnis und Orientierung, aufkeimende Schrulligkeiten. Es dauert seine Zeit, bis die sichere Diagnose vorliegt und man endlich aufhört, mit der Person zu schimpfen und eigentlich die Krankheit zu meinen. Über das was dann kommt hat der österreichische Schriftsteller Arno Geiger ein sehr persönliches Buch geschrieben. Es erzählt über die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters, darüber, wie einem geliebten Menschen, für den er immer noch viel an kindlichem Aufblick übrig hat, das geistige Navigationssystem abhanden kommt. Das Buch beginnt mit Szenen aus dem ganz alltäglichen und doch nie wieder alltäglich werdenden Umgang der beiden miteinander. Es sind Momentaufnahmen einer wegziehenden Vernunft. „Früher hatte ich auch Katzen“ entfährt es dem Vater beim Anblick einer Katze „nicht gerade für mich alleine, aber als Teilhaber“. „ Es geschehen keine Wunder aber Zeichen. Ohne Probleme ist das Leben auch nicht leichter“, lautet die Antwort auf die Frage seines Sohnes, wie es ihm geht. Solche und andere, immerhin im mittleren Stadium getane Äußerungen geraten zu Kartengrüßen aus einer ganz neuen Welt. Es ist eine Welt in der die Grundgesetze der Sachlichkeit und Zielstrebigkeit nicht mehr gelten, in der es dem Vater aber dennoch gelingt, sich über längere Zeit mit bewundernswerter Leichtigkeit zu behaupten.
Die ersten Alzheimer-Symptome können durchaus noch alltäglich sein, vorübergehender Verlust von Gedächtnis und Orientierung, aufkeimende Schrulligkeiten. Es dauert seine Zeit, bis die sichere Diagnose vorliegt und man endlich aufhört, mit der Person zu schimpfen und eigentlich die Krankheit zu meinen. Über das was dann kommt hat der österreichische Schriftsteller Arno Geiger ein sehr persönliches Buch geschrieben. Es erzählt über die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters, darüber, wie einem geliebten Menschen, für den er immer noch viel an kindlichem Aufblick übrig hat, das geistige Navigationssystem abhanden kommt. Das Buch beginnt mit Szenen aus dem ganz alltäglichen und doch nie wieder alltäglich werdenden Umgang der beiden miteinander. Es sind Momentaufnahmen einer wegziehenden Vernunft. „Früher hatte ich auch Katzen“ entfährt es dem Vater beim Anblick einer Katze „nicht gerade für mich alleine, aber als Teilhaber“. „ Es geschehen keine Wunder aber Zeichen. Ohne Probleme ist das Leben auch nicht leichter“, lautet die Antwort auf die Frage seines Sohnes, wie es ihm geht. Solche und andere, immerhin im mittleren Stadium getane Äußerungen geraten zu Kartengrüßen aus einer ganz neuen Welt. Es ist eine Welt in der die Grundgesetze der Sachlichkeit und Zielstrebigkeit nicht mehr gelten, in der es dem Vater aber dennoch gelingt, sich über längere Zeit mit bewundernswerter Leichtigkeit zu behaupten.