 Expertise eines Insiders
Expertise eines Insiders
Gleich im ersten Satz beantwortet der bekannte Literaturkritiker Hubert Winkels die im Titel seines Buches gestellte Frage mit einer Anekdote: «Die Frage ‹Lieben Sie Deutschland?› hat der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann gewitzt beantwortet mit ‹Ich liebe meine Frau›», – Punktum! Was folgt sind die auch noch in zwei weiteren Kapiteln beschriebenen Nöte vom studentischen «Bücher-Junkie» bis zum etablierten Buchkritiker, der an seinen auf inzwischen 15.000 bis 20.000 Exemplare angewachsenen Büchern – so genau weiß er es nicht – zu ersticken droht. Solcherart beschönigend Bibliophilie genannte Sammelwut lässt den Verdacht aufkommen, dass vieles davon nie gelesen wurde, – und genau das wird vom Autor sogar ausdrücklich bestätigt. Die ihm bei einer Wohnungsauflösung überraschend zugefallenen etwa 5.000 Bände hat er zehn Jahre später bei einem Umzug allesamt ungelesen in seine neue Wohnung transportiert. Als jemand, der ausschließlich am Inhalt von Büchern interessiert ist, stellen sich mir die Haare zu Berge angesichts solcher Exzesse, die nichts mehr mit der Liebe zum Buch zu tun haben. Vor zweitausend Jahre schon hat Seneca dergleichen am Beispiel der Bibliothek von Alexandria recht zynisch kommentiert.
Das in zehn Abschnitte unterteilte Buch beginnt mit einem Kulturstreit der literarischen «Emphatiker und Gnostiker», ein 2006 unter diesem Titel in der ZEIT erschienener Beitrag von Hubert Winkels löste damals eine kontroverse Diskussion aus. Der Kernsatz darin lautet: «Die Emphatiker des Literaturbetriebs, die Leidenschafts-Simulanten und Lebens-Beschwörer ertragen es nicht länger, dass immer noch einige darauf bestehen, dass Literatur zuallererst das sprachliche Kunstwerk meint, ein klug gedachtes, bewusst gemachtes, ein formal hoch organisiertes Gebilde, dessen Wirkung, und sei sie rauschhaft, von sprachökonomischen und dramaturgischen Prinzipien abhängt». Wie wahr! Im Folgenden berichtet der bekennende Gnostiker Hubert Winkels über Kritiker und vergleicht kenntnisreich die beiden großen Alfreds der Kritik, Alfred Kerr und Alfred Polgar, mit der Literaturkritik von heute. Nach einem etwas irritierenden, in einem Buch mit dem Untertitel «Vom Umgang mit neuer Literatur» ziemlich deplazierten Abschnitt über Malerei kommt das, was Leser wie mich am meisten interessiert, – der Abschnitt mit einigen Porträts exemplarischer Schriftsteller.
Sie beginnen mit Alexander Nitzberg, gefolgt von Klaus Modick, Martina Hefter, Katharina Faber, Feridun Zaimoglu und Norbert Scheuer. Sodann folgen Betrachtungen zum gesprochenen Roman am Beispiel von Peter Kurzeck, zur Bedeutung der Lyrik, zu Archiven, Buchpreisen und Lesespuren im Buch, die der Orientierung dienen sollen. Literatur und Arbeit, Literatur als Suchtstoff, Lesungen und natürlich die Literaturkritik sind weitere Themen, über die Hubert Winkels aus eigenem Erleben heraus kenntnisreich berichtet. In vier Abschnitten findet man ferner Rezensionen von deutschen, US-amerikanischen, britischen und japanischen Büchern, gefolgt von Reiseberichten.
Alles in allem ist dies ein äußerst informativer Querschnitt durch das literarische Schaffen des mit dem renommierten Alfred-Kerr-Preis ausgezeichneten Literaturkritikers, der dem Leser hier einen Blick über den Buchdeckel hinaus ermöglicht. Damit stimmt er in das Credo von Heinz Schlaffer ein, der dafür plädiert, sich über das reine Lesen hinaus auch mit dem kulturellen Umfeld der Literatur zu beschäftigen. Und wie oben beim Emphatiker/Gnostiker-Streit zitiert, weist Hubert Winkels damit dem literarischen Buch im engeren Sinn beharrlich und unbeirrt seinen Rang ausschließlich mit Hilfe objektiver Kriterien zu, die über eine rein subjektive, also empathische Rezeption und Kritik deutlich hinausgehen müssen. Die Expertise dieses literarischen Insiders macht seine Sammlung von auch einzeln zu lesenden Texten zum Thema Buch zu einer überaus bereichernden Lektüre.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
 Zweimal jährlich
Zweimal jährlich Furor teutonicus
Furor teutonicus


 Literarische Abrissbirne
Literarische Abrissbirne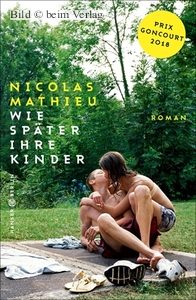 Das Rezept wirkt heute noch
Das Rezept wirkt heute noch
 Ihr könnt mich mal kreuzweise
Ihr könnt mich mal kreuzweise Na und?
Na und? Fleet Street Persiflage
Fleet Street Persiflage Roman-Haiku
Roman-Haiku Typische Rollenprosa
Typische Rollenprosa