 Blitzlicht auf einen vergessenen Poeten
Blitzlicht auf einen vergessenen Poeten
In seinem neuesten Roman «Am Götterbaum» widmet sich Hans Pleschinski zum dritten Mal einem deutschen Nobelpreisträger für Literatur. Nach Thomas Mann in «Königsallee» und Gerhart Hauptmann in «Wiesenstein» wird hier Paul Heyse in den Blick genommen. Der literarisch der Postmoderne zugerechnete Autor erzählt mit Lust am Fabulieren von der Initiative dreier engagierter Damen, die verwahrloste Villa des heute völlig vergessenen, einstigen ‹Großschriftstellers› aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken und in ein modernes Literatur-Zentrum umzuwandeln.
München brauche so etwas, um kulturell zu Berlin aufschließen zu können, da ist sich die toughe Stadtbaurätin völlig sicher. Auch den Kämmerer hat sie von ihrer Idee überzeugen können. Als sachkundige Mitstreiterinnen hat sie eine Schriftstellerin und eine Bibliothekarin gewonnen, mit denen sie sich 2019 an einem Frühlingsabend vor dem Rathaus trifft, um von dort aus zu einer ersten Ortsbegehung aufzubrechen. Da sie früh dran sind, beschließen die Damen, gemütlich zu Fuß zur Luisenstraße 22 im Kunstareal Münchens zu laufen. Auf dem Weg dorthin unterhalten sie sich sehr angeregt über Paul Heyse und das geplante Kulturprojekt, debattieren kontrovers über dessen Sinn und Machbarkeit. Pleschinski nutzt die Szenerie am Rande auch zu allerlei kritischen Betrachtungen des täglichen Wahnsinns. So wenn beispielsweise zwei smartphone-süchtige junge Männer mit ihrer Daddel vor der Nase auf dem Bürgersteig kollidieren und eines dieser elektronischen Kulturtöter auf Nimmerwiedersehen in den Gully gleitet. Oder die Damen erleben den Streit einer Tauben fütternden Alten mit einem erbosten Herrn, der von Flugratten spricht und die Polizei herbeirufen will, weil das Füttern aus guten Gründen ja verboten sei.
Die sich an einem einzigen Abend abspielende Geschichte dieses literarischen Spaziergangs durch München wird nur einmal kurz durch einen Rückblick auf einen Besuch von Adolf von Kröner am Gardasee unterbrochen. Der Besucher des Ehepaars Heyse zählte damals zu den führenden Verlegern in Deutschland, ihm verdankt der Buchhandel die seit 1888 geltende, kulturell begründete Preisbindung für Bücher. Ansonsten ist dieser Roman, neben seinen beiläufigen Alltags-Beobachtungen, überreich gespickt mit Zitaten von Heyse. Gedichte zumeist, die erkennen lassen, warum dieser Literat heute zu Recht vergessen ist. Ihm fehlt, was Pleschinski im Roman als Ingenium bezeichnet, seine literarischen Hervorbringungen sind allenfalls mittelmäßig, was auch für seine 180 Novellen, 68 Dramen und acht Romane gilt, soweit man das durch die eingefügten Zitate beurteilen kann.
Oft am Rande der Kolportage entlang schliddernd mit seinem banalen Münchner Alltags-Kolorit, enttäuscht dieser Roman durch das kulturbeflissene Dauer-Geschwafel des Damentrios, von dem man als Leser oft nicht weiß, wer denn da überhaupt spricht. Ihnen gesellt sich zu allem Überfluss auch noch ein als Heyse-Spezialist ausgewiesener Professor aus Erlangen hinzu, samt jungem, chinesischem Ehemann (sic!). Sehr zum Verdruss des geplagten Lesers trägt nun dieser Heyse-Experte immer weitere Zitate vor. Völlig absurd aber wird das Ganze, wenn zuletzt nach mehreren Pannen überraschend doch noch eine Begehung der vermieteten Villa möglich wird. Die zunächst abweisenden Mieter outen sich plötzlich als Heyse-Fans und tragen spontan im Treppenhaus der Villa ein Stück des verehrten Meisters vor. Spätestens an diesem Punkt stellt sich dann die Frage, ob diese Hommage womöglich als Satire gedacht ist. Es gibt allerdings keine Hinweise, die solche Deutung untermauern könnten, es fehlt jedwede Komik. Im Interview hat der Autor erklärt, er hoffe, «dass der Roman für Leser in diesen Zeiten eine Art Antidepressivum sein kann». Das mag für einige zutreffen, und außerdem hat er einen vergessenen Poeten blitzlichtartig ins Leser-Bewusstsein zurückgerufen, auch darin liegt ein gewisser Verdienst, aber das ist dann auch schon alles!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Von den Ursachen getrübter Lesefreude
Von den Ursachen getrübter Lesefreude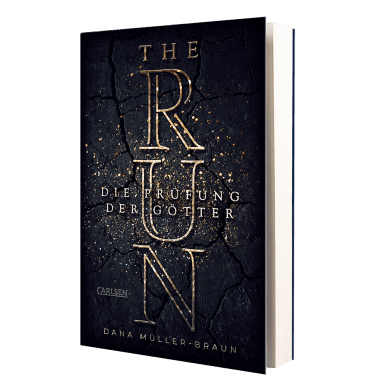
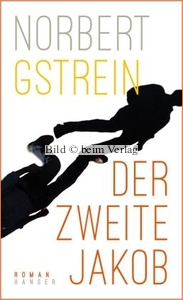 Zum Nutzen des eigenen Schadens
Zum Nutzen des eigenen Schadens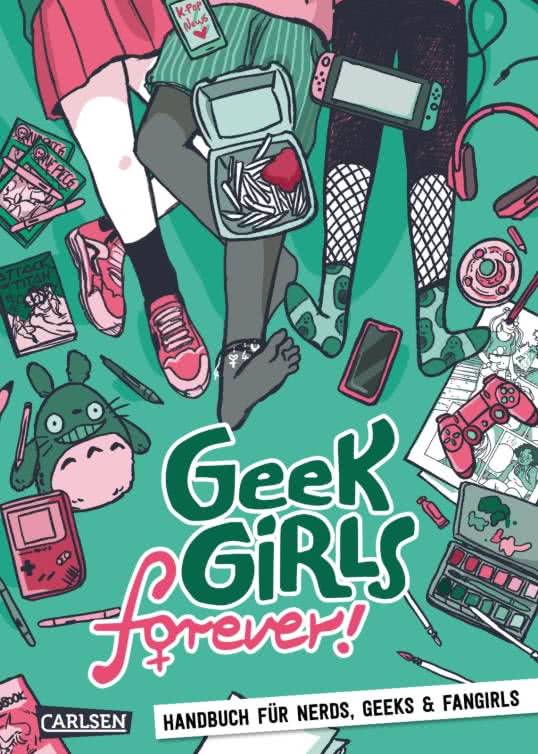 Selbstbewusstsein stärken
Selbstbewusstsein stärken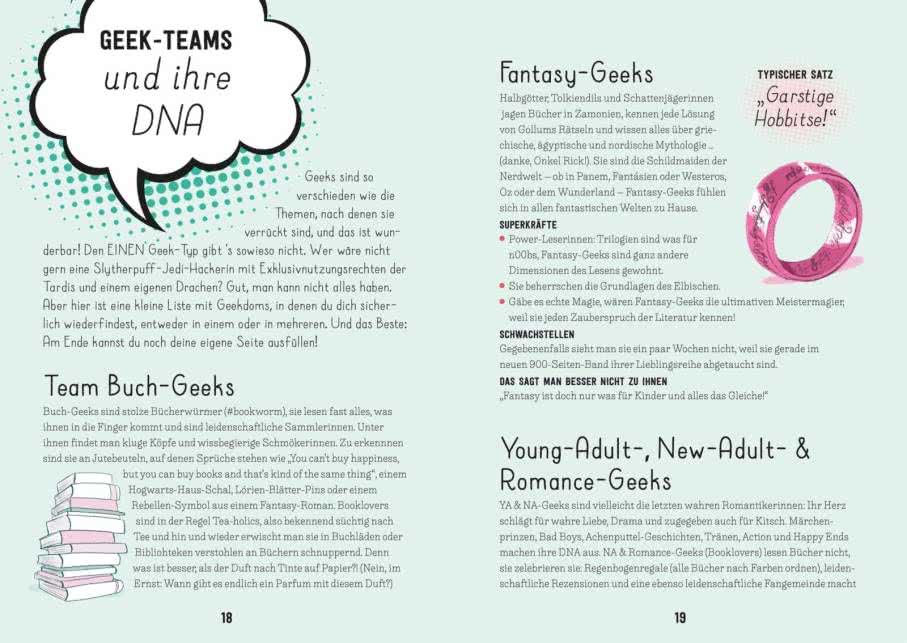
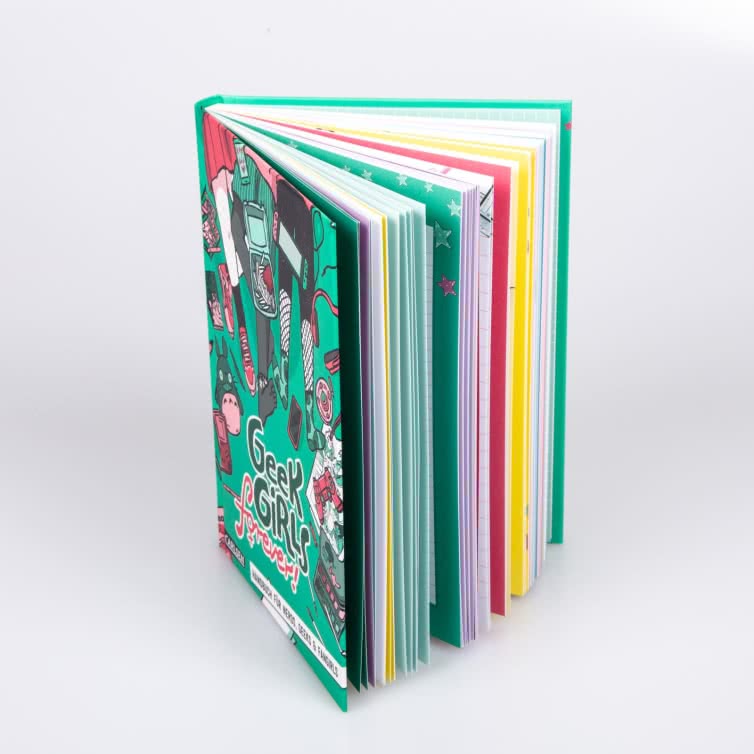
 DGD und KGD – eine unseelige, aber humorige Kombination
DGD und KGD – eine unseelige, aber humorige Kombination Seit ich in diesem Buch lese, verstehe ich Vieles besser, zum Beispiel die hilflosen Versuche, den Wire Card Betrug aufzuarbeiten. Aber sehen Sie selbst!
Seit ich in diesem Buch lese, verstehe ich Vieles besser, zum Beispiel die hilflosen Versuche, den Wire Card Betrug aufzuarbeiten. Aber sehen Sie selbst! Vexierspiel der Erinnerung
Vexierspiel der Erinnerung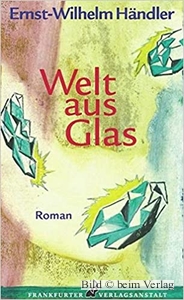 Literarische Bußübung
Literarische Bußübung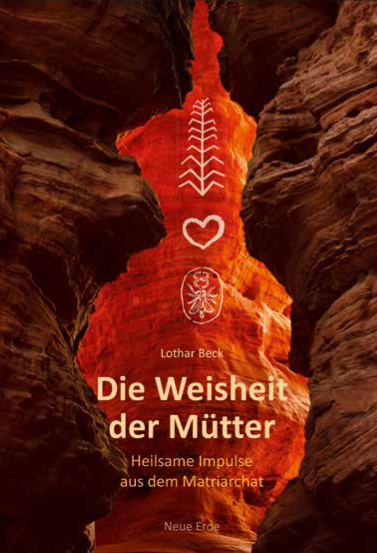 Ganzheitliches, soziales, naturverbundenes Denken
Ganzheitliches, soziales, naturverbundenes Denken Leichtfüßig mit Tiefsinn
Leichtfüßig mit Tiefsinn

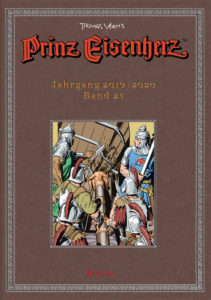 Prinz Eisenherz Yeates-Jahre Band 25: Im 25. Band der Nachfolgezeichner Hal Fosters zeichnet Thomas Yeates für Text und Zeichnungen verantwortlich. Er hat nicht nur Aleta, der Frau von Prinz Eisenherz, Zauberkräfte verliehen, sondern ihr auch zwei Raben zur Seite gestellt, die ihr manche Schwierigkeit abnehmen. In vorliegendem Abenteuer ist auch Prinz aus Thule froh, dass er eine Gefährtin gefunden, die so gut zu ihm passt. Und ihm auch noch drei Söhne und die Zwillingstöchter geschenkt hat.
Prinz Eisenherz Yeates-Jahre Band 25: Im 25. Band der Nachfolgezeichner Hal Fosters zeichnet Thomas Yeates für Text und Zeichnungen verantwortlich. Er hat nicht nur Aleta, der Frau von Prinz Eisenherz, Zauberkräfte verliehen, sondern ihr auch zwei Raben zur Seite gestellt, die ihr manche Schwierigkeit abnehmen. In vorliegendem Abenteuer ist auch Prinz aus Thule froh, dass er eine Gefährtin gefunden, die so gut zu ihm passt. Und ihm auch noch drei Söhne und die Zwillingstöchter geschenkt hat. Über die Ekelgrenze hinaus
Über die Ekelgrenze hinaus