Der schüchterne Hobbydichter Felix liebt die selbstbewusste, zwei Jahre ältere Julia. Doch Julia bevorzugt Georg. Georg ist der Freund von Felix und war mit der langen, dünnen Annemarie zusammen. Julia wiederum ist mit der von Lithium aufgedunsenen Susanne befreundet. Dann gibt es noch Daniel, Franz, Sonja, Jesse und Anja, deren Verhältnis derjenige kennt, der sich durch den Beziehungsgeflechtsroman »Bitterstoffe« gebissen hat.
Die Protagonisten treffen jedenfalls nach fünfzehnjähriger Abstinenz bei der Beerdigung von Annemarie zusammen und der Ich-Erzähler Felix erinnert sich an das erste Mädchen, mit der er geschlafen hat, an Julia. Auch Julia erinnert sich an den schalen Geschmack der ersten Liebe und schläft, ebenso freudlos wie in der Jugendzeit, erneut mit Felix und dann – etwas intensiver – mit Georg. Die Jugendfreunde trennen sich nach der Beerdigung wieder und gehen ihrer Wege. Felix treibt es jedoch bald darauf von Berlin nach Hamburg, und er besucht Julia. Doch die ist bereits wieder mit Georg beschäftigt, Felix kommt ungünstig und kehrt wieder heim. Seiner Affenliebe zu Julia tut dies keinen Abbruch.
Florian Voß erzählt die Geschichte seiner ersten Beziehungskiste mit verquaster Distanziertheit. Nach 27 Seiten wechselt er jäh die Perspektive und benennt einen Felix, der als sein Alter Ego neben Julia erwachen darf. Es braucht allerdings Zeit, bis sich der Leser sicher sein darf, dass dieser Felix auch der Ich-Erzähler ist. Diesen Wechsel der Erzählperspektive wiederholt er, um auch aus Julias Sicht das Verhältnis zu dem schüchternen jungen Mann zu schildern. Weiter aufgepeppt wird die an sich unscheinbare Geschichte einer sich wieder begegnenden Jugendliebe, indem der Autor häufig Zeitsprünge vornimmt und den Leser zum Zurückblättern zwingt. Klingelt auf Seite 58 das Telefon, wurde das entsprechende Gespräch bereits zehn Seiten zuvor geführt. Schleppt Julia Felix auf Seite 74 zum Erinnerungsfick ins das nächste Gebüsch, hat der Leser bereits Seiten zuvor den jungen Mann begleitet, der sich abschleppen lässt.
Diese an sich reizvolle Methode, beide Parteien zu Wort kommen zu lassen, wirkt in der leidenschaftslosen Erzählung angestrengt und artifiziell. Eingebettet ist sie zudem in eine Hommage an den Großvater des Autors, an dessen Einäscherung der Leser gleich im Einstieg des Werkes teilnehmen darf, die aber mit dem Handlungsstrang selbst wenig zu tun hat. Dem Roman-Debut des Herbstes aus dem Rotbuch-Verlag hätte ein klein wenig mehr Farbigkeit, ein wenig Empathie, und ein Hauch jenes Knisterns, der Beziehungen bisweilen eigen sein soll, gut getan.

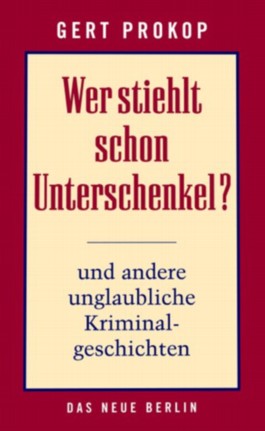 Prokop erzählt im Prolog seines Werkes, wie er in der Skybar eines Chicagoer Wolkenkratzers Bekanntschaft mit einem eitlen, arroganten und versnobten Zwerg namens Timothy Truckle schließt. Die äußerst trinkfeste Attraktion der Bar gilt als der beste Detektiv der Vereinigten Staaten. Mittels glänzender Kombinationsgabe, gut informierter Freunde und einem mächtigen Elektronengehirn namens Napoleon löst »Tiny« Truckle schwierigste Kriminalfälle.
Prokop erzählt im Prolog seines Werkes, wie er in der Skybar eines Chicagoer Wolkenkratzers Bekanntschaft mit einem eitlen, arroganten und versnobten Zwerg namens Timothy Truckle schließt. Die äußerst trinkfeste Attraktion der Bar gilt als der beste Detektiv der Vereinigten Staaten. Mittels glänzender Kombinationsgabe, gut informierter Freunde und einem mächtigen Elektronengehirn namens Napoleon löst »Tiny« Truckle schwierigste Kriminalfälle. Namenlos jobbt ohne Erfolg und Anspruch in einer Versicherungsagentur und fristet ein eher erbärmliches Junggesellendasein. Lediglich Ex-Freundin Andrea dringt gelegentlich telefonisch zu ihm durch und erkundigt sich nach seinem Zustand. Ansonsten ist sein einziger Gesprächspartner ein kleiner braungrüner Kaktus, der aus einem Müllhaufen stammt. Diesen stacheligen Mitbewohner tauft er »Rod«, weil dies auf einem Etikett an dessen Unterseite steht.
Namenlos jobbt ohne Erfolg und Anspruch in einer Versicherungsagentur und fristet ein eher erbärmliches Junggesellendasein. Lediglich Ex-Freundin Andrea dringt gelegentlich telefonisch zu ihm durch und erkundigt sich nach seinem Zustand. Ansonsten ist sein einziger Gesprächspartner ein kleiner braungrüner Kaktus, der aus einem Müllhaufen stammt. Diesen stacheligen Mitbewohner tauft er »Rod«, weil dies auf einem Etikett an dessen Unterseite steht.