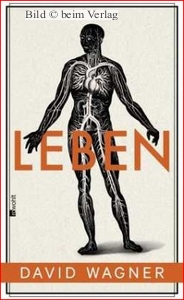
In seinem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik ausgezeichneten, autobiografischen Buch von 2013 mit dem Titel «Leben» schildert der Schriftsteller David Wagner die Geschichte seiner Organ-Transplantation. Wegen einer Autoimmun-Hepatitis, die dazu führt, dass die Leber als Fremdkörper aus dem Organismus ausgestoßen wird, wartet er als todkranker junger Mann auf ein Spenderorgan. Das Buch beginnt mit einem Anruf aus dem Krankenhaus, in dem ihm mitgeteilt wird, dass eine passende Spenderleber gefunden wurde und er umgehend zur Operation kommen solle. Die Erzählung ist, deutlich markiert, in zwei Teile getrennt, in Vor und Nach der Operation. Gegliedert in 277 unterschiedlich langen, völlig ungeordneten Erzählschnipseln endet sie mit einem Epilog, in dem im Medizinerlatein vom Ergebnis der ersten Kontroll-Untersuchung berichtet wird, die routinemäßig ein Jahr nach dem Eingriff durchgeführt wurde und die zu einem positiven Ergebnis geführt hat.
So sehr er auch darauf gewartet hat, ein Spenderorgan zu bekommen, so sehr kommen ihm anfangs auch die Zweifel, ob er sich dieser sein ganzes Leben verändernden OP wirklich unterziehen soll. Es drängen sich ihm plötzlich viele Fragen auf: Wie wird sich das Leben für ihn ändern in dem Bewusstsein, ein fremdes Organ in sich zu tragen? Mit welchen Komplikationen muss er rechnen? Ist er danach wirklich noch der Selbe? Lebt er dann nicht auf Kosten des unbekannten Spenders? Ist so ein Leben überhaupt erstrebenswert? Lohnen sich denn die Opfer, die er dafür bringen muss? Und bekommt er mit der neuen Leber letztendlich auch wirklich die Chance, länger leben zu können? Solche Fragen stehen im Mittelpunkt dieser Erzählung von einer Transplantation, von der familiär auch sein Kind und sein Vater betroffen sind.
In vielen Rückblicken erzählt er Begebenheiten und Erlebnisse aus seinem Leben, berichtet von seinen Gedanken, Hoffnungen, Ängsten und seiner Verzweiflung. Er reflektiert über das Leben und über den Tod, über moralische Fragen, aber auch über die emotionalen Herausforderungen und Zumutungen, die seine Krankheit für ihn und die Seinen bedeutet, und natürlich auch über die Chancen, die sich damit für ihn ergeben könnten. Wie von einer Insel aus beobachtet er aus der Geborgenheit seines Krankenbettes heraus die medizinischen und pflegerischen Aktivitäten des Personals, das sich unermüdlich rund um die Uhr um ihn und seine Bettnachbarn und Leidensgenossen bemüht. Die Langweile eines zumeist im Bett liegend und vor sich hindösend verbrachten Tagesablaufs ermuntert manchen Kranken sogar zu Lebensbeichten. Sie reden also nicht nur über ihre Krankheiten und Gebrechen, sie berichten auch von Schicksals-Schlägen. So etwa der Libanese, der davon erzählt, dass er seine beiden Brüder im Bürgerkrieg verloren hat. Und da ist auch der Getränkehändler im Nachbarbett, der sich heimlich aus ihrem Zimmer davonschleicht, um seine Geliebte zu besuchen, wie er gesteht. Immer wieder schielt auch der Ich-Erzähler nach den Frauen, die ihn umsorgen und dabei Sehnsüchte in ihm wecken, deren er sich in seiner hilfsbedürftigen Situation durchaus schämt, die er aber partout nicht zu unterdrücken vermag.
Als Buch ohne Gattungsbezeichnung besteht «Leben» aus literarischen Miniaturen, die in ihrer Fülle und thematischen Vielfalt ein enges narratives Geflecht bilden. Darin enthalten sind neben Glücksmomenten voller Zuversicht auch dramatische Szenen des Überlebens-Kampfes und der Todesnähe. Die phonetische Nähe der dieses Buch prägenden Begriffe «Leben» und «Leber», die für den Ich-Erzähler ja fast identisch sind, führen dann prompt auch tatsächlich einmal dazu, dass er sie in einer SMS verwechselt. Stilistisch distanziert, oft essayartig erzählt, wirkt dieses nachdenklich machende Buch gleichwohl berührend auf den Leser. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil er ja jederzeit selbst an einem solchen Kipppunkt seines Lebens stehen könnte.
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de
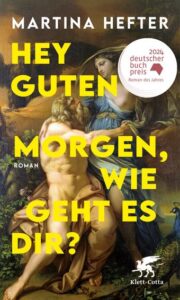 Juno, die Erzählerin, ist Anfang Fünfzig. Sie lebt mit Jupiter, ihrem seit Jahren bettlägerigen Mann in einer kleinen Wohnung in Leipzig. Er ist Schriftsteller, sie freiberufliche Performancekünstlerin, die, nicht nur zu Coronazeiten, gerne häufiger Engagements hätte.
Juno, die Erzählerin, ist Anfang Fünfzig. Sie lebt mit Jupiter, ihrem seit Jahren bettlägerigen Mann in einer kleinen Wohnung in Leipzig. Er ist Schriftsteller, sie freiberufliche Performancekünstlerin, die, nicht nur zu Coronazeiten, gerne häufiger Engagements hätte.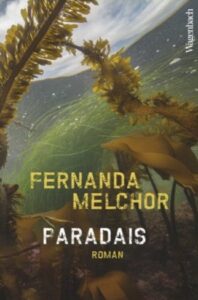 Wenn es eine Autorin mit zwei ihrer vier Romane auf die Short List des Internationalen Booker Price schafft, lässt das aufhorchen. Vielleicht geschah diese Huldigung auch ein Stück weit deshalb, weil Fernanda Melchor Mut hat. Obwohl sie an manchen Schauplätzen ihrer Romanhandlungen aus Angst um ihr Leben nicht recherchieren konnte, schreibt sie dennoch über all die brutalen Drogenkriege, die allgegenwärtigen Misshandlungen von Frauen und die deprimierende Ohnmacht gegenüber den endlosen Missständen in ihrer Heimat Mexiko. So tut sie es auch in „Paradais“.
Wenn es eine Autorin mit zwei ihrer vier Romane auf die Short List des Internationalen Booker Price schafft, lässt das aufhorchen. Vielleicht geschah diese Huldigung auch ein Stück weit deshalb, weil Fernanda Melchor Mut hat. Obwohl sie an manchen Schauplätzen ihrer Romanhandlungen aus Angst um ihr Leben nicht recherchieren konnte, schreibt sie dennoch über all die brutalen Drogenkriege, die allgegenwärtigen Misshandlungen von Frauen und die deprimierende Ohnmacht gegenüber den endlosen Missständen in ihrer Heimat Mexiko. So tut sie es auch in „Paradais“. 

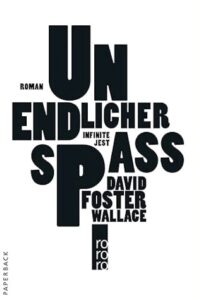




 „Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.
„Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.



