
Whatever goes up must come down Eine kleine Geschichte der Popmusik
Der österreichische Musiker und inzwischen auch Schriftsteller Hans Platzgumer bezieht sich im Titel seines neuesten Buches auf einen Song von Blood, Sweat & Tears. Sein Essay über das “Gravitationsgesetz des Pop” wird mit einer Playlist und einem “Hidden Track” ergänzt und erschien im Frühjahr 2025 in der Reihe “Bibliothek des Alltags//Beutezüge im Bekannten” im Wiener bahoe books Verlag in einem poppigen Cover mit Goldleineneinband.
Auf Schreien folgt Schweigen. Reverse.
Abgesehen von seiner eigenen Lebensgeschichte als Frontman diverser Bands wie Capers, KÖB, H.P. Zinker, Convertible u.v.a.m. und Beispielen aus der Popwelt der Sechziger bis heute, verwendet Platzgumer als kulturtheoretischen Klebstoff auch den Klassiker von Guy Debord, “Gesellschaft des Spektakels”, das schon 1967 die wesentlichen Elemente unserer heutigen Realität vorwegnahm, als Grundlagen für sein lesenswertes Essay. Guy Debord formulierte quasi als erstes, dass unsere direkte Erfahrung schrittweise durch mediale Repräsentationen verdrängt wird. Widerstand und Kritik könnten dem nur durch eigenes Handeln entgegengesetzt werden. Wer sich das umfangreiche Oeuvre des Autors und Musikers ansieht, sein Lebenswerk, wird zugeben müssen, dass der aus dem kleinstädtischen Milieu des Innsbrucks der Achtziger Jahre genau das getan hat. Vom aufbegehrenden Punkmusiker seiner ersten Platte “Tod der CD” entwickelte sich der inzwischen 56-jährige Musiker zu einem New Yorker Grungerockmusiker der frühen Neunziger hin zu einem elektronischen Musiker, der sich Jahre später dann doch wieder die Gitarre umschnallte. Auf John Cage rekurrierend, der schon 1952 mit “4’33” die Grundlagen für das legte, was später als Ambient oder Musique concrète bezeichnet wurde, darf man vielleicht auch Platzgumer eine gewisse Entwicklungsfähigkeit in seinem musikalischen Schaffen attestieren. Denn auf den Lärm (des Punks und Rocks) folgte auch bei ihm die Stille (des Schriftstellers). Auf Schreien, Schweigen. Und umgekehrt.
Pop zwischen Ursache und Wirkung
Seine Grundannahme ist, dass der Mainstream auch durch den Underground beeinflusst werde und es ohne den Austausch der beiden keine Entwicklung im Pop gebe. Platzgumer bemerkt außerdem, dass jede Rebellion ihren Sound gehabt hätte und es diese heute einfach nicht mehr gebe. Dabei verwechselt er tatsächlich Ursache und Wirkung, denn nicht der Sound macht die Rebellion, sondern die Rebellion erzeugt den Sound. Im Sinne des Ressource Mobilization Ansatzes der US-amerikansichen Sozialbewegungsforschung sind es nämlich tatsächlich die frei werdenden Ressourcen und Bündnisfähigkeiten, die den Erfolg einer sozialen Bewegung ermöglichen. Die Ästhetik des Punk wurde etwa z.B. wesentlich durch das Billigerwerden von Kopierern bestimmt, die es ermöglichte Flugblätter massenhaft zu erzeugen und zu verbreiten. House resp. Techno entstand wiederum durch das Billigerwerden des Roland Sytnhies. Damit wären wir auch wieder bei Guy Debord. Denn die heutigen Ressourcen sind ganz klar von social media bestimmt und erzeugen somit auch deren Ästhetik. In Platzgumers Fall war es übrigens ein altes Röhrenradio, an das er seine erste Gitarre anschloss, was ihn dann zum Punk führte. Der von Platzgumer angenommene Austausch zwischen Oben und Unten, also Mainstream und Underground, unterliegt allerdings vielmehr der Akzeleration der Verwertungsmechanismen des postfordistischen Akkumulationsregimes des Spätkapitalismus, in dem ganz einfach alles dem Profit untergeordnet ist. Und das eben immer schneller. Die Akzeleration (Beschleunigung des Wachstums) ist heutzutage durch social media sogar so schnell, dass es gar keinen Mainstream oder Underground mehr gibt, die Grenzen verwischen. Was nicht bedeutet, dass oben=unten oder unten=oben.
Smells like… Akzelaration
Dass nämlich ausgerechnet Kathleen Hanna der Grrrls Riot Band Bikini Kill für den Jahrhunderthit “Smells Like Teen Spirit” von Nirvana verantwortlich zeichnet und der Mainstream und Underground 1991 dank permanenter MTV-Rotation zu einer schrillen Synthese verschmolz, ist sicherlich ein Beweis für die immer schneller werdende Akzeleration des Kapitals. Durch die Seismographen des Internets kann etwas Neues aus dem sog. Underground sofort zu einem Mainstream-Trend werden. Sozialveränderndes Potential traut Platzgumer allein noch dem Hip Hop zu, der in immer neuem Gewande die Mainstreamkultur aufbreche. Die Sex Pistols im Vorprogramm (als “support act”) von Guns’n’Roses in diesem Wiener Sommer im Wiener Prater Stadion vor 43.000 Leuten ist somit nur ein weiteres Beispiel für die Richtigkeit von Debords Theorie der Gesellschaft des Spektakels: als Menschen treten wir nicht mehr direkt in Beziehung zur Wirklichkeit oder zueinander, sondern vor allem zu Bildern, Repräsentationen und Inszenierungen. Realität wird als Spektakel vermittelt – durch Medien, Werbung, Konsum, Politik in Form von Bildern und Inszenierungen, so Debord 1967 (!). “What Goes Up Must Come Down” von Hans Platzgumer ist ein interessantes Essay, das die mit Popmusik assoziierte Rebellion in den Mittelpunkt stellt – sowohl als eigene Lebenserfahrung des Autors als auch als neues Akkumulationsregime des Spätkapitalismus spätestens seit den Sechzigern. Auch diese Wechselbeziehung beruht im übrigen auf der Ausbeutung von Ressourcen.
Hans Platzgumer
What Goes Up Must Come Down
Kleine Geschichte der Popmusik
2025, Hardcover mit Goldleineneinband, 128 Seiten, Format 14x22cm
ISBN 978-3-903478-41-1
bahoe books
€ 24,00

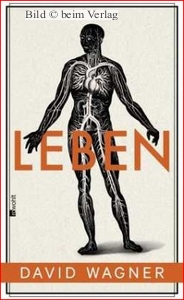
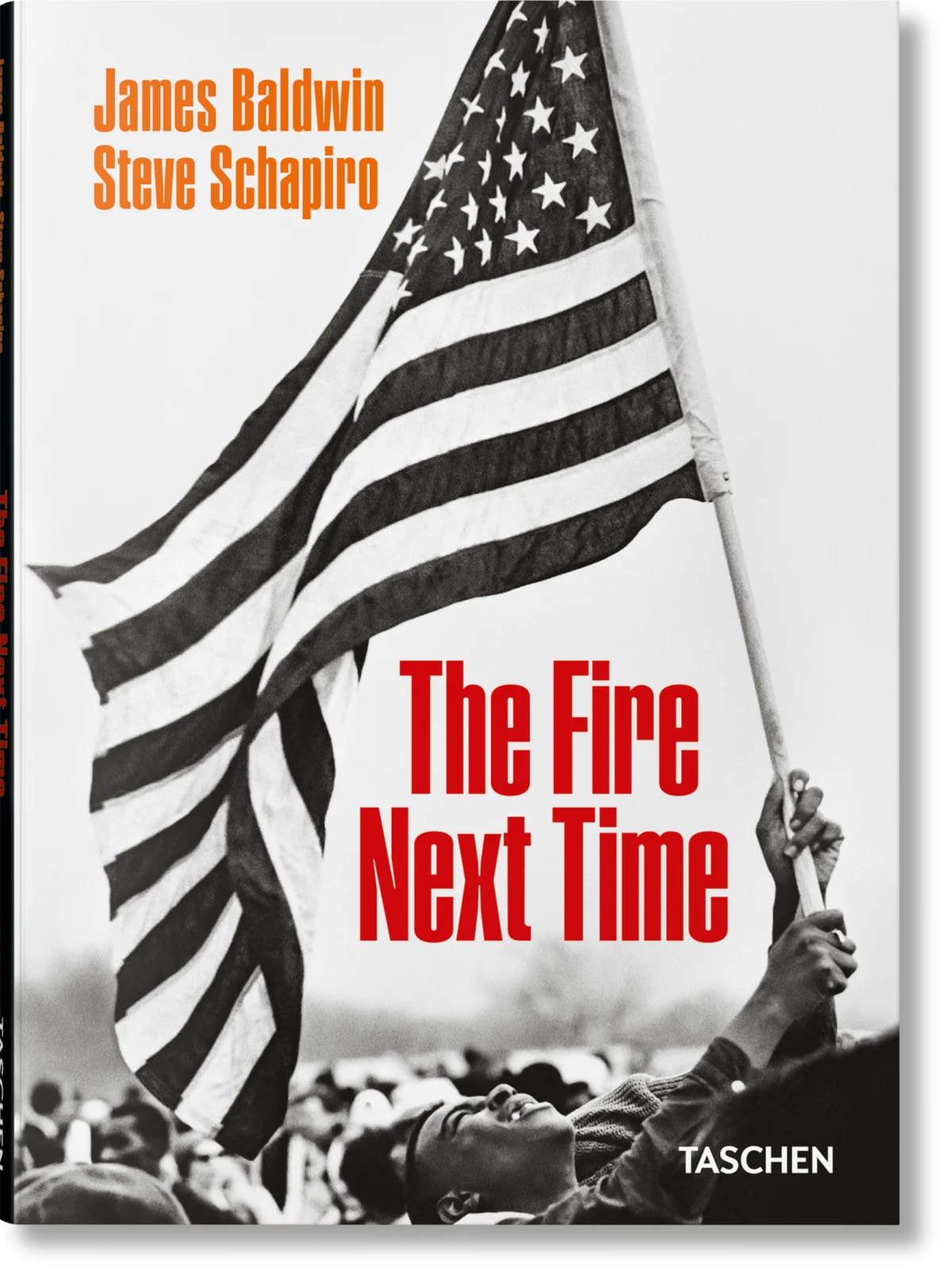
 The Fire Next Time. Zunächst erschien dieses Buch als Collector’s Edition im Großformat – jetzt, zum 100. Geburtstag Baldwins – in dieser handlichen Jubiläums-ausgabe. Einerseits zu Ehren Baldwins, andererseits auch zu Ehren des Fotografen Steve Schapiro, der leider 2022 verstarb. Ein Klassiker neu aufgelegt, denn der Text James Baldwins (1924–1987) veränderte damals bei Erscheinen (1963) tatsächlich die Welt.
The Fire Next Time. Zunächst erschien dieses Buch als Collector’s Edition im Großformat – jetzt, zum 100. Geburtstag Baldwins – in dieser handlichen Jubiläums-ausgabe. Einerseits zu Ehren Baldwins, andererseits auch zu Ehren des Fotografen Steve Schapiro, der leider 2022 verstarb. Ein Klassiker neu aufgelegt, denn der Text James Baldwins (1924–1987) veränderte damals bei Erscheinen (1963) tatsächlich die Welt.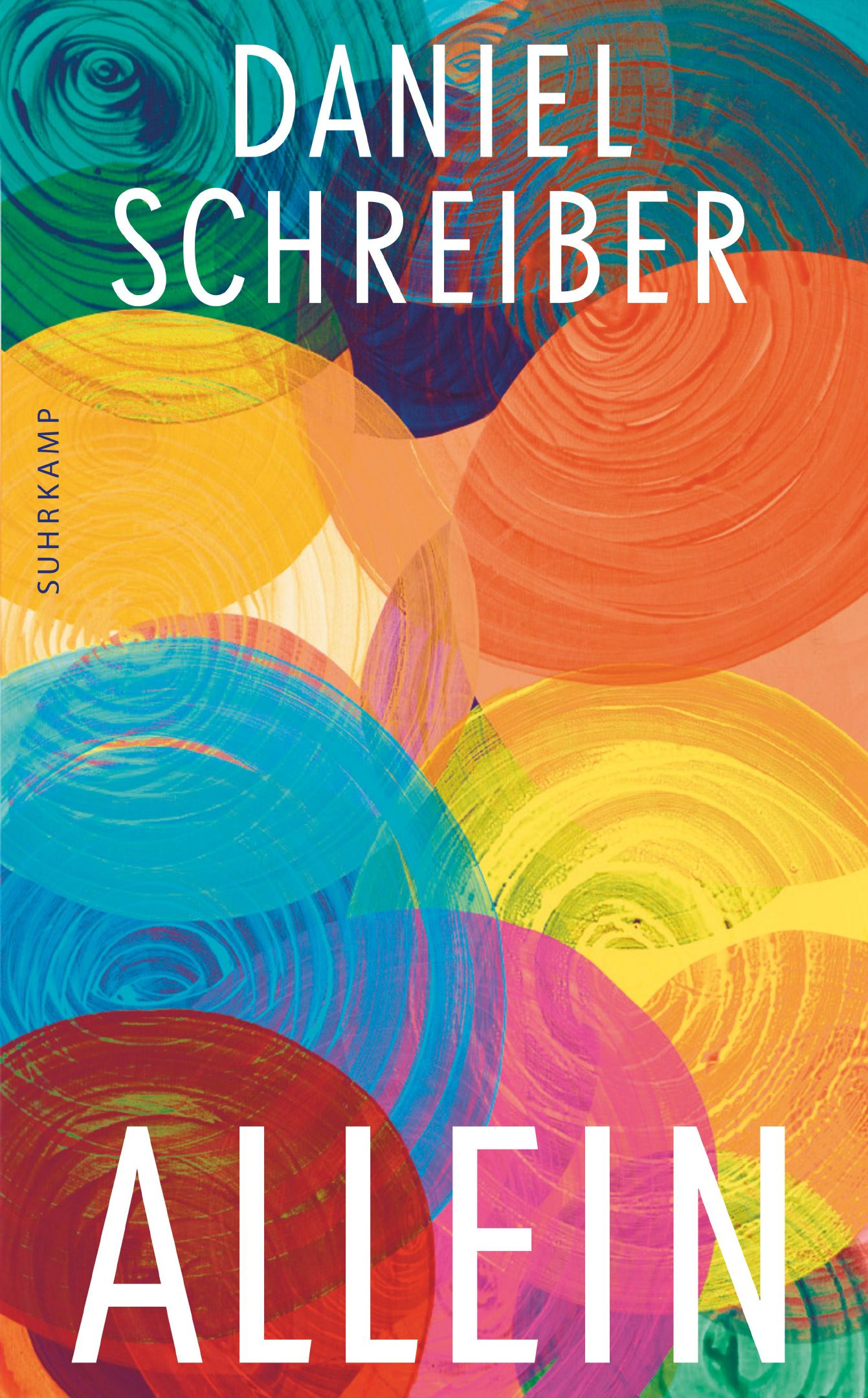


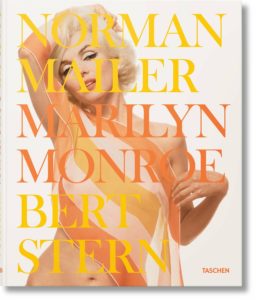


 Literarischer Bastard
Literarischer Bastard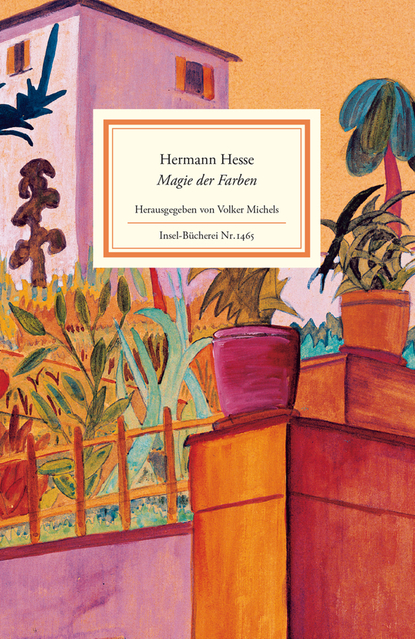


 Emanzipation heißt schlichtweg Befreiung. Das muss nicht unbedingt das Patriarchat sein. Mensch kann sich von allem befreien. Das weiß auch die Journalistin und Bloggerin Katrin Rönicke, die in der Reclam Reihe „100 Seiten“ „vom Baum der Erkenntnis bis Google“ (so der Titel des ersten Kapitels) alle Befreiungsversuche der Menschheit auflistet und kommentiert. Ihr Buch ist aber keine Auflistung geworden, sondern ein interessanter Versuch über die Befreiung.
Emanzipation heißt schlichtweg Befreiung. Das muss nicht unbedingt das Patriarchat sein. Mensch kann sich von allem befreien. Das weiß auch die Journalistin und Bloggerin Katrin Rönicke, die in der Reclam Reihe „100 Seiten“ „vom Baum der Erkenntnis bis Google“ (so der Titel des ersten Kapitels) alle Befreiungsversuche der Menschheit auflistet und kommentiert. Ihr Buch ist aber keine Auflistung geworden, sondern ein interessanter Versuch über die Befreiung.