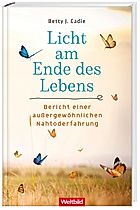„Die Natur muss gefühlt werden, wer nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern, er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr selbst aber ewig fremd sein.“ Alexander von Humboldt, 1810
„Die Natur muss gefühlt werden, wer nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern, er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr selbst aber ewig fremd sein.“ Alexander von Humboldt, 1810
Humboldt hatte Alphonse Karr aus der Seele gesprochen, ob er ihn auch gekannt hatte? Vielleicht hat er Deutsch verstanden, sein Vater war ein deutscher Pianist, aber gelebt hat Karr in Frankreich, als jüngerer Mensch in Paris, wo er gerne mit Literaten in Salons verkehrt, später in seinem Garten im Süden Frankreichs.
Das Lesen ist immer wieder ein sich Zurückversetzen in lange vergangene Zeiten: Wie sahen vor zweihundert Jahren die Gärten aus, was wussten die Menschen über Pflanzen und überhaupt von der Welt? Dass dies kein Ratgeber für meinen Garten sein würde, war mir klar, aber dass der Autor literarische Ambitionen hatte und ich nicht nur über Pflanzen und Menschen, sondern ganz viel über Insekten lesen würde, hatte ich nicht erwartet, konnte mich aber daran gewöhnen.
Das Buch Reise um meinen Garten hat über vierhundert Seiten und ist vor 175 Jahren in Frankreich erschienen. Verfasst in bald sechzig Briefen, die er an einen Freund auf Weltreise schreibt, dessen Abfahrt er beobachtet hatte, aber der Freund nahm ihn gar nicht wahr: Reisende soll man nicht aufhalten, denkt er und schreibt nun lange Briefe, die beweisen, dass man auch im eigenen Garten auf Weltreise gehen kann. Er berichtet wortreich, was er alles Schönes in seinem Garten entdeckt.
Neid auf dessen Abenteuer hätte er bekämpft, glaubt er, ihm reiche sein Garten, während der arme Reisende wahrscheinlich noch nicht einmal weiß, ob er in der Fremde etwas zu essen bekommt, und wer weiß, ob die Betttücher dort überhaupt gewaschen werden. Vom Unbewussten ahnt er nichts, veröffentlicht wird das Buch zwölf Jahre vor Freuds Geburt, Selbstreflexion ist ihm fremd.
Die aufmerksamen Beobachtungen der Pflanzen, und der Insekten, werden präzise und wortreich beschrieben. So wie bei den französischen Romanciers seines Jahrhunderts, musste ich mir in Erinnerung rufen, dass früher mehr Zeit war, die man gerne mit Schreiben und Lesen zubrachte, da es von den Tätigkeiten, die heute unsere Zeit auffressen, noch nicht viele gab.
Zum Glück gibt es ein ausführliches Vorwort, indem ein derzeitiger Gärtner uns in Karrs Zeit einführt, und etwas über ihn erzählt. Er hatte eine Satirezeitschrift (mit dem Namen Die Wespen) gegründet und zieht auch in diesen Briefen gerne über andere her. Am liebsten über Akademiker, schon kleine Kinder werden von ihren Lehrern von den Dingen abgehalten, die wichtig sind, etwas vom Spielen.
Botaniker kommen besonders schlecht weg mit ihren lateinischen oder griechischen Vokabeln, man könne doch die Wörter nehmen, die die Menschen in ihrer Sprache gefunden haben und richtig aussprechen können.
In welcher Ordnung für Pflanzen kommen Gerüche vor? Farben? Alles das, was Gefühle auslöst? Vom Blau weiß er: “… das Parmaveilchen hat ein sehr blasses Lapisblau, danach kommt der blaue Wiesenstorchenschnabel, dann die chinesische Glyzinie, dann die Leinblume, dann kommt in der Reihe der Nuancen das Vergissmeinnicht, der Borretsch, die Hundszunge, der Prachtsalbei, die Trichterwinde …” und so geht es noch lange weiter. Dazu stelle ich mein Kapitel „Blau im Garten“ vor, wo ich beschreibe, wie anderthalb Jahrhunderte später Liebermann und Foerster den Faden weiterspinnen …
Insekten beschreibt er minutiös, etwa die Entwicklung der Larven (schön wie Delphine!) zu Steckmücken, lässt sich 10-mal stechen, um den Stechrüssel observieren zu können. Mir wurde klar, dass wir heute kaum noch Insekten haben.
Klischees gibt es zuhauf: arme Menschen sind gute Menschen, reiche Menschen sind schlecht. Frauen sind Geschöpfe, denen man Sträußchen offeriert, gerne Veilchen, aber sonst gibt es nichts über sie zu sagen.
Gerade in einer Zeit, in der eigene Reisepläne nicht umsetzbar sind, genieße ich die Reise um Karrs Garten. Ich las immer nur ein Kapitel pro Tag. Also, wer gerne dicke Bücher liest, so wie die Rschersch von Proust, der sollte anfangen und wird es lieben.
 Ein bezeichnendes Ende
Ein bezeichnendes Ende





 Wenig bereichernd
Wenig bereichernd Verquer, aber emotional anregend
Verquer, aber emotional anregend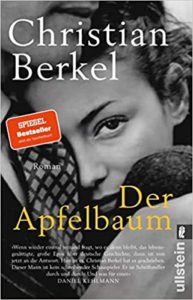 Einundneunzig Jahre alt ist die Mutter des Autors und träumt sich immer wieder in neue Abenteuer hinein, dabei will er doch, bewaffnet mit einem Kassettenrekorder, ihre wechselhafte Geschichte aufzeichnen, gerne auch das, was bisher verschwiegen wurde. Aus diesen Stückchen, die es zusammenzufügen gilt, will er seine eigene Geschichte „neu erfinden“, und nicht mehr davor weglaufen, heißt auf dem Umschlagdeckel.
Einundneunzig Jahre alt ist die Mutter des Autors und träumt sich immer wieder in neue Abenteuer hinein, dabei will er doch, bewaffnet mit einem Kassettenrekorder, ihre wechselhafte Geschichte aufzeichnen, gerne auch das, was bisher verschwiegen wurde. Aus diesen Stückchen, die es zusammenzufügen gilt, will er seine eigene Geschichte „neu erfinden“, und nicht mehr davor weglaufen, heißt auf dem Umschlagdeckel.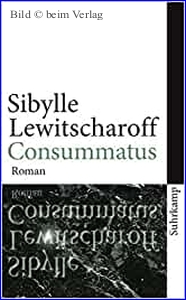 Nichts für tote Leser
Nichts für tote Leser Vielschichtiges Panorama
Vielschichtiges Panorama



 Psychologische Untergangsstudie
Psychologische Untergangsstudie