 Hochkomplexer Holocaust-Roman
Hochkomplexer Holocaust-Roman
Was der amerikanischen Schriftsteller Jonathan Littell mit seinem auf französisch geschriebenen Roman «Die Wohlgesinnten» geschaffen hat, das ist eine literarische Provokation. Über den Holocaust aus Täterperspektive zu schreiben wurde als unverzeihlicher Tabubruch gescholten, den sich wohl auch nur ein nicht-deutscher Autor leisten könne. So einmalig ist dieser Tabubruch allerdings nicht, in «Der Nazi und der Friseur» hat Edgar Hilsenrath 1977 schon aus der Täterperspektive erzählt, und das auch noch in Form eines Schelmenromans. Littells nicht zuletzt auf Betreiben von Jorge Semprún mit dem Prix Goncourt 2006 prämiertes und weitgehend als Tatsachenroman verfasstes Buch wurde jedenfalls ein Riesenerfolg und landete selbst in Israel auf der Bestsellerliste. Der Autor bekam daraufhin sogar seinen französischen Pass, so beeindruckt waren selbst die Behörden.
Dr. jur. Maximilian Aue hasst seine Mutter und seinen französischen Stiefvater. Sein leiblicher Vater war in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg im Baltikum verschollen, und um wieder heiraten zu können hat seine Mutter ihn für tot erklären lassen. Noch chlimmer aber war für ihn, dass sie ihn brutal von seiner Zwillings-Schwester getrennt hat, weil er eine inzestuöse Beziehung zu ihr unterhalten hat. Seither ist er homosexuell orientiert, was er auf den Verlust seiner großen und einzigen Liebe zurückführt. Nur durch Eintritt in die SS entgeht er knapp einer Verhaftung wegen seiner damals ja noch strafbaren homosexuellen Abenteuer. Im Krieg folgt er mit seiner SD-Einheit der vorrückenden Wehrmacht, um in den eroberten Gebieten die jüdische Bevölkerung zu vernichten. Einer seiner ersten Einsätze führt ihn nach Kiew, wo er an der Schlucht von Babyn Jar die Massenerschießung von 33.000 Juden durch das deutsche Heer miterlebt. Tod und Verderben hinterlassend gelangt er mit den mörderischen SD-Einsatzgruppen bis nach Stalingrad, erlebt auf abenteuerlichen Wegen den verlustreichen Rückzug mit und rettet sich über Auschwitz in das von der Roten Armee eroberte Berlin. Bis dorthin folgen ihm auch, wie die Eumeniden in der Orestie von Aischylos, von denen sich der Romantitel herleitet, unerbittlich zwei Kriminalbeamte. Sie wollen ihn unbedingt des ungeklärten Mordes an Mutter und Stiefvater überführen, obwohl doch Himmler höchstpersönlich schützend seine Hand über ihn hält. Für Max Aue verkörpern die Kriminaler das schlechte Gewissen, das ihn unerbittlich ein Leben lang verfolgt.
Mit einem umfangreichen Figuren-Ensemble aus fiktiven und historischen Personen beschreibt Littell das fürchterliche Geschehen äußerst realistisch, strikt den historischen Fakten folgend. Nach jahrelanger, akribisch genauer Recherchearbeit, die auch von Wissenschaftlern anerkannt wird, hat er den Roman dann in kurzer Zeit niedergeschrieben. Er liest sich trotz der ausufernd vielen Details und trotz der komplizierten politischen und militärischen Vorgänge streckenweise wie ein Krimi, jedenfalls versteht es der Autor, bis zuletzt die Spannung aufrecht zu erhalten. Die fiktiven Figuren und die persönlichen Erlebnisse des Protagonisten sind stimmig in das reale Geschehen eingefügt und enthalten auch so manche Komik, so wenn Aue im Traum zum Beispiel dem Führer heftig in die Nase beißt.
Der Plot beschäftigt sich auch mit den vielen abstrusen politischen Erklärungs-Mustern, die das Morden moralisch zu rechtfertigen suchen. Die persönliche Schuld des Protagonisten wird oft in Passagen des Deliriums thematisiert, womit Littell die Klippen des Unsagbaren geschickt umschifft. Immer wieder werden auch die psychischen Verheerungen angesprochen, die das Unfassbare sogar bei den SS-Leuten verursacht. Gegen Ende hin gerät die Geschichte zunehmend ins Surreale; auch das eine Methode, den Schrecken ertragbar zu machen! Man durchschaut diesen hochkomplexen Holocaust-Roman, so meine Erfahrung, auch beim zweiten Lesen nur unzureichend, ein Grund also, sich wiederholt damit zu beschäftigen.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Adieu Zelda, es war mir eine Ehre
Adieu Zelda, es war mir eine Ehre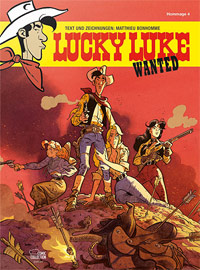 Gesucht
Gesucht Blitzlicht auf einen vergessenen Poeten
Blitzlicht auf einen vergessenen Poeten Von den Ursachen getrübter Lesefreude
Von den Ursachen getrübter Lesefreude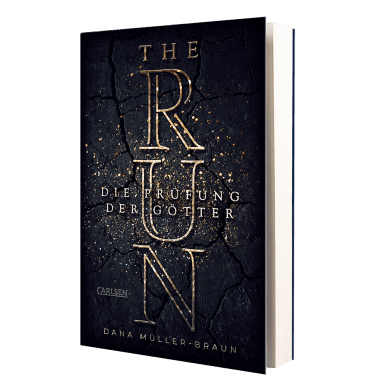
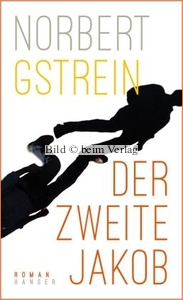 Zum Nutzen des eigenen Schadens
Zum Nutzen des eigenen Schadens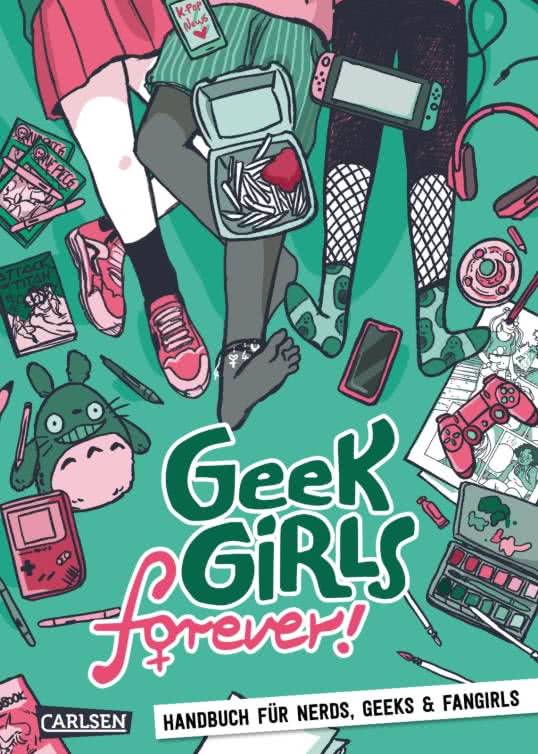 Selbstbewusstsein stärken
Selbstbewusstsein stärken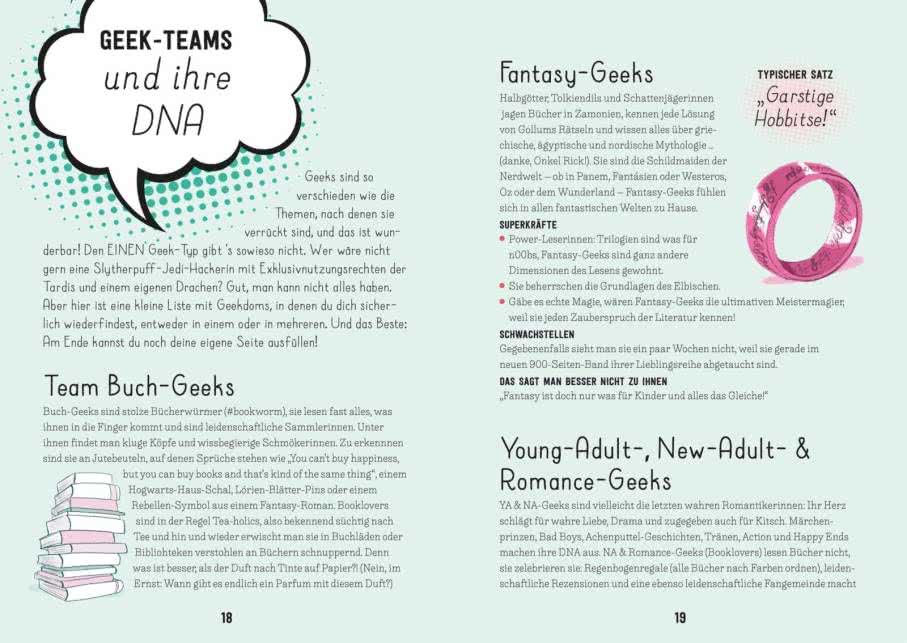
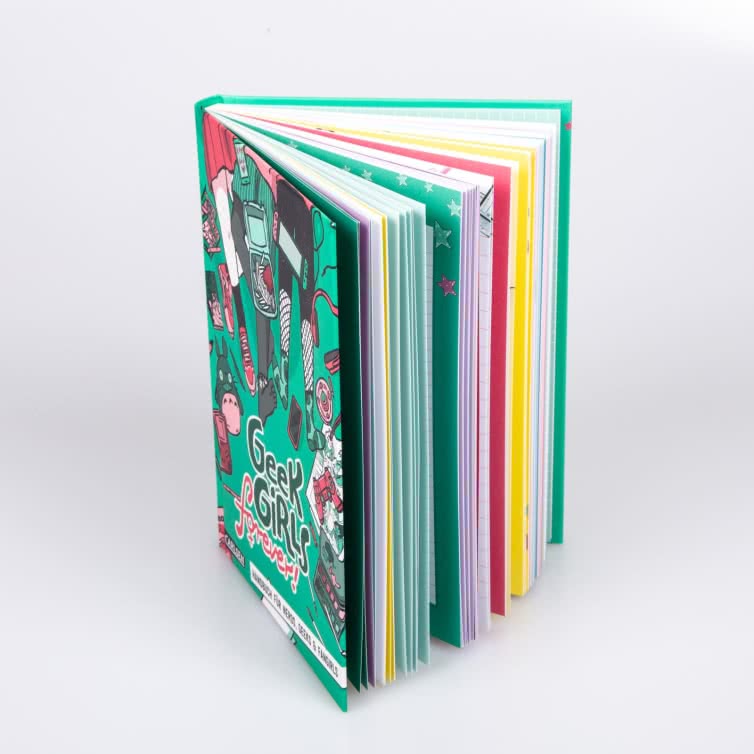
 DGD und KGD – eine unseelige, aber humorige Kombination
DGD und KGD – eine unseelige, aber humorige Kombination Seit ich in diesem Buch lese, verstehe ich Vieles besser, zum Beispiel die hilflosen Versuche, den Wire Card Betrug aufzuarbeiten. Aber sehen Sie selbst!
Seit ich in diesem Buch lese, verstehe ich Vieles besser, zum Beispiel die hilflosen Versuche, den Wire Card Betrug aufzuarbeiten. Aber sehen Sie selbst! Vexierspiel der Erinnerung
Vexierspiel der Erinnerung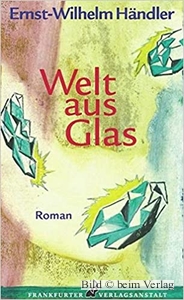 Literarische Bußübung
Literarische Bußübung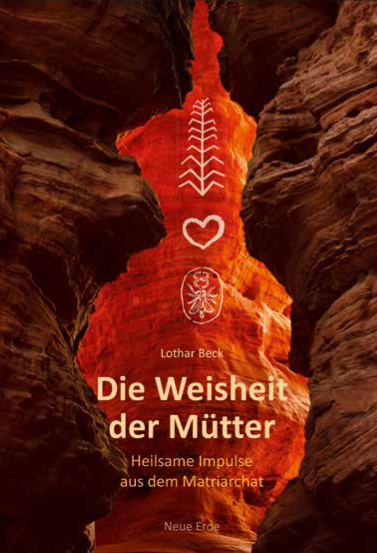 Ganzheitliches, soziales, naturverbundenes Denken
Ganzheitliches, soziales, naturverbundenes Denken Leichtfüßig mit Tiefsinn
Leichtfüßig mit Tiefsinn