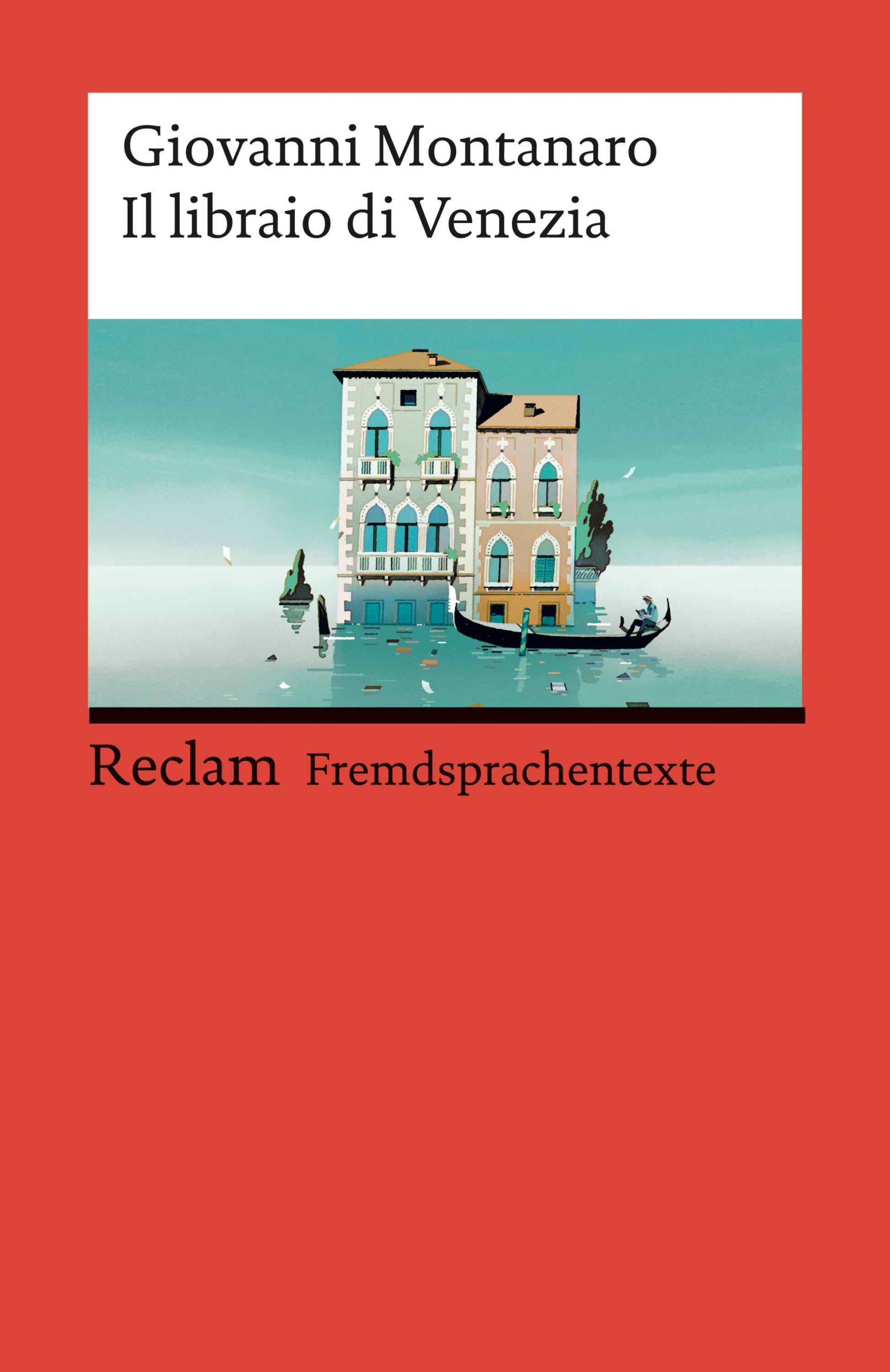Frechheit kommt weiter. Und wer in seinem Roman die gerade im Ruhestand angelangte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel als Protagonistin einsetzt, der darf damit rechnen, weiterzukommen. David Safier hat die coole Ausgangskonstellation mit »Miss Merkel« als Detektivin gewählt, die zu allem Überfluss auch phonetisch noch an die literarische Kunstfigur »Miss Marple« von Agatha Christie erinnert. Angela Merkel kann sich gegen eine derartige Vereinnahmung kaum wehren, da sie als Person der Zeitgeschichte natürlich auch in die Kriminalliteratur eingehen kann. Weiterlesen
Frechheit kommt weiter. Und wer in seinem Roman die gerade im Ruhestand angelangte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel als Protagonistin einsetzt, der darf damit rechnen, weiterzukommen. David Safier hat die coole Ausgangskonstellation mit »Miss Merkel« als Detektivin gewählt, die zu allem Überfluss auch phonetisch noch an die literarische Kunstfigur »Miss Marple« von Agatha Christie erinnert. Angela Merkel kann sich gegen eine derartige Vereinnahmung kaum wehren, da sie als Person der Zeitgeschichte natürlich auch in die Kriminalliteratur eingehen kann. Weiterlesen
Archiv
Miss Merkel. Mord in der Uckermark
Abby – Auf der Seite des Gesetzes (Band 3)
 Von Outlaws zu gesetzestreuen Bürger*innen
Von Outlaws zu gesetzestreuen Bürger*innen
Abigail Clearwater Williams, genannt Abby, hat sich mit ihrem Mann Butch Cassidy, jetzt bekannt unter dem Namen Robert Williams, eine Ranch gekauft. Beide wollen nach ihrem Dasein als Outlaws ein ruhiges, gesetzestreues Leben führen. Deshalb geht Robert seiner zweiten Leidenschaft, dem Hegen und Pflegen von Tieren, nach: Er züchtet und verkauft Pferde. Ihre gemeinsame Tochter Elisabeth, kurz Betty, liebt Tiere ebenfalls und liegt ihren Eltern schon seit geraumer Zeit mit eigenen Pferden und Hunden in den Ohren. Betty weiß nichts von der Outlaw-Vergangenheit ihrer Eltern und das soll nach dem Willen von Abby und Robert auch so bleiben. Sie haben extra ihre Spuren verwischt, damit man ihren ruhigen Lebensabend nicht gefährden kann. Das bedeutet aber auch, dass Abby auf ihre erste Tochter Alison verzichten muss, denn diese kennt die Vergangenheit ihrer Mutter. Alison lebt mittlerweile in dem Glauben, Butch Cassidy und Abby seien gestorben. Aber durch Abbys und Roberts Freunde Mary und Elzy, die mit Alison in Kontakt stehen, ist Abby immer über ihre Tochter informiert, sodass sie zumindest aus der Ferne an Alisons Leben teilhaben kann. Dann aber erleidet Alison einen lebensbedrohlichen Unfall und Abby beschließt, sie im Krankenhaus zu besuchen. Das ist leider nicht das einzige Unheil, dass den Frieden der Familie gefährdet: Auch Betty, die mit ihrer lebhaften Art ihrer Mutter nachschlägt, erleidet einen Unfall, der sie an den Rand des Todes bringt. Außerdem müssen sich Abby und Robert gegen einen Pater wehren, der Kinder missbraucht. Ihr Leben gestaltet sich also weiterhin alles andere als ruhig.
Wahre Begebenheiten
Ich bin erst mit Band 3 in die Reihe eingestiegen. Schon erhältlich sind die Bände „Abby – Mit Butch Cassidy auf dem Outlaw Trail“ und „Abby – Totgesagte leben länger“. Ein 4. Band ist geplant. Mir ist der Einstieg in die Reihe leichtgefallen, da kurze Rückblicke an gegebener Stelle einiges erklären, was sonst unklar geblieben wäre.
Die Autorin hat sich mit dieser Reihe dem Western verschrieben, und zwar aus Frauensicht. Ihre Protagonistin Abby ist zwar eine Fantasiefigur, aber Fischer lehnt ihre Geschichte an wahre Begebenheiten an. Butch Cassidy und Elzy Lay z.B. waren reale Outlaws, über die sich die Autorin mithilfe von Büchern informierte, wie sie im Nachwort schreibt. Ihr ist es auch wichtig, zwischen Realität und Fiktion zu trennen und aufzuzeigen, wo bei ihr die Fiktion beginnt. Sie weist aber auch darauf hin, dass sie behutsam ihre Fiktion mit der Realität verbunden hat, um ein rundes Ganzes zu schaffen. Das ist ihr gelungen. Die Geschichte liest sich spannend, man kann gut in die Story eintauchen und mit den Figuren mitfühlen. Die Figuren selbst hat Fischer lebendig und sympathisch gestaltet.
Frauenbild
Um noch einmal auf das Genre “Western” aus Frauensicht zurückzukommen: Meist sind Western aus Männersicht geschrieben oder verfilmt. Frauen kommt dabei eher die Rolle von Nebendarstellerinnen zu, die entweder die gute Hausfrau mimen, in Salons den männlichen Voyeurismus bedienen oder als „schwaches“ Geschlecht z.B. als evtl. zu rettendes Opfer herhalten müssen. Kurz: Die Rolle der Frau in einer solchen Sicht des Westerns hat zumindest bei mir als Mädchen und später als Frau keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Ich konnte mich aus guten Gründen mit keiner dieser negativ und einseitig besetzten Frauenrollen identifizieren, sodass mir dieses Genre weitgehend fremd geblieben ist. Mit einer selbstbestimmten und gleichwertigen Frau als Hauptfigur sieht das aber schon ganz anders aus. Abby ist selbstbestimmt; sie lässt sich auch in sexueller Hinsicht nichts sagen und macht das, was ihr richtig erscheint. Sie steht ihren Mann, ohne dabei ihre Form der Weiblichkeit aufzugeben. Letztlich ist sie es, die entscheidende Richtungswendungen veranlasst. Auch ihre Töchter Alison und Betty lassen sich in kein Rollenklischee pressen und machen das, was ihnen gut dünkt. Gerade Alison eckt damit regelmäßig bei ihrem konservativen Vater an. Aber das macht sie bewusst, um ihn zu ärgern und vielleicht auch, damit er über seinen engen Tellerrand hinaussieht. Betty hat das Glück in einer Familie aufzuwachsen, die ihr die für sie so notwendigen Freiheiten gibt, damit sie sich gesund entwickeln kann.
Die anderen Frauen in dem Roman entsprechen allerdings dem Rollenklischee und scheinen damit auch zufrieden zu sein. Das ist in Ordnung, solange sie dazu nicht gezwungen sind und anderen keine Vorhaltungen machen, wie sie zu leben haben. Das tun die Frauen in dem Roman nicht, sie unterstützen sich gegenseitig und ergänzen sich. Damit entsprechen sie den matriarchalen Netzwerken, die für Frauen sehr vorteilhaft sind, wenn sie funktionieren. Das Patriarchat versucht nicht umsonst, starke Frauennetzwerke zu zerstören. Ein Wehrmutstropfen für mich ist allerdings, dass Abby dem Klischee der Rothaarigen entspricht: Sie ist so feurig wie ihre Haarfarbe. Sieht man sich die historischen Begebenheiten an, leiden Rothaarige und v.a. rothaarige Frauen unter Klischees. Die Haarfarbe ist bei anderen Menschen nicht sehr beliebt und führte in der Vergangenheit sogar zu Tötungen von gerade weiblichen Rothaarigen (Hexenverbrennungen). Auch eine meiner Kindheitsfreundinnen, die rothaarig war, litt immer wieder unter Repressalien wegen ihrer Haarfarbe. Deshalb finde ich es besser, Klischees zu durchbrechen, anstatt sie weiter zu bedienen. Frauen müssen auch nicht immer impulsiv sein, um Stärke zu zeigen, zumal Frauen, die impulsiv sind, oft die Vernunft und das analytische Denken abgesprochen werden (was nicht stimmt, es geht auch beides). Analytisches Denken, kühle Überlegtheit wird oft nur Männern zugestanden, was ebenso falsch ist. Wenn man bedenkt, was Frauen egal welchen Charakters durch die Mehrbelastung leisten müssen und dass das nur mit durchgetaktetem Tagesablauf und damit nur mit strategischer Planung und Organisation geht, dann ist dieses Klischee schon millionenfach widerlegt.
Positive Grundhaltung
Der Roman hat trotz aller Schwierigkeiten, die die Figuren meistern müssen, immer einen positiven Grundton. Er liest sich flüssig und leicht. Die Figuren meistern die Schwierigkeiten mit Entschlossenheit, verbergen aber auch ihre Bedenken und ihre Ängste nicht, was sie realer wirken lässt. Durch die positive Grundhaltung gesunden Abby und die anderen wieder und versinken nicht in Depressionen. Was meinen Lesefluss ein wenig gestört hat, ist die Angewohnheit der Autorin, ganze Sätze nicht mit einem Punkt, sondern nur mit einem Komma abzutrennen. Dadurch werden die Sätze zu lang und bekommen etwas Hastiges, Unruhiges im Satzduktus. Die kleine Lesepause durch den Punkt fehlt mir. Aber insgesamt finde ich den Roman gelungen, denn aus o.g. Gründen ist er gut durchdacht und spannend geschrieben.
Lavaters Maske
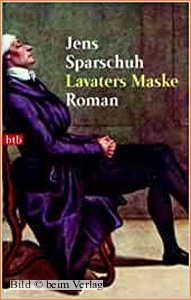 Die Nöte eines Schreiberlings
Die Nöte eines Schreiberlings
Der Titel «Lavaters Maske» von Jens Sparschuh verrät, dass es um die Maskerade des Lebens geht, um Physiognomik, hier im Roman speziell um die wissenschaftliche Methode, aus den Gesichtszügen auf den Charakter eines Menschen zu schließen. Johann Caspar Lavater war im achtzehnten Jahrhundert Begründer und wichtigster Vertreter dieser Lehre, heftig angefeindet von Lichtenberg, später auch von seinem Jugendfreund Goethe. Das Thema des 1999 erschienenen Romans ist insoweit hochaktuell, als China die heutigen technischen Ressourcen radikal nutzt, um einen lückenlosen Überwachungs-Staat zu realisieren. Dieses totalitäre Regime kontrolliert seine Bürger auf Schritt und Tritt mit modernster Software zur Gesichts-Erkennung, um Rückschlüsse auf ihre seelische Verfasstheit zu ziehen. Die Orwellsche Dystopie «1984» ist also doch noch Realität geworden.
Ich-Erzähler des Romans ist ein ehemaliger Germanist und wenig erfolgreicher Schriftsteller, dem für sein letztes Buch das «Wühlischheimer Ehrenstipendium» zugesprochen worden war, damit er eine Zeit lang in ländlicher Ruhe schreiben kann. Er führt nun ein mit Residenzpflicht verbundenes, ziemlich langweiliges Stadtschreiber-Dasein. Ausgerechtet jetzt aber leidet er an einer Schreib-Blockade, ihm fällt partout kein neues Thema ein. Auf telefonische Nachfrage seines Agenten, woran er denn derzeit arbeite, antwortet er ohne lange zu überlegen mit einer Notlüge: Er schreibe über Lavater. Er hat das gar nicht vor, aber daraus wird dann tatsächlich Ernst, als sich nämlich auch noch ein Filmboss für den eher ungewöhnlichen Stoff interessiert. Da winken ihm ja schließlich dringend benötigte Vorschüsse. Er beginnt also, über seinen Protagonisten zu recherchieren, und stößt dabei schon bald auf eine Selbstmord-Geschichte. Enslin, der jugendliche Sekretär von Lavater, hatte sich mit einem Gewehr erschossen, ein mysteriöser Suizid, der bis heute viele Fragen aufwirft.
Die Recherchen zu dem Exposé für den geplanten Film nehmen breiten Raum ein in diesem Roman, unterbrochen nur von gelegentlichen Lese- und Vortragsreisen, mit denen der Ich-Erzähler zwischendurch seine notorisch klamme Kasse wieder auffüllt. Dieser ergänzende Erzählstrang ist witzig und zeugt davon, dass der Autor wohl vertraut ist mit den Gegebenheiten und Ritualen, denen sich heute ein Schriftsteller unterziehen muss als Promoter seiner eigenen Werke. Weniger lustig ist allerdings, was man in Form von historischen Briefen, Lexikonbeiträgen und zeitgenössischen Zitaten über Lavater und seinen Schreiber Enslin erfährt. Dieser eigentliche Haupt-Strang des Romans ist äußerst langweilig zu lesen, er führt zudem mit den wilden Spekulationen des Ich-Erzählers, was denn nun wirklich passiert ist in der Causa Enslin, ins Leere. Ebenso ins Leere führen auch die wirren Versuche des schreibenden Romanhelden, seinem Exposé eine tragfähige, glaubhafte und zündende Idee als Handlungsgerüst zu Grunde zu legen. Das Ganze wird nur immer wirrer, er macht die aberwitzigsten Erfahrungen, trifft auf die merkwürdigsten Leute und scheitert letztendlich auch im privaten Bereich, das Zwischenmenschliche ist nicht seine Stärke.
Ähnlich ergeht es auch Jens Sparschuh, es ist ihm nämlich nicht gelungen, das Lavater-Thema mit dem seiner Romanfigur, des Schriftstellers in der Identitäts-Krise, stimmig zu verbinden, beides steht in dieser doppelbödigen Geschichte unabhängig voneinander für sich. Da passt es dann auch, dass der eher trottelige, gleichwohl aber sympathische Protagonist am Ende des Romans in einer Festrede zum Thema Physiognomik kläglich scheitert. Gerade diese fachspezifischen Passagen wirken als Störfaktor, sie sind einfach nicht stimmig in ein erzählerisches Werk zu integrieren. Insoweit ist dieser anekdotenreiche Roman allenfalls wegen seiner gekonnt erzählten, amüsanten Einblicke in die Nöte eines mittelmäßigen Schreiberlings zur Lektüre zu empfehlen, als Ganzes aber ist er leider misslungen.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Begrünen was geht: Kleine und große Pflanzideen für Wände, Zäune, Dächer und graue Ecken. #machsnachhaltig
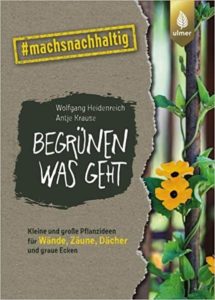 Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“
Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“
Anfangs habe ich als Gartenoma etwas gefremdelt, vielleicht, weil ich geduzt wurde? Aber dann sah ich, dass hier Fachwissen vermittelt wird. Es kommen als Einleitung die guten Gründe, für mehr Grün, gerade in der Klimakrise, etwa, weil es durch Verdunsten kühlt, es ist ein Feinstaubfilter und es bricht Schallreflexionen und macht so „den Lärmpegel mess- und hörbar geringer.“
Dann wird vorgeschlagen, mehr für Bienen zu tun, was sind Bienen-Stauden, was Bienen-Gehölze? Sie haben nur ein Fenstersims zu Verfügung? Dann kann es ein Töpfchen mit Kräutern sein. Geländer und Zäune werden begrünt, hier kommen Tipps vom Fachmann, welche Pflanzen in welchen Kübel, soll es schnell wachsen oder nicht? #machsnachhaltig gilt dann für Vogelhäuschen, Mülltonnenboxen oder den berankten Zaun. Es liest sich gut und gibt auch Tipps für grüne Daumen, die erst im Wachsen sind.
Die gebündelte Kompetenz der Verfasser zeigt sich beim nächsten Kapitel: Wände begrünen ist eine Sache für den Profi. Es gibt eine Checkliste mit den Fragen: Passt die Befestigung der geplanten Kletterhilfe zum Wandaufbau? Passt die Kletterhilfe zur gewünschten Pflanze? Will ich Blüten und Früchte, will ich Herbstfärbung? Will ich eine immergrüne Pflanze? Ist es eine Nord-, eine Südseite? Wie ist der Boden, wird es trocken?
Dann kommen Themen, hier Feature genannt, die auch für eine Gartenoma lesenswert sind: die Kletterstrategien der Pflanzen. Wenn ich das doch schon damals, vor Jahrzehnten gewusst hätte, wäre mir einige Pflanzen weniger eingegangen!
Es gibt Selbstklimmer, Schlinger und Ranker, die jeweils andere Rankhilfen brauchen. Selbstklimmer, wie Efeu und Parthenocissus können gedämmte Wände zerstören, weil sie aufgrund des negativen Phototropismus in kleine, auch dunkle Ritzen wachsen und damit Oberflächen zerstören.
Nun weiß ich auch, was ein Wärmedämmverbundsystem ist, eine Wärmebrücke, vor allem aber, dass es zu Dämm-Maßnahmen unbedingt eines Profis bedarf.
Sie hätten es lieber kleiner, dann ist „Beton raus, Leben rein“ oder „Fugen und Ritzen werden Lebensräume“ oder „Schottergärten beleben“ im Angebot. Viele Abbildungen, Bezugsadressen und weitere Tipps runden das empfehlenswerte Buch ab. Zum Schluss noch etwas Nachhaltiges: Wenn Du das Buch ausgelesen hast, dann vergiss es doch in der Bahn, damit ein anderer es lesen kann. Ich will meins aber lieber behalten!
Il libraio di Venezia
 Il libraio di Venezia. “Siamo tempre sul punto di mollarci, ma alla fine non ci molliamo mai. C’è qualcosa di profondo che ci lega.” Giovanni Montanaros siebter Roman spielt vor dem Hintergrund der großen Flut von 2019. Der Wasserstand in Venedig erreichte damals beinahe das bisher höchste Niveau von 1966: 187 cm. Nur mehr mehr 8 cm haben also zu einem neuen (negativen) Rekord gefehlt. Der große Unterschied: 2019 hätte das von Korruption und Skandalen seit 2003 in Bau befindliche MOSE die Stadt vor eben diesem Pegelstand schützen sollen.
Il libraio di Venezia. “Siamo tempre sul punto di mollarci, ma alla fine non ci molliamo mai. C’è qualcosa di profondo che ci lega.” Giovanni Montanaros siebter Roman spielt vor dem Hintergrund der großen Flut von 2019. Der Wasserstand in Venedig erreichte damals beinahe das bisher höchste Niveau von 1966: 187 cm. Nur mehr mehr 8 cm haben also zu einem neuen (negativen) Rekord gefehlt. Der große Unterschied: 2019 hätte das von Korruption und Skandalen seit 2003 in Bau befindliche MOSE die Stadt vor eben diesem Pegelstand schützen sollen.
MOSE + das Versagen der Politik
So erinnert der vorliegende Roman, eine Liebesgeschichte, also nicht nur an die schmerzlichen Versäumnisse der (italienischen) Politik, sondern auch an die des Protagonisten Vittorio, den Buchhändler. Denn Vittorio braucht die Fürsprache und Vermittlung der 86-jährigen Rosalba, der Erzählerin, um Sofia seine Liebe zu gestehen. Dazu sei hinzugefügt, dass der Altersunterschied zwischen beiden immerhin 20 Jahre beträgt. Aber abgesehen von diesem doch etwas obszönen und antiquierten Hindernis, ist der hier vorliegende Roman eine wunderschöne Huldigung an die Literatur und Venedig, vor allem aber an seine Bewohnerinnen und Bewohner. Ihrer “capacità di rinascere” ist es zu verdanken, dass es die einstige Hauptstadt der Welt überhaupt noch gibt. Denn ohne seine Bewohner wäre Venedig nicht mehr Venedig. Die einzigartige und wunderbarste Stadt der Welt wird heute nur mehr von 52.000 Menschen bewohnt und die Politik tut alles, um auch diese noch zu verscheuchen. Sie wollen aus jedem Haus ein Airbnb machen, um noch mehr aus der Schönheit herauszupressen. Vittorio soll plötzlich das Doppelte der Miete für sein “Moby Dick” bezahlen. Auch Rosalba schmerzt es jedesmal als ob es Krieg wäre, wenn wieder ein Geschäft einer Herberge weicht. Die Boote, die denn Müll von Venedig abholen, nennen sich tatsächlich “Le barche VERITAS“, also die “Schiffe der Wahrheit” und zeigen das nackte Elend unseres Planeten anschaulich: wir werden an unserem Müll und unserer Profitgier eingehen. Aber es gibt immer noch Nester des Widerstands. Als solche gelten auch Buchhandlungen. Denn neben der fiktiven Buchhandlung Moby Dick des Romans gibt es tatsächlich noch eine ganze Menge unabhängige Buchhandlungen in Venedig, Ulrike Zanatta, hat sie im Nachwort dankenswerterweise alle aufgelistet. “Il libraio di Venezia” ist also auch ein Buch über Literatur mit vielen Buchtips, nicht nur eine Liebesgeschichte und nicht nur ein Katastrophenroman. Und dass es am Ende ein Happy End für alle gibt, das mag man sich ebenso in der Realität wünschen. Eines Tages, wer weiß… Der Tag wird kommen!
Untergang + Auferstehung aus Acqua alta
Als Referenzwert für das Hochwasser wird seit 1897 übrigens das “medio mare” herangezogen, das sich in Punta della Salute, dem dreieckigen Bereich zwischen dem Canal Grande und dem Canale della Giudecca befindet. Je nach Sestiere resp. genauem Standpunkt, kann man durchschnittlich 80 cm vom bekannt gegebenen Pegelstand abziehen. Das bedeutet, wenn etwa 110cm (bei dem 12% Venedig unter Wasser steht) bekanntgegeben wird, steht man am Markusplatz, dem tiefsten Punkt Venedigs auf 80 Meter mit 30 cm kniehoch im Wasser. Bei 140 cm – der durchschnittliche Höchstwert – stehen dann schon 59% Venedigs unter Wasser. Das Modulo Sperimentale Elettromechanico (Mose) ist längst zu einem Symbol für “politische Gleichgültigkeit, Korruption und bürokratischen Wahnsinn” (Tagesspiegel) geworden. Zudem ist der ganze versenkte Beton inzwischen selbst zu einem Problem für die Lagune geworden, da der Boden deswegen weiter absinkt. Wenn die Katastrophe vom November 2019 eines gezeigt hat, dann, dass die Menschen immer noch zusammenstehen und sich nicht unterkriegen lassen. Das steht so auch im Eröffnungssatz dieser bescheidenen Rezension, die zeigen will, was Solidarität bewirken kann. Denn was wirklich zählt, das müssen die BewohnerInnen Venedigs nach jedem Hochwasseralarm immer wieder schmerzlich feststellen. Aber die Liebe zu Venedig ist stärker als jede Vernunft. Mai mollarare!
Giovanni Montanaro
Il libraio di Venezia
Ital. Hrsg. von Ulrike Zanatta
Niveau B1 (GER)
2022, Broschur, 165 S. 1 Abb.
ISBN: 978-3-15-014132-8
6,00 €
Reclam Verlag
Just because I love you
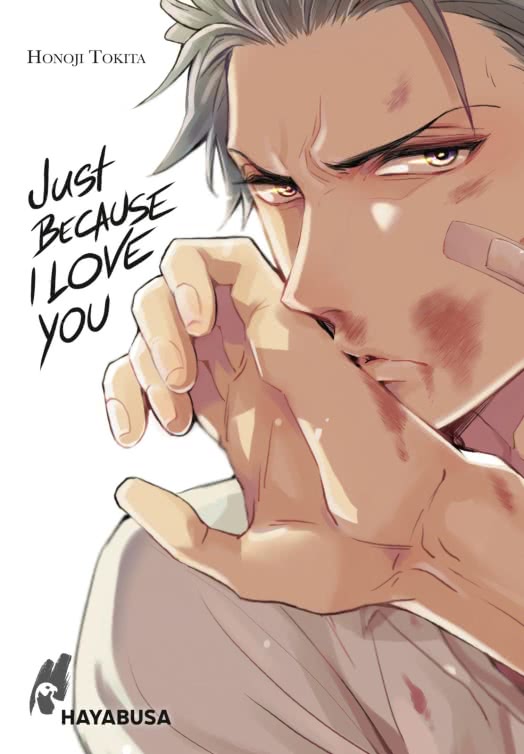 Rowdy trifft Schönling
Rowdy trifft Schönling
Auf Takeru Totoki trifft der Satz „Harte Schale, weicher Kern“ zu: Immer wieder in Raufereien verwickelt und deshalb als Rowdy gebrandmarkt, will er eigentlich nur ein normales Leben führen. Aber Takeru hat inzwischen keine Hoffnung mehr, dass er aus diesem Teufelskreis herauskommt – bis sich eines Tages Schulschönling Teo Yoshizawa nach einer Schlägerei um ihn kümmert. Ab diesem Zeitpunkt freunden sich die beiden unterschiedlichen Jungen immer mehr an und Takeru merkt, dass ihm der Kontakt mit dem beliebten Schüler guttut, denn er führt jetzt ein merklich ruhigeres Leben. Als Teo ihn auch noch für die Prüfungen in der Schule fit macht, erhält er zum ersten Mal in seinem Leben gute Noten. Alles läuft prima – aber was werden die anderen sagen, wenn sie merken, dass Takeru und Teo mittlerweile mehr sind als nur gute Freunde?
Klischees kritisch hinterfragt
Der BL-Manga (Boys-Love-Manga) thematisiert Homosexualität in einer eher beiläufigen Art. Die beiden Protagonisten verheimlichen zwar ihre Neigung und ihre Beziehung, aber sie machen sich ansonsten kaum Gedanken um ihre Homosexualität und leben sie einfach. Allerdings steht das im Widerspruch zur Wirklichkeit v.a. in Japan, in der Homosexualität tabuisiert wird und man sich deshalb automatisch viele Gedanken machen muss. Ansonsten aber ist gerade die Figur Takerus sehr schön herausgearbeitet: Durch seine körperliche Größe und sein eher wildes Aussehen wird er gleich in eine Schublade gesteckt, in die er von seinem liebenswürdigen Wesen her überhaupt nicht passt. Hier wird indirekt kritisiert, dass die Gesellschaft nur auf Äußerlichkeiten schaut und sich nicht die Mühe macht, hinter die Fassade zu blicken bzw. das Innere einer Person zu ergründen. Ausgerechnet der Schulschönling Teo, dem man aufgrund seiner Beliebtheit eher Oberflächlichkeit zutrauen würde (hier wird also ebenfalls mit Klischees gespielt), interessiert sich für die Person Takeru selbst und verurteilt Takeru nicht von vorneherein. Mit expliziten, aber nicht pornografischen Sex-Szenen. Der Verlag empfiehlt den Manga daher erst ab 18 Jahren, aber ich denke, ab 15 oder 16 Jahren ist das auch in Ordnung. Mich wundert sowieso, warum Gewaltszenen, die für die Psyche schädlicher sind, schon ab jungem Alter freigegeben werden, während einvernehmlicher Sex so tabuisiert wird. Da wirkt wohl noch die Leibfeindlichkeit der Kirche nach.
Lichte Stoffe
 Psychedelisches Palaver
Psychedelisches Palaver
Für ihren Roman «Lichte Stoffe» hat Larissa Boehning den hochdotierten Mara-Cassens-Preis als bestes deutschsprachiges Debüt des Jahres 2007 verliehen bekommen. Sie beschreibt darin die Suche einer jungen Frau nach dem Schlüssel für ihre eigene Herkunft und verwebt in ihrer Geschichte Themen wie Raubkunst, Besatzungskinder, deutsch-amerikanische Animositäten, Familien-Geheimnisse und persönliches Scheitern. «Geheimnisse sind der Motor zum Erzählen» hat die Autorin im ZEIT-Interview erklärt, ihre Figuren spiegelten einzeln das Hauptthema des Romans wider, «weil jede Figur ihre eigene Lüge mitbringt oder verarbeitet». Worauf sich der Buchtitel bezieht, erfahren wir in der Mitte des Buches, als die Protagonistin nach der Trennung von ihrem Mann sinniert: «Aber die Liebe? Lichter Stoff.»
Die Großmutter von Nele Niebuhr hatte nach dem Zweiten Weltkrieg einen farbigen GI kennen und lieben gelernt. Er war als Bewacher eines Lagerstollens für Nazi-Beutekunst zufällig in einer Nische auf ein rahmenloses Ölgemälde gestoßen und hat es heraus geschmuggelt. Das Bild von Degas zeigt eine Frau mit Hut, und da die Großmutter eine Hutmacherin war, hatte der Besatzungs-Soldat es ihr geschenkt. Als sie schwanger wurde, endete die Liaison mit dem Ami, sie gab ihm das Bild zurück, bevor er sich auf Nimmerwiedersehen davongemacht hat. Dieses Trauma, alleingelassen zu werden mit einem Mischlingskind, hat sie niemals überwunden, aber solange sie lebte hat sie auch nie darüber gesprochen. Eva, die Tochter der Alleinerziehenden, lebt mit ihrem Mann in einer Reihenhaus-Siedlung, sie ist konsumsüchtig und hat ständig Besuch vom Gerichtsvollzieher. Ihr Mann Bernhard wurde nach dreißig Jahren als Sicherheitschef einer Großbäckerei entlassen, von schnöseligen Unternehmens-Beratern einfach wegrationalisiert. Er traut sich nicht, das seiner Frau zu sagen, und geht jeden Morgen ‹zur Arbeit›, um den Schein zu wahren. Die inzwischen dreißigjährige Nele, Tochter der Beiden, ist in Chicago mit dem Verkaufsleiter eines Herstellers ausgeflippter Sportschuhe verheiratet. Sie steht vor den Trümmern ihrer Ehe und dem Ende ihrer Karriere als Designerin in der gleichen Firma. Nach dem Tod der Großmutter stößt sie auf Ton-Kassetten, auf denen die Oma von dem Degas-Gemälde erzählt, das inzwischen Millionen wert sein muss. Nele macht sich auf, diesem Familien-Mythos auf den Grund zu gehen, den verschollenen Großvater und das Bild zu finden.
Erzählerischer Rahmen des Romans ist ihr Rückflug nach Deutschland, sie hat einen älteren Herrn im Tweedsakko als Sitznachbarn, der sich in der Malerei auskennt und ihr viel zu erzählt weiß. Neles Besuch beim Großvater hat sich als Fiasko erwiesen, sie hatten sich nichts zu sagen, das Bild bei ihm an der Wand könnte allerdings tatsächlich der Degas sei. Mit dieser Beutekunst-Geschichte legt die Autorin eine falsche Fährte, wohl um Spannung zu erzeugen. In Wahrheit geht es ihr offensichtlich um andere Themen wie zum Beispiel das deutsch-amerikanische Verhältnis oder der Konsum-Fetischismus, den sie karikaturhaft übertreibend in der Turnschuh-Episode an den Pranger stellt. Und völlig unverständlich bleibt der Sinn einer Episode, in der Neles Vater Bernhard sich kurz entschlossen dem Nachbarn anschließt, als der sich für drei Wochen mit 100 Euro pro Tag bei Manövern als Darsteller einer feindlichen Zivilbevölkerung anheuern lässt. Wenig überzeigend sind vor allem die Animositäten den Amerikanern gegenüber, die hier recht schablonenhaft artikuliert werden.
Diese Geschichte vom Leben der Frauen dreier Generationen einer Familie, bei denen fast alles schiefgeht, wird in verschiedenen Rückblenden metaphernreich erzählt. Immer wieder artet allerdings die Erzählweise in ein psychedelisches Palaver aus, was schon bald ziemlich nervt. Man grübelt dann zum Beispiel, was unter «Zahnpastasuburbs» zu verstehen sei oder was denn ein «kaugummifadenzartes Streichorchester» für eine Musik zu erzeugen vermag.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Per Anhalter durch die Galaxis
EINE ETWAS ANDERE REZENSION
Viele der literaturaffinen Leser werden sofort wissen worum es sich handelt. Dabei ist 42 doch nur eine ganz gewöhnliche Zahl. Weder eine Primzahl noch eine Quadratzahl. Und doch hat sie eine ungewöhnliche Berühmtheit erlangt. Wer nichts damit anfangen kann, braucht die Zahl nur in Google eingeben oder einfach hier weiterlesen.
 Mein Sohn hat das Buch im Original, also in englischer Sprache gelesen und war begeistert. Obwohl ich nicht unbedingt ein Freund von Science-Fiction-Romanen bin, habe ich die Empfehlung aufgenommen. Allerdings wollte ich mir das Original nicht antun und besorgte mir die deutsche Ausgabe des bereits 1979 entstandenen Romans „Per Anhalter durch die Galaxis“ des britischen Autors Douglas Adams. Also ein Klassiker!
Mein Sohn hat das Buch im Original, also in englischer Sprache gelesen und war begeistert. Obwohl ich nicht unbedingt ein Freund von Science-Fiction-Romanen bin, habe ich die Empfehlung aufgenommen. Allerdings wollte ich mir das Original nicht antun und besorgte mir die deutsche Ausgabe des bereits 1979 entstandenen Romans „Per Anhalter durch die Galaxis“ des britischen Autors Douglas Adams. Also ein Klassiker!
Den Engländer Arthur Dent trifft es ziemlich hart: Zuerst soll sein Haus abgerissen werden und dann soll auch noch die Erde gesprengt werden, um einer Hyperraum-Expressroute Platz zu machen. Den Ausweg aus der Misere hat sein exzentrischer Freund Ford Prefect parat, der witzigerweise nach einem alten britischen Ford-Model benannt ist und ursprünglich von einem kleinen Stern in der Nähe von Beteigeuze stammt. Der Ausweg ist der in diesem Fall überlebensbringende Reiseführer „Per Anhalter durch die Galaxis“. Notgedrungen machen sie sich auf den Weg, um die Wunder des Weltraums zu entdecken. Bei Wikipedia wird das Buch als „Mischung aus Komödie, Satire und Science-Fiction“ beschrieben. Unbedingt lesenswert!
Wie komme ich nun gerade auf die Zahl 42? Auslöser war die Lektüre des Romans „Die Anomalie“ von Hervé le Tellier, worin die berühmte Episode um die Zahl 42 zitiert wird. Die beiden Protagonisten Dent und sein Freund dringen während ihrer Reise durch die Galaxis zum zweitgrößten Computer aller Zeiten vor, der von seinen Erschaffern zur Beantwortung der Frage aller Fragen programmiert wurde, die „große Frage des Lebens, des Universums und des ganzen Rests“ (“life, the universe and everything”). Um das unglaublich wichtige Ergebnis ja nicht zu verpassen, wurde der Computer „Deep Thought“ rund um die Uhr observiert und das über siebeneinhalb Millionen Jahre. Nach dieser exorbitanten Rechenzeit gibt er endlich die Antwort bekannt. Die Antwort auf die „Frage des Lebens, des Universums und des ganzen Rests“ lautete zur Überraschung aller ganz simpel „42“. Trotz intensiver Bemühungen verschloss sie sich jeglicher Interpretationsmöglichkeit.
Als ich das Zitat in Telliers Roman las, das dort übrigens sehr gut verpackt wurde, war ich etwas konsterniert, weil ich es nicht auch schon in meinem etwas anderen biografischen Roman „August und ich“ verwendet habe. Er ist zwar schon mit mehreren Zitaten aus der Musik, Literatur und Cineastik versehen, doch die zugehörige Episode aus meinem Leben ist mir damals nicht eingefallen.
Denn in meiner Zeit als Technischer Leiter in einem mittelständigen Unternehmen hatte ich in der Entwicklungsabteilung einen der besten Ingenieure, den ich je kennenlernen durfte. Martin ist nicht nur in seinem technischen Metier brillant, sondern ich konnte mich insbesondere auch über kulturelle Themen mit ihm austauschen: ob Musik oder Kabarett und eben auch Literatur. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass er „Per Anhalter durch die Galaxis“ bereits kannte, als ich ihm eine entsprechende Empfehlung aussprechen wollte. Und natürlich war ihm die Zahl „42“ ein Begriff.
Immer wieder, wenn wir gemeinsam mit Managern zu tun hatten, die gerne dazu neigen, auf sehr komplizierte und schwierige Fragen einfache Antworten zu fordern, sahen wir uns an und entgegneten ganz ernsthaft und im Chor: „42“.
Das Polykrates-Syndrom

Der ungewöhnlich vielseitige österreichische Schriftsteller, Essayist und Dramatiker Antonio Fian, Meister der kleinen Form, hat 2014 mit «Das Polykrates-Syndrom» nach 22 Jahren seinen zweiten Roman veröffentlicht. Er wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und war 2019 Basis für den Spielfilm ‹Glück gehabt›. Der Titel des ursprünglich als Drehbuch geplanten Romans weist auf den Tyrannen von Samos hin, von dem Herodot überliefert hat, er habe in seinem Leben so viel Glück gehabt, dass er am Ende einen grausamen Tod sterben musste. Schiller thematisiert dies in seiner berühmten Ballade mit der idealisierenden These, je größer das Glück, desto tiefer ist der nachfolgende Absturz. Im Roman nun erlebt ein junges Ehepaar, wie über ihren wohlgeordneten Alltag schicksalhaft ein schreckliches Geschehen hereinbricht.
Der weder ehrgeizige noch anspruchsvolle Historiker Artur jobbt in einem Wiener Kopierzentrum, verdient sich zusätzlich Geld mit Nachhilfestunden und schreibt nebenbei ziemlich platte Sketche, die keine Sendeanstalt haben will. Seine Frau Rita hingegen ist als Lehrerin auf der Erfolgsspur und hat gute Aussichten, schon in wenigen Jahren die jüngste Direktorin einer Wiener Schule zu werden. Als Ich-Erzähler schildert Artur detailreich und mit köstlichem Humor, wie er in seiner monotonen Ehe häufigen Vorwürfen durch seine burschikose Frau ausgesetzt ist. Der sympathische Schluffi erträgt all das aber äußerst gelassen, er kennt ihre Psyche und weiß immer im Voraus, womit sie ihn nun wieder gängeln wird. Aber die beiden wissen sehr wohl auch, was sie aneinander haben, und so findet zu guter Letzt denn auch regelmäßig eine Versöhnung im Bett statt. Mit dem Besuch einer attraktiven jungen Frau im Copyshop kurz vor Ladenschluss beginnt für den sympathischen Protagonisten Artur ein aufregendes Abenteuer, welches sich im Verlauf der Handlung zu einem wahren Höllenritt entwickelt.
Der in den 1990er Jahren angesiedelte Plot hat die Zäsur in Arturs Leben zum Thema, schicksalhaft heraufbeschworen durch das Zusammentreffen mit der hübschen Alice. Denn eher harmlos als draufgängerisch veranlagt, steigt der brave Langeweiler nun plötzlich dieser geheimnisvollen Frau nach, einzig beseelt von dem Wunsch, sie ins Bett zu bekommen. Was ihm schließlich auch gelingt, sein erster Fehltritt nach mehr als zehnjähriger Ehe. Dieser für ihn überraschende Ausbruchsversuch krempelt sein ganzes Leben um und entwickelt sich zum Alptraum. «In der kurzen Zeit, in der ich Alice kannte, hatte ich mich völlig verändert. Ich betrog meine Frau, belog meine Mutter, leistete Beihilfe zum Diebstahl, schaffte Leichen weg und hatte keinen anderen Gedanken, als dass Alice bald wieder mit mir schlafen würde». Die zunächst harmlos dahinplätschernde Geschichte wird zunehmend spannender und absurder und endet sehr gekonnt, – überraschend, aber völlig unspektakulär.
Diese mit viel schwarzem Humor locker erzählte Geschichte ist als Parodie auf einen Ehebruch konzipiert, der durch seine drastischen Details satirisch kräftig überhöht wird und in einigen Horror-Szenen einem Splatter-Roman gleichkommt. Besonders gelungen und immer wieder zum Schmunzeln, aber auch zum lauten Lachen anregend sind die pointiert angelegten, schlagfertigen Dialoge, die als verbale Fechtkunst mit ihren geistreichen Wortattacken geradezu lustvoll ausgefochten werden. Das anschaulich geschilderte Wiener Lokalkolorit bereichert wirkungsvoll diesen gut durchdachten Totentanz, der als Mischung aus Grauen und Humor auffallend nüchtern erzählt wird. So wenn zum Beispiel über Arturs Versicherungen berichtet wird, dass er sie nur abschließe, weil er meint, dann würde ja ganz im Sinne der Assekuranz wahrscheinlich niemals mehr etwas passieren. Und was genau denn Sex in Eichhörnchen-Stellung ist, darüber lässt der Autor den Leser listig im Dunkeln. In dieser burlesken Story wird lakonisch Pointe auf Pointe abgefeuert, Antonio Fian lotet gewissermaßen die Grenzen seiner abgründigen Geschichte bis zur Neige aus.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Beinahe Alaska

Die Ich-Erzählerin ist unglücklich. Sie hat mehrere Schicksalsschläge hinter sich. Sie geht auf eine so genannte Expeditionskreuzfahrt und setzt sich ihren Mitreisenden aus. Die sind alt und krank, wie George, der nach drei Schlaganfällen am Stock geht und von seiner steinernen Gattin Agnes gemanagt wird. Oder sie sind herrisch-zappelig, wie die rothaarige Österreicherin, absolut nichtssagend, wie ein Mutter-Tochter-Gespann aus Deutschland oder weltgewandt-weise, wie der mit feiner Ironie gesegnete Herr Mücke. Und da ist auch der Journalist Lewis, der seine eigene Zeitbombe mit sich herumträgt.
Es menschelt an Bord, während die MS Svalbard ihre geplante Route in Angriff nimmt: “… von der Südspitze Grönlands nach Norden (…) bis zur Diskobucht, dann westwärts über den Atlantik und durch das arktische Labyrinth der kanadischen Küste bis nach Alaska.” Einhundert Passagiere auf einer umgebauten Autofähre, die Reise soll zweieinhalb Wochen dauern. Der Alltag an Bord besteht aus den Mahlzeiten, die die menschenscheue Ich-Erzählerin manchmal schwänzt, unvermeidlichen, dann auch wieder überraschenden Gesprächen, Vorträgen, Landausflügen. Zwischendurch hilft nur ein langer Blick aufs Meer, doch sogar dieses Schauen aufs Wasser will gelernt sein (freundlicher Hinweis von Herrn Mücke). Obwohl es schmerzt, lässt sich die Ich-Erzählerin auf die Geschichten einzelner Einheimischer ein, denen sie in Labrador bei Stippvisiten an Land begegnet: im heruntergekommenen Hopedale – hier leben hauptsächlich Inuit – oder im schöneren Makkovik, wo vor allem Norwegischstämmige angesiedelt sind.
Die Geister vergangener Arktis-Expeditionen sind natürlich mit von der Partie – Amundsen, Franklin, Wegener. Ausgehend von deren Leiden und Fährnissen stellt sich für die irritierte Ich-Erzählerin die Frage: “Warum waren die Menschen immer und immer wieder in die Arktis gefahren, auch nachdem längst bekannt war, dass die Seewege nicht wirtschaftlich sein würden? Die Expeditionen kosteten ein Heidengeld. Ein Schiff nach dem anderen ging verloren.” Und daraus folgend die beinahe ebenso oft wie der Blick aufs Meer wiederholte Selbsterforschung: “Was will ich eigentlich hier?”
Offiziell reist die Ich-Erzählerin im Auftrag ihrer Verlegerin, sie soll Arktis-Feeling einfangen. Also photographiert sie den Himmel in all seinen phantastischen Verwandlungen, das Wasser, den Boden, dessen angepasste Vegetation in der Arktis als Wald durchgeht. Sie notiert und malt. In seelischer Hinsicht nutzt sie die Kreuzfahrt – im Grunde eine teurere Variante der Busgruppenreise – um sich im Nachvorneschauen zu üben. Wie die pflegende Agnes ist sie lange “im Zug des Lebens mit dem Rücken zur Fahrtrichtung” gesessen.
Das Schiff wird ihr Trainingscamp: unmöglich, sich hier allem und allen zu entziehen, keine Chance, hier die Einsiedlerin spielen zu dürfen. Gehst du nicht zu den Menschen, dann kommen sie zu dir. Dein einsames Herumsitzen, zumal als Frau, wird nachgerade als Aufforderung zur Kommunikation gedeutet. Die betuchte Französin Edith, zum Beispiel, gibt der Ich-Erzählerin reichlich von ihrer Erfahrung mit verheirateten Männern mit auf den Weg. Am Tisch im Speiseraum bekommt es unsere Reisende mit der hyperaktiven, notorisch nörgelnden Influencerin Karen Peng aus China zu tun. Und schließlich sind da die an ADHS leidenden Outdoor-Menschen, stets bereit, in ihren Windjacken “wie orange Blattläuse” arktische Waldvegetation niederzutrampeln, um als erste auf einem Ausflugsgipfel, an einer Ausgrabungsstätte oder wieder im Tenderboot zu sein. Im Bus buhen sie einen aus, falls man zu spät kommt.
Als dann der hohe Norden anfängt, die gewohnten Rhythmen durcheinander zu wirbeln – Körper, Schlaf, Handys – liegt der allgemeine Abenteuergeist darnieder. Auch Tiere haben sich, entgegen allen Verheißungen der Veranstalter, nicht gezeigt: nur einmal ein verwaschener Eisbär in der Ferne, ein andermal ein brauner Pelzhintern. Den Polarfuchs hören die Passagiere höchstens in ihren Träumen bellen.
Und dann ereignet sich das Skandalon schlechthin für Geltungs- und Servicekonsument*innen: Es. Wird. Nicht. Geliefert. Die Prophezeiung im Buchtitel erfüllt sich – die zu durchquerende Bellotstraße ist vereist, die MS Svalbard wird Alaska nicht erreichen. Während das Schiff wendet und wieder Richtung Süden fährt, hat sich den Enttäuschten bereits ein Anwalt empfohlen. Das ist kein Spoiler, denn – wie gesagt – diese Wendung wird im Buchtitel angedeutet und im Text vorbereitet. Als klar wird, dass die Reise mit dieser Antiklimax zu Ende geht, hat das für die Ich-Erzählerin eigentlich schon keine Bedeutung mehr. Anders als der Blick aufs Meer.
Arezu Weitholz ist Journalistin und Textdichterin u.a. für Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Udo Lindenberg und 2raumwohnung. “Beinahe Alaska” ist ihre erste längere literarische Veröffentlichung. Bei diesem Text haben wir es mit einer selten gewordenen Form von Alltagsrealismus zu tun, im besten Sinne gemeint; die emotionale Färbung stimmt, keine große Fanfare, es werden genau die Noten gespielt, die es braucht. In den Beschreibungen von Wetter, Meer, Natur zeigt sich das Auge der visuellen Künstlerin, die Arezu Weitholz auch ist.
Anton Cechov hat mal geschrieben: “Die Leute gehen nicht zum Nordpol. Sie gehen ins Büro, streiten sich mit ihrer Frau und essen Suppe!” Arezu Weitholz widerlegt in “Beinahe Alaska” Cechovs ersten Satz – die Leute streben sehr wohl zum Pol, sie versuchen es zumindest – aber sie zeigt auch, dass sie es genau in Stimmung und Modus von Cechovs zweitem Satz tun: also im Grunde ohne das eigene Wohnzimmer zu verlassen. Leidvolle Momente, zumal jene aus der Vergangenheit der Ich-Erzählerin, werden nicht unmäßig aufgeladen. Wir folgen ihrem niedergeschlagenen, irritierten, dann wieder hellauf begeisterten Blick. Zusammen mit ihr lernen wir (oder dürfen uns daran erinnern), dass man unweigerlich auf Leiden stoßen wird, sowie man sich dazu entscheidet, den Small Talk zu unterlaufen und einem anderen Menschen wirklich zu begegnen. Und dass das immer auch ein Risiko birgt.
Die vom Leben gebeutelte Ich-Erzählerin macht eine Entwicklung durch. Wie Ursus mit dem Bullen steckt sie zunächst noch verbissen fest in einem SloMo-Ringkampf mit der Welt. Doch zu reisen heißt, sich zu bewegen, und das ist gut gegen quälende Blockaden. Die in mehreren Abwandlungen gestellte Frage, warum denn so viele in den Norden fahren, wird auf jeden Fall beantwortet. Sie wird nicht ausformuliert, aber die Antwort steckt im Buch. Eher in seinen weißen Bereichen.
Als WIR das Wunder waren
 Jede Generation hat ihre Helden, ihre Idole und ihre Musik. Waren es bei den Achtundsechzigern die Beat-Musik, die Flower-Power-Revolution, die Hippie-Bewegung und der Aufstand gegen den Muff der Nazizeit, so war das in den Achtzigerjahren bereits völlig anders. Weiterlesen
Jede Generation hat ihre Helden, ihre Idole und ihre Musik. Waren es bei den Achtundsechzigern die Beat-Musik, die Flower-Power-Revolution, die Hippie-Bewegung und der Aufstand gegen den Muff der Nazizeit, so war das in den Achtzigerjahren bereits völlig anders. Weiterlesen
Miss Bohemia
 Roman im Roman
Roman im Roman
Letzter Teil der Berlin-Trilogie von Mathias Nolte ist der Roman «Miss Bohemia», der, vom Feuilleton weitgehend ignoriert, in der Leserschaft eine einhellig positive Aufnahme fand. Zweifellos handelt er sich um grandiose Unterhaltungs-Literatur mit einer schon im Buchtitel anklingenden, verheißungsvollen Thematik. Es geht um eine wahrhaft unkonventionelle, schöne junge Frau, die als Femme fatale bei den Männern allerlei Verheerungen anrichtet. Wobei es sich bei den Männern um Schriftsteller handelt, was ja Literatur affine Leser per se schon mal neugierig macht.
«Ich hatte mir geschworen, nie wieder einen Gedanken an Tara zu verschwenden», lautet der erste Satz. Der Ich-Erzähler Lukas, ein mittelmäßiger Roman-Schriftsteller, entdeckt in der New York Times eine Meldung, die über den Tod des bekannten Schriftstellers Philipp Bach berichtet. Auf dem Foto von der Verteilung seiner Asche im Meer erkennt er Tara. Lukas hatte sich vor zwei Jahren für seinen neuen Roman ein Ferienhaus auf Key West gemietet, um in Ruhe arbeiten zu können. Überraschend hatte ihn dort sein erfolgreicher Kollege Philipp Bach besucht, zusammen mit seiner wesentlich jüngeren Freundin und Muse. In Rückblenden erzählt Lukas, wie ihn schon am ersten Morgen die attraktive Tara zu einem Strandausflug überredet hat, um dort den Sonnenaufgang zu erleben, ihr Lover hat noch tief geschlafen. Und an dem menschenleeren Strand hat sie Lukas dann auch verführt, – sie war die Aktive, er wusste gar nicht, wie ihm geschah.
In einem raffinierten Konstrukt entwickelt Matthias Nolte auf verschiedenen Zeitebenen seinen Plot um eine Menage à trois im Schriftsteller-Milieu. Tara hat ihre Examens-Arbeit über den hoch dekorierten DDR-Schriftsteller Franz Krohn geschrieben, und der wiederum war Mentor von Philipp Bach. Kurz nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann hat Krohn über seine guten Beziehungen zur Staatsführung Bach sogar zur Flucht in den Westen verholfen. Dort hat Bach dann mit «Miss Bohemia» seinen äußerst erfolgreichen Debütroman veröffentlicht. In häufigen, durch die Kapitel-Überschriften aber deutlich zugeordneten Zeitsprüngen erzählt Matthias Nolte seine Geschichte mit mehreren, kunstvoll verflochtenen Handlungs-Strängen. Seine drei Protagonisten sind sehr eigenwillige Typen. Der dem Autor biografisch ähnelnde Lukas ist ein ewiger Zweifler, der fast alles geduldig hinnimmt, von dem man ansonsten aber wenig erfährt. Er arbeitet an dem Roman, den wir in Händen halten, und lässt den Leser an seinen Recherchen und am Schreibprozess teilhaben, eine reizvolle ‹Roman im Roman›-Konstellation. Freund und Nebenbuhler Philipp Bach ist ein überheblicher, unsympathischer und cholerisch veranlagter Schriftsteller, der ein dunkles Geheimnis birgt. Nach seinem Debüt schreibt er nun seit vielen Jahren an dem gigantischen Werk «Der Roman des Jahrhunderts». Tara ist eine selbstbewusste, schlagfertige und lebenskluge Frau, die besonders im unkonventionellen Umgang mit ihrer Sexualität verblüfft und es im Übrigen mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Von Lukas nach ihren bisherigen festen Freunden gefragt, erklärt sie ihm beispielsweise, es gab bisher nur einen: «Nach Johnny kam nichts Festes mehr, nein. Nach ihm habe ich à la carte gelebt». Auf seine verblüffte Nachfrage ergänzt sie: «Oder glaubst du, nur weil ich nicht den richtigen Kerl gefunden habe, […] habe ich mich in Verzicht geübt? Ich gebe meinem Körper, was ihm gut tut, und er dankt es mir jeden Tag».
Dieser aufregende Roman ist schwungvoll erzählt, wobei die Ironie darin unübersehbar ist. Trotz des nicht unbeträchtlichen Wirrwarrs, das die Geschichte mit ihren vielen Andeutungen erzeugt, folgt man ihr gerne, zumal die Spannung immer mehr steigt, was denn nun hinter all dem steckt. Übertrieben hat es Mathias Nolte allerdings mit den vielen Zufällen, auf denen sein Plot aufbaut. Überzeugend und angesichts der trickreichen Verflechtungen hilfreich ist, dass er das Erzählte häufig rekapituliert. Und nicht wenige Leser dürften sich zudem an der üppigen Intertextualität erfreuen.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Das Schlupfloch
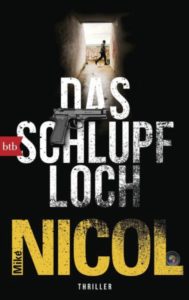
Bei vielen Aufenthalten an diversesten Orten dieser Welt hat es sich für mich als netten Einstieg ins Lokalkolorit erwiesen, ein Buch eines Schriftstellers aus der Region zu lesen. Man erfährt viel über die Kultur, die Denke, den sprachlichen Slang und bekommt nebenher manchmal auch Tipps für angesagte Cafés, gute Restaurants und aktuelle In-Locations. Besonders eignen sich Krimis mit ihren meist rasch wechselnden Schauplätzen. So auch die Intention bei Mike Nicols Roman „Das Schlupfloch“. Nicol lebt in Kapstadt und gilt sogar international als zunehmend beachteter Autor im Genre Kriminalromane. Weiterlesen
Vernichten
 In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.
In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.
Es kommen präzise Betrachtungen der Politik, die manchmal prophetisch erscheinen. Hier geht es um Bruno Juge, dem Wirtschaftsminister und seinen Vertrauten, Paul Raison, beide Absolventen der Grandes Ecoles, Bruno (Richter, wie wir auf Deutsch sagen würden) kommt von der Polytechnique und Paul (Recht, oder Vernunft) von der Verwaltungsuni. Die gute Arbeitsbeziehung wurde zur Männerfreundschaft in einer Hotelbar in Addis Abeba, wo Bruno stolz ist, wieder einige Atomkraftwerke vermittelt zu haben, aber dann klagt, er hätte mit seiner Frau seit 6 Monaten nicht mehr Liebe gemacht. Paul könnte berichten, dass es beim ihm schon an die zehn Jahre sind.
Zurück in Paris im Jahr 2027 sind Wahlkampfzeiten, es wird von einer Profiwerbefrau die Wahlkampagne designed, Bruno soll als Kandidat fit gemacht werden, er ist anerkannt, aber nicht beliebt. Er bekommt die junge Raksaneh als persönlichen Coach zugeteilt, die in seiner Dienstwohnung ein Laufband aufstellt und ihn Episches von Corneille zitieren lässt, beides hilft seinem Auftreten: “er strotzt vor Energie“. Später wird er dann doch nicht Präsidentschaftskandidat, für den Spannungsbogen ist das aber nicht mehr von Bedeutung.
Wichtiger ist die Serie von erst virtuellen, dann realen Sabotageaktivitäten. Im Netz kommen unverständliche geometrische Zeichen, die auch im Buch aufgemalt sind, und dann ein Video, indem Bruno von einer Guillotine, auch aufgemalt, geköpft wird. Das ist ein Fall für die DGSI (Direction générale de la sécurité en France) wo Pauls Vater früher eine Rolle gespielt hatte. Es werden Geheimdienstler und andere Spezialisten dazu befragt, wer könnte so etwas machen? Primzahlen spielen eine Rolle, Schiffe gesenkt, eine Samenbank in Dänemark wird zerstört, warum machen Menschen so etwas? Nachfolger des Unabombers? Ultralinke oder fundamental Katholische, später spricht manches für Satanisches. Geschmückt werden die Informationen über das Vernichtende von Werbung für sexy Miederwaren…
Als Kind der deutsch-französischen Freundschaft warte ich gerne auf seine kurzen Blicke nach Deutschland: Hier ist es, passend zum verstörenden „Vernichten“, der Alte Fritz, der Menschen als eine verdorbene Rasse (race méchante) bezeichnete, und sich dann mit seinen geliebten Windspielen beerdigen ließ.
Das ist so treffend ausgemalt, wie wir es von Houellebecq kennen, und dann kommt Neues, es menschelt. Pauls Vater liegt nach einem Schlaganfall im Koma, die Familie ist gefragt. Die kleine Schwester Cécile übernimmt das Kommando, sie unterstützt Madeleine, die Gefährtin des Vaters, die erst die Pflegehelferin und dann Geliebte des Witwers wurde. Cécile ist Hausfrau, streng katholisch, ihr Mann Hervé unterstützt sie, wenn es schwierig wird, kann er sich Hilfe bei seinen Freunden, den Identitären, holen. Pauls Vater erholt sich und ist dank Madeleine gut versorgt, aber das Elend der anderen Bewohner wird deutlich. Wie in Deutschland auch, werden die Seniorenwohnheime von Gewinn orientierten Ketten betrieben.
Vielleicht ist es dem Zusammensein mit seinen Geschwistern geschuldet, Paul möchte seine Beziehung zu seiner Frau Prudence wiederbeleben. Sie teilen zwar die Traumwohnung, mit Blick auf den Parc Bercy, jedenfalls so lange wie sie sie noch abbezahlen. Sonst gehen sie sich aus dem Weg. Angefangen hat es damit, dass Prudence ihn zum Vegetarier machen wollte, und seine Mahlzeiten, die er im gemeinsamen Kühlschrank lagern wollte, gar weggeschmissen hatte, vor vielen Jahren.
Aber, was tun? Ob er überhaupt noch Liebe machen kann? Er scheut keine Mühen, es wieder zu erlernen und leistet sich eine Edelprostituierte im 16. Arrondissement, deren Spezialität der Blow Job ist. Es geht noch!
Und kurz danach klappt es wieder, sie vögeln dann täglich und Paul erzählt uns seine Vorlieben (seitlich), Prudence, die er schon als „asexuell und vegan“ geschimpft hatte, entwickelt sich zu seiner und auch ihrer Zufriedenheit.
Dann bekommt Paul Mundhöhlenkrebs. Er beschreibt kenntnisreich die zu absolvierende Diagnostik, nimmt seine Diagnose gefasst auf, durchläuft die aufklärenden und beratenden Gespräche, wägt Strahlentherapie, Chemo und/oder Operation ab. Mit den üblichen Leitfäden, die zur seelischen Bewältigung empfohlen werden, kann er nichts anfangen. Er träumt dystopisches, so wie immer in seinem Leben, wenn es schwierig wird. Oft hilft ihm ein Spruch von Blaise Pascal, Philosophie ist nicht sein Ding, er hat mal ausgerechnet, dass er sich weniger als 2 Jahre mit ihr befasst hatte, damals, zum Abitur.
Ist Houellebecq nun altersmilde, hat er die Bedeutung von Frauen entdeckt? Sie sind tatkräftig, stehen ihren Mann, natürlich gibt es auch Schlampen, Schwägerin Indy etwa, die feministische, erfolglose Journalistin, oder die Gewerkschafterin im Altersheim, die die Versorgung von Pauls Vater schwierig macht. Aber Madeleine, Cécile, Prudence und auch deren Schwester, die aus Kanada zurück nach Frankreich zieht, um den verwitweten Vater zu versorgen, füllen ihre Rollen. Und mit Cécile kann man sogar über Glaubensfragen sprechen!
Mehrere hundert Seiten lang glaubte ich, dass Houellebecq an seinem Frauenbild gearbeitet hätte, bis ich den Bechdel Test machte: Er dient der Bewertung von Filmen, zur Frage, ob im Film mindestens zwei Frauen ein vernünftiges Gespräch führen, und in dem es nicht um Männer geht.
Im Buch sprechen die Frauen darüber, wie sie die kranken und alternden Männer versorgen können. Das Schicksal hat es ja so gewollt, dass Pauls und Prudences Väter Witwer wurden, und Prudence es bald sein wird. Als die Krankheit fortschreitet, sind Sabotageakte, oder gar die Präsidentschaftswahl kein Thema mehr. Es geht darum, trotz der Einschränkung gut zu vögeln. Und, der Zufall will es, Bruno und Raksaneh tun es inzwischen auch.
Auch in seiner Danksagung regt er an, Schriftsteller sollten mehr Recherchearbeit leisten. Neben Ärzten, die ihn zu den behandelten Themen beraten hatten, wird eine Frau hervorgehoben, die selbstlos ihren kranken Mann pflegt.
Den Übersetzern gelingt es, den Ton zu treffen, mit dem Houellebecq sein erotisches Begehren zum alltäglichen Anliegen macht.
Ich bin schon gespannt auf den nächsten Houellebecq. Wie der Schlingel es doch immer schafft, selbst mich alte weiße Frau zu überraschen!
Hoffen und Scheitern
 Hoffen und Scheitern
Hoffen und Scheitern
Unter dem Titel «Vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen» hat die Schriftstellerin Janine Adomeit ihren Debütroman geschrieben, er handelt von den Hoffungen von Menschen am Rande der Gesellschaft. Der in der Jetztzeit angesiedelte Plot beschreibt die neu aufkeimende Hoffnung einer herunter gekommenen, kleinen Gemeinde an der Ahr, zum einstigen Wohlstand als Ort einer Heilquelle zurückzufinden, aus der speziellen Sicht der sogenannten kleinen Leute.
Die etwa 5000 Einwohner von Villrath haben bessere Zeiten erlebt, ihre Kleinstadt war einst das Tor zum Ahrtal, hatte mit ihrer Heilquelle viele Touristen angezogen und 1987 sogar einen Preis für die schönste Innenstadt erhalten. Durch ein Erdbeben ist diese Quelle aber vor 17 Jahren versiegt, seither liegt die Gemeinde im Dornröschenschlaf und verkommt zusehends. Die Politiker waren untätig, man hatte die Stadt schlicht vergessen. Thematik des Romans ist die Hoffung, die in der Bevölkerung nach dem langen wirtschaftlichen Niedergang aufkeimt, als im Wald bei Bauarbeiten für eine neue Bahntrasse urplötzlich wieder eine neue Quelle aufbricht. Geschildert werden diese Erwartungen am Beispiel verschiedener Protagonisten, die ganz unterschiedlich betroffen sind von den neuen Möglichkeiten, die sich nun ergeben.
Da ist etwa die ehemalige Friseuse Vera, aus deren Perspektive zu weiten Teilen erzählt wird. Als Wirtin einer wüsten Kneipe trinkt sie selbst gerne, unter anderem auch, weil sie mit ihrem übergewichtigen, nichtsnutzigen Sohn Johannes große Probleme hat. Sie träumt davon, das marode Haus samt schlechtgehender Kneipe zu verkaufen und den örtlichen Frisiersalon zu übernehmen. Ein Investor sucht alte Häuser wie ihres und will auch das ehemalige Kurhaus erwerben und zu einem Hotel mit ländlichem Charakter ausbauen. Um die Quelle zu erhalten müsste aber die bereits fertig geplante Bahntrasse verlegt werden, wofür die Gemeinde die Kosten zu übernehmen hätte. Das wiederum wäre aber nur durch den Verkauf des Kurhauses zu finanzieren, an dem aber hängen nun mal viele nostalgisch empfindende, aber einflussreiche Alte in der Gemeinde, – ein schwer zu lösendes Dilemma für den Bürgermeister. Der 16jährige Johannes ist ein grottenschlechter Schüler, der sich als Hilfskraft eines, wie sich herausstellt kriminellen Schrottsammlers Geld dazuverdient und von einem eigenen Motorrad träumt. Dritter Protagonist der Geschichte ist der 80jährige Kamps, ein ehemaliger Schlossermeister, der nach dem Tod seiner Frau immer neue, herum streunende Katzen bei sich aufnimmt, etwa dreißig sind es inzwischen. Er führt einen erbitterten Kampf mit der Gemeinde, weil er die zunehmende Vermüllung insbesondere des Friedhofs, aber auch der Straßen nicht akzeptieren will, und die häufigen Einbrüche ebenso. Er ist entschlossen, selbst gegen die Einbrecher vorzugehen und lässt sich sein im Schützenhaus deponiertes Gewehr unter dem Vorwand aushändigen, dass er es verkaufen will.
«Es war zu warm für die Jahreszeit, auch sonst stimmte nichts» lautet lapidar der erste Satz. Der Roman wird in einer dem geschilderten Milieu stimmig angepassten Alltags-Sprache erzählt, wobei die Autorin ihre verschiedenen Handlungsstränge immer wieder geschickt zusammenführt. Auch der Umweltschutz fehlt übrigens nicht, verkörpert einerseits von dem Saubermann Kamps, aber vor allem durch einen Trupp von Aktivisten, die im Wald ein Protestcamp errichtet haben, um den drohenden Kahlschlag des Waldes durch die Bahn zu verhindern. Symbolisch für das Hoffen und Scheitern steht hier die Quelle. Durch ihre distanzierte Erzählweise lässt Janine Adomeit allerdings keinerlei Empathie beim Leser aufkommen für ihre schrulligen Figuren. Mit Sicherheit aber ist ihre Geschichte auch entschieden zu lang geraten, man quält sich als Leser teilweise durch die geschilderten Banalitäten des Alltags in dem Kaff namens Villrath. In Anbetracht dessen wirkt der überraschende Countdown mit einer Feuerwehr-Sirene im Hintergrund schlussendlich denn doch ziemlich aufgesetzt.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de