Zitate zum 8. März (Weltfrauentag)
„Frauen leisten zwei Drittel der Arbeitsstunden, haben ein Zehntel des Einkommens und ein Hundertstel des Eigentums auf der Welt.“ Monika Griefahn
„Einer Frau steht Mut immer gut.“ Antonia Rados
„Ich kann die Stelle in der Bibel einfach nicht finden, in der Gott der Frau die Gleichberechtigung abspricht.“ (Sarah Moore Grimké, geb. 1792)
Spuren von Frauen?
“Wenn wir nun nach konkreten Zeugnissen oder wenigstens Spuren von Frauen suchen, dann erleben wir die Enttäuschung, daß selbst in den ausführlichen und farbigen Schilderungen des Speyerer Reichstages Frauen gar nicht vorkommen. Aber auch die wenigen Kirchenbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die durch die vielfältigen Kriegswirren und Fluchtbewegungen hindurch gerettet werden konnten, bieten nur spärliche Hinweise auf Frauen.” (S. 109)
„Da sind schon wieder keine Frauen drin!“
„Da sind schon wieder keine Frauen drin!“, empörte sich Frauenbeauftragte Friederike Ebli, als sie die neueste Ausgabe der Speyerer Geschichte in Händen hielt. Also beschloss sie, eine eigene Geschichte der Frauen der Stadt Speyer zum Jubiläumsjahr Speyers herauszugeben. Dafür stellte die Stadt aber wenig bis keine Unterstützung bereit, also musste Ebli sehen, wie sie das Projekt auf die Beine stellte und finanzierte. Sie wandte sich also an kompetente Frauen wie Archivarinnen, um die Speyerer Geschichte nach berühmten Frauen und überhaupt nach Frauengeschichte zu durchforsten – und sie wurde fündig. Außerdem arrangierte sie Treffen, an denen an dem Projekt interessierte Frauen teilnehmen konnten. Das erste schon war ein voller Erfolg, denn es kamen viele Frauen von z.T. sehr unterschiedlicher Herkunft und Profession, darunter viele Schwestern, die sagten: „Wir sind auch Frauen!“ Später sind sie zu einem beachtlichen Teil im Buch vertreten und zeigen auf, was die religiösen Frauen für eine tiefgehende nicht nur soziale Wirkung in ihrem Einzugsbereich hatten. Es waren auch Frauen dabei, die aufgrund ihres Berufes Korrektur gelesen oder lektoriert haben und auch sonst ehrenamtlich zu dem Buch beitrugen. Das Cover entwarfen Schülerinnen des Edith-Stein-Gymnasiums im Kunstunterricht. Es zeigt neben dem Zeichen für Weiblichkeit die Krone von Kaiserin Gisela, Gattin von Kaiser Konrad II. – der im Gegensatz zu seiner Frau nicht lesen und schreiben konnte (vgl. u.a. https://www.speyer.de/de/familie-und-soziales/frauen/historische-frauenspuren-in-speyer/kaiserin-gisela/, https://saeulen-der-macht-ingelheim.de/gisela-2/). Entstanden ist so ein Buch, das einen breit gestreuten Blick explizit auf die ignorierte und verdrängte Frauengeschichte wirft und diese wieder aus den Niederungen des Vergessens in das Licht der Erinnerung holt.
Frauen in deutlich mehr Bereichen tätig als in den sozialen
Natürlich fehlt in dem Buch ein Portrait dieser wichtigen Frau nicht, ebenso wenig wie das von anderen kaiserlichen Hoheiten wie Kaiserin Bertha, Beatrix und Agnes. Zunächst beginnt das Buch aber mit einer Spurensuche in der Frühzeit und im römischen Speyer, wo sich leider wenig Spuren finden lassen, auch recht wenig bzgl. einer Göttinnenverehrung.
Es geht weiter mit dem Leben und Wirken katholischer Frauen von den Anfängen bis zur Neuzeit und neuerer Zeit, die oft Frauenbildung fokussiert haben. Es folgt das Leben und Wirken evangelischer Frauen – die ersten Pfälzer Diakonissen stammten aus Speyer. Das Wirken dieser Frauen wird als „umfangreiche und vielseitige christliche Sozialarbeit“ (s. 115) beschrieben. Die evangelischen Frauen seien für die kulturelle und geistige Entwicklung der evangelischen Gemeinden ein wichtiger Schritt gewesen (S. 110).
Auch das Leben und Leiden jüdischer Frauen wird beleuchtet. Danach folgt eine kurze Skizze der Kleiderordnung von 1356 mit dem versuchten Modediktat der Speyerer Ratsherren. Es geht weiter mit dem Erwerbsleben von Speyerer Frauen im Mittelalter, in dem auch die Prostituierten sowie Brotmägde und Brezelfrauen vorkommen und an die wertschätzend und mitfühlend erinnert wird. Ebenso kommen in den Beiträgen Industriearbeiterinnen zu Wort bzw. ihrer und ihrer Lebensumstände wird erinnert (Baumwollspinnerinnen, Zigarrenmacherinnen, Ziegelarbeiterinnen, Frauen in der Konfektionsindustrie und Schuhfabrik, Kampf der Speyerer Frauen bei der VFW-Fokker-Aktion). Ebenso werden Frauen portraitiert, die in den „typischen“ (weil auf sie begrenzten) Frauenberufen tätig waren: Hebammen, Fürsorgerinnen, Lehrerinnen. Aber ebenso gab es Geschäftsfrauen, Künstlerinnen, Politikerinnen, Bademeisterinnen, Schriftstellerinnen, Fotografinnen. Die Frauen werden immer eingebettet in ihre Zeit dargestellt. Als Erziehende werden Lehrerinnen, Philosophinnen, Denkerinnen, Stifterinnen, Gründerinnen und theologisch tätige Frauen (Pfarrersfrauen) genannt.
Ein eigenes Kapitel wird den Frauen im Nationalsozialismus gewidmet. Dort werden sowohl die widerständigen Frauen als auch diejenigen Frauen beleuchtet, die die Nazi-Ideologie mitgetragen haben. Die Nazis wollten die Frauen wieder aus den Berufen und der Politik herausdrängen, um der männlichen Arbeitslosigkeit zu begegnen. Also bauschten sie das Mutterbild einer selbstlosen, opferbereiten Mutter auf, das keine Frau (ohne Schaden zu nehmen) erfüllen kann – und das immer noch in unserer Gesellschaft herumgeistert und Frauen das Leben schwer macht! Mich hat bei dieser Lektüre ein heiliger Zorn gepackt. Ein heiliger Zorn darauf, was Frauen seit der Sesshaftwerdung der Menschheit angetan wurde und immer noch wird. Auch das demonstriert das Buch eindrücklich: die Leidensgeschichte der Frau, die definitiv ohne das Patriarchat nicht in diesem schrecklichen Ausmaß hätte leiden müssen und immer noch leidet (Stichworte: Misogynie, Femizide, Ehrenmorde, Diskriminierung [u.a. auch im deutschen Strafgesetz und im Familienrecht], …)! Aber selbst die Nazis haben es nicht geschafft, die Frau vollständig aus dem Leben zu drängen – trotz gegenteiliger Aussagen wurden Frauen u.a. in der Rüstungsindustrie beschäftigt.
Frauen bleiben über die Jahrtausende im öffentlichen Leben sichtbar, ob man(n) das will oder nicht. Auch das zeigt das Buch: Wie Frauen immer wieder Mittel und Wege finden, trotz z.T. massiver Repressalien präsent zu bleiben und sich gegen die Unterdrückung zu wehren. Es zeigt auch, dass ohne die Frauen die Gesellschaft schon längst zusammengebrochen wäre – und das zeigt es allein durch die Darstellung der Frauenschicksale. Denn diese veranschaulichen sehr gut, dass eine Gesellschaft ohne das weitsichtige Handeln von Frauen zum Scheitern verurteilt ist. Leider wird ebenso deutlich, wie wenig Wertschätzung Frauen für ihre umfassende Wirkweise entgegengebracht wurde und wird. Im Gegenteil: Sie wurde (und wird) auch noch in ihren Tätigkeiten behindert.
Manche Fragen, die ich mir bei der Lektüre des Buches gestellt habe, blieben mir allerdings eine Antwort schuldig: Warum schießen die Stadt und die „hohen Tiere“ quer, wenn die Schwestern versuchen, ihre soziale Mission zu erfüllen? Diese Frage wird im Buch z.B. nicht beantwortet. Ebenso wenig die Frage, warum die berühmte katholische Gläubige Edith Stein ihren Glauben an Gott verloren hat. Und die vielleicht eher banale Frage: Was sammelte der Frauenbund eigentlich?
Bildung der Mädchen – das zentrale weibliche Anliegen
Ansonsten wird das zentrale Anliegen der Nonnen, Schwestern und Frauenbünde immer wieder deutlich: Bildung der Mädchen! Dieser rote Faden zieht sich durch alle Schilderungen von Frauenleben. Aber auch die sichere Vermittlung von Arbeitsstellen an junge Frauen war Thema bei Frauen und die Gewissheit, dass eine Hausfrau eine bessere Mutter ist, wenn sie die Tätigkeiten der Frauenbewegung verfolgt. Die Politik als Sache der Frauen wird von weiblicher Seite aus schon zuvor, aber erst recht nach dem Dritten Reich fokussiert. Auch brisante Themen wie Tschernobyl werden von Frauen angegangen. Es wird immer wieder deutlich, dass Frauen der Schutz der Natur, Frieden, Menschenrechte im Kleinen und im Großen sehr am Herzen liegen. Und genauso wird leider deutlich, dass Chronisten das Leben von Frauen unverständlicherweise für nicht überlieferungswürdig hielten (S. 146).
Bzgl. jüdischer Vorstellungen wird im Buch der Fokus ebenfalls auf das weibliche Leben gerichtet. Die Leser*innen erfahren, dass ein Ehevertrag sowohl Witwen als auch geschiedene Frauen schützen soll. Ebenfalls als Schutz angesehen wird die Vorstellung, dass die Frau „Königin des Hauses“ sein soll. Haus und Frau sind Zellen des jüdischen Glaubens, die Vielehe ist untersagt, Bildung verhindert eine frühe Verheiratung. Die Frau führt den Haushalt und hilft beruflich dem Mann; sie verdient den Lebensunterhalt oft mit. Die Frau wurde vom Gottesdienst erst durch islamisches „Vorbild“ separiert. Mädchen werden gebildet, um zur Regeneration des Judentums beizutragen, und die Frau bildet sich sowohl jüdisch als auch christlich. Der Anteil von jüdischen Mädchen in Töchterschulen ist hoch. Das Buch übt Kritik an der Speyerer Judenfeindlichkeit in der Vergangenheit.
Demonstrationen für ein besseres, lebenswerteres (weibliches) Leben
„Gegen den Brotwucher“ lautete die Parole 1901, um gegen die Erhöhung der Getreidezölle zu demonstrieren. Auch Frauen wollten demonstrieren; sie taten es bei einer Versammlung schließlich auch. Aber ein Polizeiwachtmeister verbot den Frauen, an der Demonstration teilzunehmen – er hatte zwar Erfolg, aber nur unter erregtem, starkem Protest der anwesenden Männer und Frauen mit dem Ruf: „Es lebe die Freiheit!“ Diese Episode zeigt etwas Exemplarisches: Man(n) versuchte immer wieder, Frauen aus dem öffentlichen und politischen Leben herauszudrängen. Bis heute, und das nicht „nur“ in Ländern wie Afghanistan und dem Iran.
Aber auch wirtschaftlich sieht es nicht besser aus: Frauen arbeiten und arbeiteten unentgeltlich oder für einen Hungerlohn – sie bekommen für die gleiche Arbeit deutlich weniger Geld. Das ist – Schande über jede Gesellschaft, die das zulässt – auch heute noch so. Im Buch wird anschaulich beschrieben, welchen Arbeitsbedingungen Frauen ausgesetzt waren. Das ist hart zu lesen, denn die Ausbeutung war enorm, ebenso der gesundheitliche Schaden für die Frauen. Und die Ausbeutung geschah in allen wirtschaftlichen Bereichen! Es tut sich ein Abgrund an unfassbar schlechten Arbeitsbedingungen auf. Im Buch heißt es z.B.: „Die Art und Weise, wie Lehrlinge in der Zigarrenindustrie eingestellt und ausgebildet wurden, spricht allen Begriffen von Lehrling und Lernen Hohn. […] In dieser Lehrzeit, in der von Ausbildung keine Rede sein konnte, bekamen sie nur einen sehr geringen Lohn.“ (S. 209) „Ich atmete die dicke, beißende Tabakluft und übergab mich zum Erbarmen.“ (S. 209) Tabakdunst und Tabakstaub legte sich auf die Arbeiterinnen und in die Lungen. Die vornübergebeugte, sitzende Arbeitsweise mit den Gesichtern direkt über den Händen verursachte das Zusammendrücken der Atmungs- und Geschlechtsorgane und das Einatmen von beträchtlichen Mengen an Tabakstaub – bei geschlossenen Fenstern! Es gibt keine Bestimmungen zum Schutz der Arbeiterinnen.
Auch die Arbeiterinnen in den Ziegelwerken waren unterbezahlt: Sie verdienten an einem Arbeitstag von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends nach einem Streik wegen immer niedriger werdender Löhne 1, 60 M! Die jüngsten Mädchen von 14 bis 17 Jahren z.B. mussten 5000 Ziegel mit Schiebkarren eine 100 Meter weite Strecke schieben. Außerdem gab es zwar fließend Wasser, das aber unter Strafandrohung nicht zum Waschen benutzt werden durfte. Essen konnte nicht aufgewärmt werden, eine Umkleide gab es nicht.
Dafür bewirkten Ehefrauen durch konsequentes Durchhalten und Kämpfen, dass ihre Männer nicht von VFW-Fokker entlassen wurden, obwohl besagte Ehefrauen kein Stimmrecht hatten. Da zeigt sich, was eigentlich immer gilt: Wenn frau lautstark und konsequent für eine Sache eintritt, stehen die Aussichten auf Erfolg gut. Weswegen Vertreter des Patriarchats immer wieder versuchen, sie in mehrfacher Hinsicht stimm- und mundtot zu machen.
Insgesamt werden in dem Buch Frauen aller Couleur vorgestellt, wie oben schon erwähnt Bademeisterinnen, Fotografinnen, Geschäftsfrauen, Mundartdichterinnen ebenso wie die bekannte Schriftstellerin Sophie von la Roche und Henriette Feuerbach, die für den Maler Anselm Feuerbach wie eine zweite Mutter war. Aber wer kennt heute noch Franziska Möllinger, die erste Fotografin überhaupt? Sie leistete auf zwei Gebieten Pionierarbeit. Zum einen war die Arbeit des Fotografen in den ersten Jahrzehnten eine fast reine Männerarbeit. Frauen waren lediglich Assistentinnen, v.a. wegen der umständlichen, aufwändigen und z.T. gefährlichen technischen Seite des Berufs, denn die belichteten Platten wurden mithilfe von Quecksilberdämpfen entwickelt. Möllinger starb infolgedessen an Lungenschrumpfung. Möllinger war zum anderen die erste Reisefotografin, die die Strapazen des Reisens auf sich nahm.
Fazit
Das in sich abgeschlossene Buch versucht eine möglichst breite Darstellung von Frauenleben in vergangener Zeit zu bieten. Dafür musste aber z.T. tief in der Geschichte gegraben werden. Zudem wird deutlich, dass Frauen zwar vornehmlich im sozialen Bereich tätig waren (auf den sie nach männlicher Sicht auch beschränkt bleiben sollten), es aber immer wieder geschafft haben, aus diesem einengenden System auszubrechen und ihrer eigenen Berufung nachzugehen – unter deutlich mehr Mühen, als Männer auf sich nehmen mussten. Und es wird deutlich, dass Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, geringgeschätzt und somit gering oder gar nicht bezahlt wurde – was bis heute ein unsäglicher Zustand ist. Das Buch verschweigt auch nicht die Diskriminierungen, denen Frauen immer wieder ausgesetzt waren, und dies allein durch die Darstellung der einzelnen Frauenschicksale. Sehr gelungenes Buch; es müsste deutlich mehr Bücher dieser Art geben, um das ignorante Schweigen zur Geschichte der Frauen zu durchbrechen. Schön zu hören: Anscheinend ist schon ein Folgeband in Planung.
Ausstellung in Schifferstadt
Dazu schreibt die Stadt:
Vernissage zur Ausstellung “Aus dem Schatten ins Licht” – starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte
Im Rahmen der Frauenwochen anlässlich des Internationalen Frauentags, haben die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt die eindrucksvolle Ausstellung nach Schifferstadt geholt.
“Aus dem Schatten ins Licht – starke Frauen aus 1.000 Jahren Pfälzer Geschichte” stellt schlaglichtartig die Lebensbedingungen und Leistungen von 23 ausgewählten Frauen aus gut 1.000 Jahren Geschichte dar. Alle porträtierten Frauen haben einen Bezug zur Pfalz oder zu Gebieten, die historisch einmal mit der Pfalz verbunden waren. Die vorgestellten Frauen stehen exemplarisch für viele andere, meist namenlos gebliebene Heldinnen der Ereignis- und Sozialgeschichte.
Eröffnet wird die Wanderausstellung “Aus dem Schatten ins Licht – starke Frauen aus 1.000 Jahren Pfälzer Geschichte” am Montag, 27. März um 18.30 Uhr im Foyer des Rathauses der Stadtverwaltung Schifferstadt.
Zur Ausstellung:
Obwohl die Gender-Forschung in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat und die Leistungen von Frauen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Alltag in den Fokus gerückt sind, finden sich nur mühsam belastbare Hinweise auf “starke” Frauen in der Geschichte. Denn: Je weiter die Zeiten zurückgehen, desto schlechter ist die Quellenlage. Zu sehr war die Geschichtsschreibung männlich dominiert, zu sehr standen die Frauen im Schatten der Männer, zu sehr lagen ihre Leistungen in wenig öffentlichkeitswirksamen Bereichen: hinter Klostermauern, im Bereich von Haus- und Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe, Kindererziehung und Krankenpflege. Die Schriftstellerin O Zuge der Französischen Revolution 1791 eine “Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin”. Es war ein langer Weg bis ihr Artikel I zur gesellschaftlichen Realität wurde: “Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne ebenbürtig in allen Rechten.” 1903 wurden in der damals bayerischen Pfalz zum ersten Mal Frauen zum Studium zugelassen, 1918 erhielten sie das Wahlrecht. Seit dem Grundgesetz von 1949 sind Männer und Frauen zumindest rechtlich gleichberechtigt. Allerdings brauchten Frauen noch bis 1977 die Zustimmung ihres Ehemannes, wenn sie berufstätig sein wollten. Angesichts der rechtlichen Unterordnung ist es nicht verwunderlich, dass die Lebensleistungen von Frauen entweder nicht wahrgenommen oder als selbstverständlich angesehen wurden.
“Aus dem Schatten ins Licht” wurde von den Stadtmuseen Ludwigshafen und Zweibrücken gemeinsam als Wanderausstellung konzipiert und produziert und ist ab 27. März bis einschl. 21. April zu den Öffnungszeiten im Foyer des Rathauses zu sehen.
Laufzeit der Ausstellung: 27. März bis 21. April 2023
Interessante weiterführende Links:
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/gewalt-familie-umgangsrecht-kinder-vater-100.html#xtor=CS5-281
https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Guy-Blach%C3%A9
https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-gelehrte-frauenzimmer-eine-andere-geschichte-der-philosophie-100.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://de.wikipedia.org/wiki/Frauen_in_der_Wissenschaft
![Spukorte in der Pfalz Cover des Buches Spukorte in der Pfalz (ISBN: 9783946587415)]() Burgen als Spuk-Orte
Burgen als Spuk-Orte Burgen als Spuk-Orte
Burgen als Spuk-Orte Nachdem ich verstanden hatte, dass wir gerade hier, im Nordosten Deutschlands, mit immer weniger Wasser auskommen müssen, recherchierte ich in dieser Richtung und hörte immer öfter Beth Chattos Namen: auf der Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung der
Nachdem ich verstanden hatte, dass wir gerade hier, im Nordosten Deutschlands, mit immer weniger Wasser auskommen müssen, recherchierte ich in dieser Richtung und hörte immer öfter Beth Chattos Namen: auf der Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung der 

 „Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.
„Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.




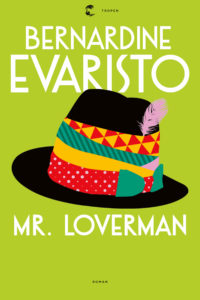 Es ist das dritte Buch von Bernhardine Evaristo, das ich las. Hier stellt sie einen kleineren Kreis eng verflochtener Menschen vor, die in der westindischen Community in London leben. Jeder/m lässt sie ihre/seine Würde und Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Neben den hier näher beschriebenen Protagonisten gilt das auch für die Töchter des Paares und den Geliebten Morris.
Es ist das dritte Buch von Bernhardine Evaristo, das ich las. Hier stellt sie einen kleineren Kreis eng verflochtener Menschen vor, die in der westindischen Community in London leben. Jeder/m lässt sie ihre/seine Würde und Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Neben den hier näher beschriebenen Protagonisten gilt das auch für die Töchter des Paares und den Geliebten Morris.
 The Shining. Der Roman von Stephen King, der 1977 erstmals in den USA erschien, habe in Bret Easton Ellis den Wunsch geweckt, Schriftsteller zu werden, wie er in seinem neuen Roman, “The Shards“, der 1981 spielt, freimütig bekennt. Seine Beschreibung seines ersten Shining-Kinobesuchs liest sich so spannend, wie das Meisterwerk von Stanley Kubrick schon im Auftakt ist. “Nie zuvor hatte ein Film mit so wenig Blutvergießen einen derartigen Gruselfaktor“, wissen die Herausgeber.
The Shining. Der Roman von Stephen King, der 1977 erstmals in den USA erschien, habe in Bret Easton Ellis den Wunsch geweckt, Schriftsteller zu werden, wie er in seinem neuen Roman, “The Shards“, der 1981 spielt, freimütig bekennt. Seine Beschreibung seines ersten Shining-Kinobesuchs liest sich so spannend, wie das Meisterwerk von Stanley Kubrick schon im Auftakt ist. “Nie zuvor hatte ein Film mit so wenig Blutvergießen einen derartigen Gruselfaktor“, wissen die Herausgeber. selbst, dem Hausverwalter und ehemaligen Lehrer Jack Torrance (Jack Nicholson) ab. Auch er möchte nämlich gerne Schriftsteller werden, aber den einzigen Satz, den er auf seiner deutschen Adler-Schreibmaschine zustande bringt lautet: “All work and no play makes Jack a dull boy“. In der deutschen Version wiederum „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“, was man ohne weiteres als nicht ganz so treffend bezeichnen könnte. Kubrick habe den Satz eigenhändig mehrmals auf mehrere Seiten Papier geschrieben, erzählen damals einige Insider. Der Film kommt zwar ohne Blutvergießen aus, aber natürlich nicht ohne Blut, wie eine der eindringlichsten Szenen erinnert: der Blutaufzug.
selbst, dem Hausverwalter und ehemaligen Lehrer Jack Torrance (Jack Nicholson) ab. Auch er möchte nämlich gerne Schriftsteller werden, aber den einzigen Satz, den er auf seiner deutschen Adler-Schreibmaschine zustande bringt lautet: “All work and no play makes Jack a dull boy“. In der deutschen Version wiederum „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“, was man ohne weiteres als nicht ganz so treffend bezeichnen könnte. Kubrick habe den Satz eigenhändig mehrmals auf mehrere Seiten Papier geschrieben, erzählen damals einige Insider. Der Film kommt zwar ohne Blutvergießen aus, aber natürlich nicht ohne Blut, wie eine der eindringlichsten Szenen erinnert: der Blutaufzug. Die vorliegende exklusive XXL Publikation des TASCHEN Verlages eröffnet ungeahnt tiefgründige Einblicke in den Entstehungsprozess eines filmischen Meisterwerks, das Kubrick selbst allerdings gehasst haben soll. Das und noch viel mehr erfährt man aus Hunderten von Stunden an exklusiven Interviews mit den Darstellern und der Crew, aus denen für diesen Band die spannendsten Passagen ausgewählt wurden. Manche werden den Kultklassiker von 1980 nun in einem völlig neuem Licht sehen, etwa wenn man die Details über die mysteriösen Feuer, die während der Dreharbeiten in den Elstree Studios ausbrachen, erfährt oder mehr über die Technik des berüchtigten „Blutaufzugs“ erfährt. Kubricks bahnbrechender Einsatz der Steadicam machte ebenso Schule wie die endlosen Drehbuchänderungen und die unzähligen Takes, die der Perfektionist Kubrick seiner Crew abverlangte. Auch heutige Schauspieler:innen könnten ein Lied davon singen.
Die vorliegende exklusive XXL Publikation des TASCHEN Verlages eröffnet ungeahnt tiefgründige Einblicke in den Entstehungsprozess eines filmischen Meisterwerks, das Kubrick selbst allerdings gehasst haben soll. Das und noch viel mehr erfährt man aus Hunderten von Stunden an exklusiven Interviews mit den Darstellern und der Crew, aus denen für diesen Band die spannendsten Passagen ausgewählt wurden. Manche werden den Kultklassiker von 1980 nun in einem völlig neuem Licht sehen, etwa wenn man die Details über die mysteriösen Feuer, die während der Dreharbeiten in den Elstree Studios ausbrachen, erfährt oder mehr über die Technik des berüchtigten „Blutaufzugs“ erfährt. Kubricks bahnbrechender Einsatz der Steadicam machte ebenso Schule wie die endlosen Drehbuchänderungen und die unzähligen Takes, die der Perfektionist Kubrick seiner Crew abverlangte. Auch heutige Schauspieler:innen könnten ein Lied davon singen.![Detektiv Conan - Box 2 (Episoden 35-68) [6 DVDs]](https://images2.medimops.eu/product/69f5ce/M0B01N9EVLM3-large.jpg) Über Allgemeines zu der Serie und die ersten Folgen habe ich hier schon berichtet und rezensiert, weshalb ich das jetzt nicht mehr wiederhole:
Über Allgemeines zu der Serie und die ersten Folgen habe ich hier schon berichtet und rezensiert, weshalb ich das jetzt nicht mehr wiederhole: