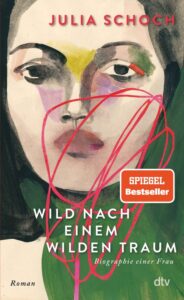 Wild nach einem wilden Traum. Nach “Das Vorkommnis” und “Das Liebespaar des Jahrhunderts” nun der letzte Teil der Trilogie “Biographie einer Frau“. Die beiden ersten erscheinen zeitgleich auch schon als Taschenbuch und die Autorin geht auf Lesereise durch Deutschland West und Ost.
Wild nach einem wilden Traum. Nach “Das Vorkommnis” und “Das Liebespaar des Jahrhunderts” nun der letzte Teil der Trilogie “Biographie einer Frau“. Die beiden ersten erscheinen zeitgleich auch schon als Taschenbuch und die Autorin geht auf Lesereise durch Deutschland West und Ost.
Verwandlung im Namen der Liebe
Julia Schoch stammt aus Mecklenburg und lebt heute in Potsdam. 2022 wurde ihr die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung verliehen, 2023 der Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen, 2024 der Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis. Die ersten beiden Bände sind sowohl Leser:innen- als Kritiker:innenlieblinge und standen auf der SWR- wie der ORF-Bestenliste. Während es im ersten Band um die Ursprungsfamilie und im zweiten um die Partnerbeziehung ging wird in “Wild nach einem wilden Traum” sowohl die Literatur als auch die Liebe in’s Zentrum der Erzählung gerückt. “Die Erinnerung an eine Liebe kann intensiver sein als diese Liebe selbst“, schreibt sie etwa, als sie fern von zu Hause einen Mann kennenlernt, den sie stets schlicht als “Katalanen” bezeichnet. Namen sind ohnehin Schall und Rauch und so bleibt auch die Ortschaft A., wo die beiden eine “artists in residence”-Beziehung in einer Künstlerkolonie eingehen, im Dunkeln. Ebenso ihr Ehemann, der stets nur der Mann ist, ohne Namen, ohne Alter, auch ihre zwei Kinder.
Wild nach einem wilden Traum
Der Katalane kommt aus einem Land, das sich abspalten will, die Erzählerin aus einem Land, das sich gerade wiedervereinigt hat. Offen bleibt, ob nicht auch Deutschland bald gewissen Auflösungstendenzen anheim fallen wird, denkt sie und verwirft den Gedanken sogleich. “Vielleicht passiert die Liebe, dieses Gefühl, wenn wir uns zu jemandem hingezogen fühlen, immer nur so: stellvertretend für etwas viel Früheres, Älteres, das uns verloren gegangen ist und das wird zurückverlangen wollen. Alle Liebe ist nur ein Ersatz-Haltegriff, habe ich irgendwo gelesen“, schreibt sie und reißt damit einen Graben auf, der sich nicht mehr zuschütten lässt. “Wahrscheinlich geschieht es nur einmal, dass man sich voller Begeisterung für jemanden aufgibt. Diese Verwandlung im Namen der Liebe. Später braucht man sich nicht mehr. Später: wenn man wieder man selbst geworden ist.” Und was heißt denn schon zurückkommen? “Wer weiß denn schon, ob das, was zurückkehrt, auch das ist, was verschwunden war?”
Einer das Vehikel des andern
Künstler seien keine glücklichen Menschen, sie taugen nichts fürs Leben, offenbart ihr ein älterer Freund, der Soldat, von dem sie auch den Titel ihres Romans ausgeborgt hat. “Man muss wild danach sein. Wild nach einem wilden Traum.” Das sind starke Sätze, die die Autorin da findet: “Wir bewohnen unsere Vergangenheit, wie man Träume bewohnt“. Verblassenden Erinnerungen oder nachlassendem Gedächtnis kann sie etwas positives abgewinnen. Denn auf das Vergessen sei Verlass und ohne es gebe es keine Geschichten. “Sie sind das, was übrig bleibt.” Auch in der Liebe benutzt man einander, ist “Vehikel“, wie sie schreibt, für einander und bringen fernere, frühere, dunklere Bereiche ans Licht. Oder man lebt in einem “glücklichen Irrtum“.
Maske der Ehrlichkeit
Mit einem Mal gebe es dann keinen Unterschied mehr zwischen Erinnerung und Erzählung. Schließlich sei auch nur die Ehrlichkeit eine Maske. Das sitzt tief. Schriftsteller würden die vergangene Zeit spüren, die Zukunft und das, was noch kommt. Sie hätten eine intensivere Verbindung zu den Toten und eine bessere Verbindung zum Schmerz in der Welt, sagt er, der Katalane. Und obwohl sie diese Meinung für überzogen und pathetisch hält, stimmt sie ihr insgeheim zu. “Bücher sind beinahe magische Objekte. Schon das Lesen war eine Art heilige Handlung, ganz zu schweigen vom Schreiben.”
Einspruch gegen die Unmöglichkeit der Liebe
Und lesen kann tatsächlich bessere Menschen aus uns machen, davon sind wir alle überzeugt, alle die lesen natürlich nur. Am allerschönsten finde ich die Stelle in der sie über das Jung-sein schreibt. “Ich habe den Glauben, man könne den Menschen befreien ja vielleicht sogar Die Welt retten, in den Jahren danach immer wieder vermisst. Ich vermisse ihn noch immer.” Das große Seufzen verbindet uns alle, nicht nur die Mütter, die dadurch die Brücken zum Rest der Menschheit schlagen. “Man sollte Einspruch erheben gegen das Gerede von der Unmöglichkeit der Liebe.” Das ist Julia Schoch in jedem Fall gelungen.
Mehr zu den drei Bänden hier
Julia Schoch
Wild nach einem wilden Traum
Roman.
2025, Hardcover, 160 Seiten
ISBN: 978-3-423-28425-7
dtv
23,00 €


 Die Verdorbenen. Eine klassische Ménage-à-trois ist die Beziehung zwischen Johann, dem Protagonisten und dem Paar Tommi und Christiane. Eigentlich beginnt alles ganz harmlos, doch dann gesellt sich zu Liebe, Lust und Spiel auch das Böse.
Die Verdorbenen. Eine klassische Ménage-à-trois ist die Beziehung zwischen Johann, dem Protagonisten und dem Paar Tommi und Christiane. Eigentlich beginnt alles ganz harmlos, doch dann gesellt sich zu Liebe, Lust und Spiel auch das Böse. Nur Unterhaltung
Nur Unterhaltung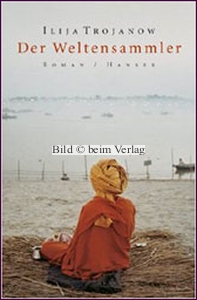 Vom Clash of Civilizations
Vom Clash of Civilizations Unterhaltsam schon gar nicht
Unterhaltsam schon gar nicht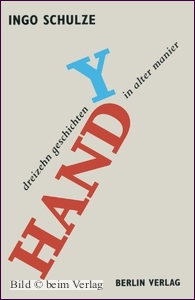 Vom Risiko profaner Abschweifung
Vom Risiko profaner Abschweifung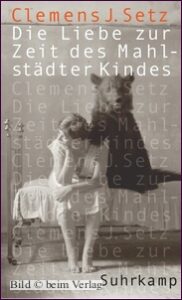 Überambitioniert, aber gekonnt geschrieben
Überambitioniert, aber gekonnt geschrieben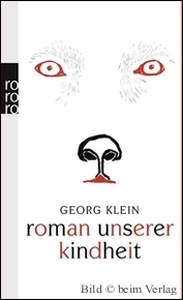 Allenfalls für Splatter-Fans
Allenfalls für Splatter-Fans
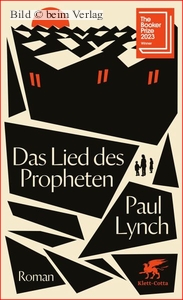 Ein politischer Weckruf ohnegleichen
Ein politischer Weckruf ohnegleichen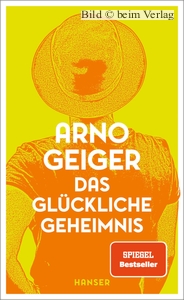 Altpapier, Sex und Poetik
Altpapier, Sex und Poetik Mangel an Inspiration und Substanz
Mangel an Inspiration und Substanz Moralische Desertierung
Moralische Desertierung Eine unendliche Folge von Kausalketten
Eine unendliche Folge von Kausalketten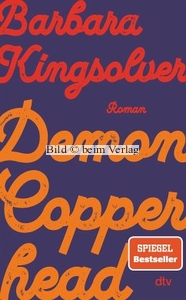 Epos von der Chancenlosigkeit
Epos von der Chancenlosigkeit