 Unvergesslich?
Unvergesslich?
Mit dem Titel seines Romans «Komm, gehen wir» spielt Arnold Stadler auf dessen Eingangs-Kapitel an, das geradezu symptomatisch ist für den Anfang dieser Geschichte. Es geht darin um eine ungewöhnliche, gemischt hetero-homosexuelle Ménage à trois, die in Italien ihren Anfang nimmt. Einen Hinweis auf autobiografische Bezüge bietet der Name des Protagonisten Roland, der als Anagramm den Vornamen des Autors enthält, es gibt zudem weitere Gemeinsamkeiten, die solche Schlüsse zulassen, wie Stadler in einer Stellungsnahme bestätigt hat. Seine vor allem auch von katholischen Einflüssen geprägte Geschichte behandelt, narrativ unbeirrt von vielerlei Banalitäten, das Thema Liebe und die daraus folgenden Seelen-Zustände.
Der Hochzeits-Termin von Roland und Rosemarie steht fest, die beiden 23jährigen Studenten haben den 22. November 1978 gewählt und verbringen im August ihre «vorgezogene Hochzeitsreise» auf der italienischen Trauminsel Capri. Am Vortag ihrer Abreise liegen sie nackt an einem illegalen FKK-Strand, als ein gutaussehender, junger Amerikaner, der sich als Jim aus Florida vorstellt, sie um einen Schluck Wasser bittet. Sie kommen ins Gespräch, «und nach zwei weiteren Stunden wissen sie schon so viel von einander, dass Roland zu ihm sagt: ‹Come on, let’s got!›», aber verwirrt «go» meint, «Komm, gehen wir!». Denn Jim hat keine Bleibe für die Nacht, also laden sie ihn in ihre Pension ein. Beide sind fasziniert von ihm und nehmen ihn dann auch mit nach Deutschland. Aber schon bald beginnt es auch zu kriseln. Als beispielsweise Rosemarie ihre beiden Lover nackt auf dem Bett erwischt, wie sie sich ein Pornoheft ansehen, schreit sie wütend: «Ich fasse es nicht – was seid ihr doch für Drecksäue!». «Das war Rolands ungewaschene Erinnerung an die Liebe», heißt es im Roman, der Student träumt nun wieder davon, Schriftsteller zu werden, «um alles festzuhalten und das Unbeschreibliche zu beschreiben».
Es geht hier um drei Lieben, jede mit anderen Anziehungs-Kräften, Sehnsüchten und Erwartungen, jede mit ihrem eigenen Glücks- und Unglücks-Potential. Roland hatte sein Studium der Agrarökonomie nach einem Semester abgebrochen, und über eine anschließende Ballettausbildung, die seine Eltern nicht ganz zu Unrecht ziemlich beunruhigt hat, heißt es im Roman: «Tanzen hieß zu Hause soviel wie: Er lässt sich jetzt ficken». Aber auch diese Karriere ist mangels Talent gescheitert, und als ihn eine Fahrt an Tübingen vorbeiführt, geht es ihm durch den Kopf: «Aus jeder Klasse war der Oberspinner nach Tübingen gegangen, um entweder Philosophie oder Theologie, Psychologie oder Soziologie zu studieren, um nach zwanzig Semestern entweder als Professor, Taxifahrer oder Politiker zu enden». Und untüchtig wie er ist endet Roland als Studienabbrecher der Philosophie und versucht sich lange vergeblich als Schriftsteller. Von allen drei Protagonisten erzählt der Autor auch ausführlich ihre jeweilige Vorgeschichte. Rosemarie macht später eine steile Karriere als Ärztin, Jim verschwindet wieder in die USA und fristet dort eine fragwürdige Existenz, der Kontakt zu ihm wird immer spärlicher. Und für alle geht auch in der Liebe alles schief, was schiefgehen kann.
Mit vielen Abschweifungen erzählt Arnold Stadler eine wenig plausible Geschichte voller Leerstellen und ins Nichts führender Gedankengänge. Da liest man zu Beispiel, dass die Liaison seines Trios gerade mal so lange gedauert habe wie das Pontifikat von Johannes Paul I., was in diesem Zusammenhang nicht nur befremdlich, sondern auch völlig unmotiviert wirkt. An anderer Stelle erwischt eine Mutter in Amerika ihren Sohn und Jim, den sie bei sich aufgenommen hat, am 6. Juni 1978 – «dem 103. Geburtstag von Thomas Mann» – in flagranti und wirft Jim hinaus. Was für eine geradezu an den Haaren herbei gezogene Assoziation! Und es gibt mehr, was den Leser verstört zurücklässt. Wenn also im Buch die Frage «Woran erkenne ich ein Kunstwerk?» beantwortet wird mit «Daran, dass es unvergesslich ist», dann liegt hier wahrlich kein Kunstwerk vor!
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de

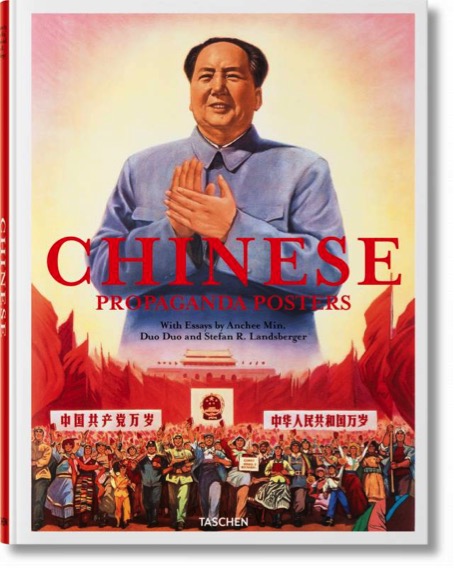



 Verantwortungsvoller Umgang mit Tieren
Verantwortungsvoller Umgang mit Tieren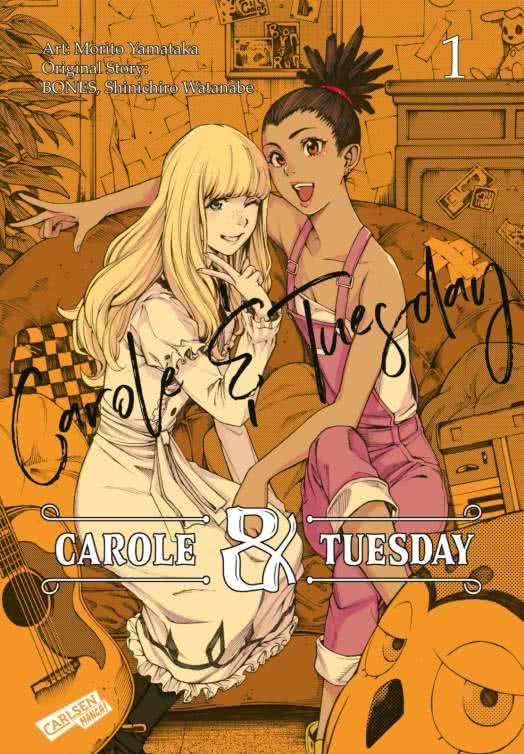 Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung Vom Scheintod der Literatur
Vom Scheintod der Literatur
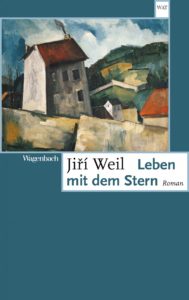 Leben mit dem Stern. “Gestern wurde ich 53 Jahre alt, denn ich bin so alt wie dieses seltsame Jahrhundert“, schrieb Weil 1953 an einen Freund. Diesen Satz liest man mit Freude, denn so weiß man sogleich, dass der Autor sowohl die nationalsozialistische als auch die stalinistische Katastrophe “dieses seltsamen Jahrhunderts” überlebt hat. Für bedeutende tschechoslowakische Schriftsteller wie Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Ivan Klíma oder Jiří Kolář ist Jiří Weil heute ein großes Vorbild. Allerdings galt er in der ehemaligen Tschechoslowakei, seit der Veröffentlichung seines hier vorliegenden Romans 1949 bis zu seinem Tod 1959, als Unperson, ja sogar als “Schädling“.
Leben mit dem Stern. “Gestern wurde ich 53 Jahre alt, denn ich bin so alt wie dieses seltsame Jahrhundert“, schrieb Weil 1953 an einen Freund. Diesen Satz liest man mit Freude, denn so weiß man sogleich, dass der Autor sowohl die nationalsozialistische als auch die stalinistische Katastrophe “dieses seltsamen Jahrhunderts” überlebt hat. Für bedeutende tschechoslowakische Schriftsteller wie Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Ivan Klíma oder Jiří Kolář ist Jiří Weil heute ein großes Vorbild. Allerdings galt er in der ehemaligen Tschechoslowakei, seit der Veröffentlichung seines hier vorliegenden Romans 1949 bis zu seinem Tod 1959, als Unperson, ja sogar als “Schädling“.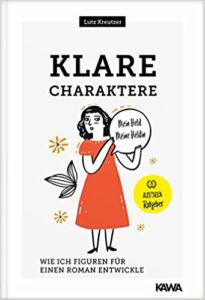
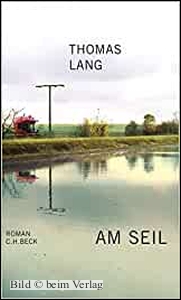 Fanal selbstbestimmten Sterbens
Fanal selbstbestimmten Sterbens

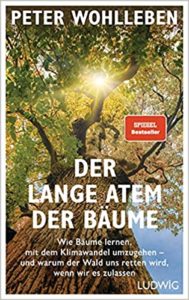
 Gefühlschaos
Gefühlschaos Bedrückendes Psychogramm
Bedrückendes Psychogramm Unvereinbar konträre Welten
Unvereinbar konträre Welten