 In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.
In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.
Es kommen präzise Betrachtungen der Politik, die manchmal prophetisch erscheinen. Hier geht es um Bruno Juge, dem Wirtschaftsminister und seinen Vertrauten, Paul Raison, beide Absolventen der Grandes Ecoles, Bruno (Richter, wie wir auf Deutsch sagen würden) kommt von der Polytechnique und Paul (Recht, oder Vernunft) von der Verwaltungsuni. Die gute Arbeitsbeziehung wurde zur Männerfreundschaft in einer Hotelbar in Addis Abeba, wo Bruno stolz ist, wieder einige Atomkraftwerke vermittelt zu haben, aber dann klagt, er hätte mit seiner Frau seit 6 Monaten nicht mehr Liebe gemacht. Paul könnte berichten, dass es beim ihm schon an die zehn Jahre sind.
Zurück in Paris im Jahr 2027 sind Wahlkampfzeiten, es wird von einer Profiwerbefrau die Wahlkampagne designed, Bruno soll als Kandidat fit gemacht werden, er ist anerkannt, aber nicht beliebt. Er bekommt die junge Raksaneh als persönlichen Coach zugeteilt, die in seiner Dienstwohnung ein Laufband aufstellt und ihn Episches von Corneille zitieren lässt, beides hilft seinem Auftreten: “er strotzt vor Energie“. Später wird er dann doch nicht Präsidentschaftskandidat, für den Spannungsbogen ist das aber nicht mehr von Bedeutung.
Wichtiger ist die Serie von erst virtuellen, dann realen Sabotageaktivitäten. Im Netz kommen unverständliche geometrische Zeichen, die auch im Buch aufgemalt sind, und dann ein Video, indem Bruno von einer Guillotine, auch aufgemalt, geköpft wird. Das ist ein Fall für die DGSI (Direction générale de la sécurité en France) wo Pauls Vater früher eine Rolle gespielt hatte. Es werden Geheimdienstler und andere Spezialisten dazu befragt, wer könnte so etwas machen? Primzahlen spielen eine Rolle, Schiffe gesenkt, eine Samenbank in Dänemark wird zerstört, warum machen Menschen so etwas? Nachfolger des Unabombers? Ultralinke oder fundamental Katholische, später spricht manches für Satanisches. Geschmückt werden die Informationen über das Vernichtende von Werbung für sexy Miederwaren…
Als Kind der deutsch-französischen Freundschaft warte ich gerne auf seine kurzen Blicke nach Deutschland: Hier ist es, passend zum verstörenden „Vernichten“, der Alte Fritz, der Menschen als eine verdorbene Rasse (race méchante) bezeichnete, und sich dann mit seinen geliebten Windspielen beerdigen ließ.
Das ist so treffend ausgemalt, wie wir es von Houellebecq kennen, und dann kommt Neues, es menschelt. Pauls Vater liegt nach einem Schlaganfall im Koma, die Familie ist gefragt. Die kleine Schwester Cécile übernimmt das Kommando, sie unterstützt Madeleine, die Gefährtin des Vaters, die erst die Pflegehelferin und dann Geliebte des Witwers wurde. Cécile ist Hausfrau, streng katholisch, ihr Mann Hervé unterstützt sie, wenn es schwierig wird, kann er sich Hilfe bei seinen Freunden, den Identitären, holen. Pauls Vater erholt sich und ist dank Madeleine gut versorgt, aber das Elend der anderen Bewohner wird deutlich. Wie in Deutschland auch, werden die Seniorenwohnheime von Gewinn orientierten Ketten betrieben.
Vielleicht ist es dem Zusammensein mit seinen Geschwistern geschuldet, Paul möchte seine Beziehung zu seiner Frau Prudence wiederbeleben. Sie teilen zwar die Traumwohnung, mit Blick auf den Parc Bercy, jedenfalls so lange wie sie sie noch abbezahlen. Sonst gehen sie sich aus dem Weg. Angefangen hat es damit, dass Prudence ihn zum Vegetarier machen wollte, und seine Mahlzeiten, die er im gemeinsamen Kühlschrank lagern wollte, gar weggeschmissen hatte, vor vielen Jahren.
Aber, was tun? Ob er überhaupt noch Liebe machen kann? Er scheut keine Mühen, es wieder zu erlernen und leistet sich eine Edelprostituierte im 16. Arrondissement, deren Spezialität der Blow Job ist. Es geht noch!
Und kurz danach klappt es wieder, sie vögeln dann täglich und Paul erzählt uns seine Vorlieben (seitlich), Prudence, die er schon als „asexuell und vegan“ geschimpft hatte, entwickelt sich zu seiner und auch ihrer Zufriedenheit.
Dann bekommt Paul Mundhöhlenkrebs. Er beschreibt kenntnisreich die zu absolvierende Diagnostik, nimmt seine Diagnose gefasst auf, durchläuft die aufklärenden und beratenden Gespräche, wägt Strahlentherapie, Chemo und/oder Operation ab. Mit den üblichen Leitfäden, die zur seelischen Bewältigung empfohlen werden, kann er nichts anfangen. Er träumt dystopisches, so wie immer in seinem Leben, wenn es schwierig wird. Oft hilft ihm ein Spruch von Blaise Pascal, Philosophie ist nicht sein Ding, er hat mal ausgerechnet, dass er sich weniger als 2 Jahre mit ihr befasst hatte, damals, zum Abitur.
Ist Houellebecq nun altersmilde, hat er die Bedeutung von Frauen entdeckt? Sie sind tatkräftig, stehen ihren Mann, natürlich gibt es auch Schlampen, Schwägerin Indy etwa, die feministische, erfolglose Journalistin, oder die Gewerkschafterin im Altersheim, die die Versorgung von Pauls Vater schwierig macht. Aber Madeleine, Cécile, Prudence und auch deren Schwester, die aus Kanada zurück nach Frankreich zieht, um den verwitweten Vater zu versorgen, füllen ihre Rollen. Und mit Cécile kann man sogar über Glaubensfragen sprechen!
Mehrere hundert Seiten lang glaubte ich, dass Houellebecq an seinem Frauenbild gearbeitet hätte, bis ich den Bechdel Test machte: Er dient der Bewertung von Filmen, zur Frage, ob im Film mindestens zwei Frauen ein vernünftiges Gespräch führen, und in dem es nicht um Männer geht.
Im Buch sprechen die Frauen darüber, wie sie die kranken und alternden Männer versorgen können. Das Schicksal hat es ja so gewollt, dass Pauls und Prudences Väter Witwer wurden, und Prudence es bald sein wird. Als die Krankheit fortschreitet, sind Sabotageakte, oder gar die Präsidentschaftswahl kein Thema mehr. Es geht darum, trotz der Einschränkung gut zu vögeln. Und, der Zufall will es, Bruno und Raksaneh tun es inzwischen auch.
Auch in seiner Danksagung regt er an, Schriftsteller sollten mehr Recherchearbeit leisten. Neben Ärzten, die ihn zu den behandelten Themen beraten hatten, wird eine Frau hervorgehoben, die selbstlos ihren kranken Mann pflegt.
Den Übersetzern gelingt es, den Ton zu treffen, mit dem Houellebecq sein erotisches Begehren zum alltäglichen Anliegen macht.
Ich bin schon gespannt auf den nächsten Houellebecq. Wie der Schlingel es doch immer schafft, selbst mich alte weiße Frau zu überraschen!
 Hoffen und Scheitern
Hoffen und Scheitern Unvergesslich?
Unvergesslich?
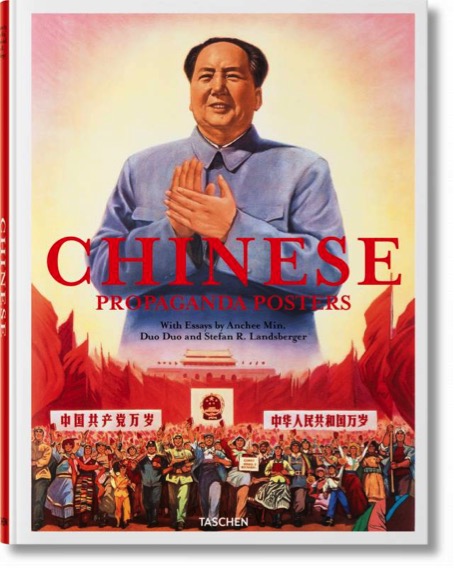



 Verantwortungsvoller Umgang mit Tieren
Verantwortungsvoller Umgang mit Tieren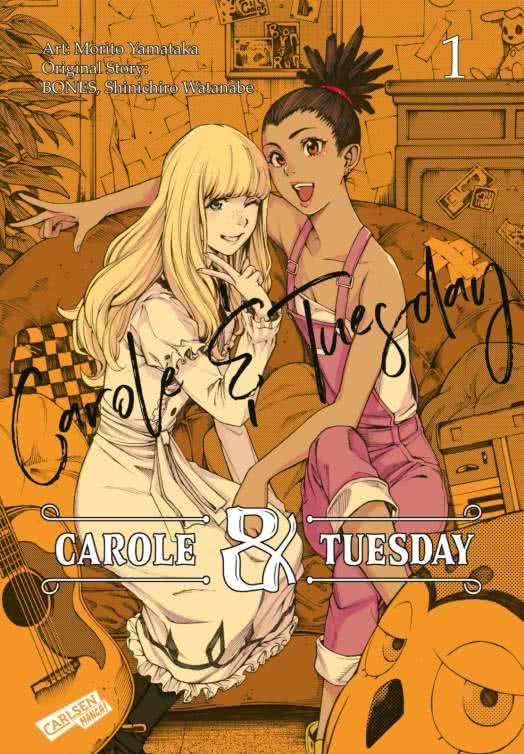 Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung Vom Scheintod der Literatur
Vom Scheintod der Literatur
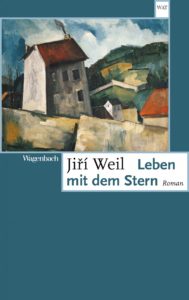 Leben mit dem Stern. “Gestern wurde ich 53 Jahre alt, denn ich bin so alt wie dieses seltsame Jahrhundert“, schrieb Weil 1953 an einen Freund. Diesen Satz liest man mit Freude, denn so weiß man sogleich, dass der Autor sowohl die nationalsozialistische als auch die stalinistische Katastrophe “dieses seltsamen Jahrhunderts” überlebt hat. Für bedeutende tschechoslowakische Schriftsteller wie Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Ivan Klíma oder Jiří Kolář ist Jiří Weil heute ein großes Vorbild. Allerdings galt er in der ehemaligen Tschechoslowakei, seit der Veröffentlichung seines hier vorliegenden Romans 1949 bis zu seinem Tod 1959, als Unperson, ja sogar als “Schädling“.
Leben mit dem Stern. “Gestern wurde ich 53 Jahre alt, denn ich bin so alt wie dieses seltsame Jahrhundert“, schrieb Weil 1953 an einen Freund. Diesen Satz liest man mit Freude, denn so weiß man sogleich, dass der Autor sowohl die nationalsozialistische als auch die stalinistische Katastrophe “dieses seltsamen Jahrhunderts” überlebt hat. Für bedeutende tschechoslowakische Schriftsteller wie Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Ivan Klíma oder Jiří Kolář ist Jiří Weil heute ein großes Vorbild. Allerdings galt er in der ehemaligen Tschechoslowakei, seit der Veröffentlichung seines hier vorliegenden Romans 1949 bis zu seinem Tod 1959, als Unperson, ja sogar als “Schädling“.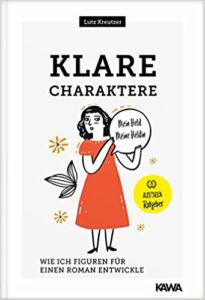
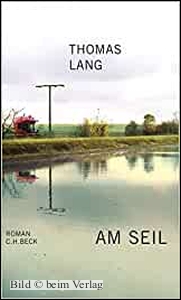 Fanal selbstbestimmten Sterbens
Fanal selbstbestimmten Sterbens

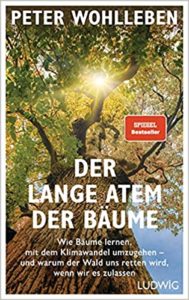
 Gefühlschaos
Gefühlschaos