 Wenn Trennung obsolet wird
Wenn Trennung obsolet wird
Der erste auf Deutsch erschienene Roman der amerikanischen Schriftstellerin Kati Kitamura mit dem Titel «Trennung» überrascht in mancherlei Hinsicht. Denn es geht um die Trennung eines Ehepaares, was in vergleichbaren Geschichten ein Gefühlschaos auslöst und zu emotionalen Ausbrüchen führt, die unter dem Motto «Herz-Schmerz» ganze Bibliotheken mit Trivialliteratur füllen. Nicht so in diesem Buch, dessen Autorin sich dieses Themas kühl sezierend annimmt, das Geschehen vielmehr sehr distanziert, geradezu gelassen schildert und damit erzählerisch überraschend dieses beliebte literarische Genre konterkariert.
Die seit fünf Jahren verheiratete, in London lebende, namenlose Ich-Erzählerin hat sich mit Christopher auseinander gelebt, er ist seit einigen Monaten ausgezogen, sie selbst wohnt inzwischen bei ihrem Freund. «Es begann mit einem Anruf von Isabella» lautet der erste Satz. Die Schwiegermutter, die nichts von ihrer Trennung weiß, erkundigt sich nach ihrem Sohn, der in Griechenland für ein Buch recherchiert, aber nicht erreichbar ist. Ob sie nicht dorthin reisen könne, um zu klären, was mit ihrem Sohn sei. Vor Ort stellt sich heraus, dass Christoph schon seit vielen Tagen nicht mehr in seinem Hotelzimmer war, niemand weiß etwas über seinen Verbleib. Bis nach drei Tagen die Polizei erscheint, er sei an einer einsamen Landstraße tot aufgefunden worden, ausgeraubt und ermordet, es gäbe den Umständen nach leider kaum eine Chance, den Mordfall aufzuklären.
Diese vom Plot her wenig originelle, in dreizehn Kapiteln erzählte Geschichte lebt von den kontemplativen Einschüben, von den gedanklichen Rückblenden und Reflexionen der Ich-Erzählerin, die in Form des Bewusstseinsstroms, oft auch mit der inneren Rede all das ergänzt, was das erzählerische Gerüst erst zu einer vollständigen Geschichte formt. So erfährt man, dass Christoph ein notorischer Schürzenjäger war, als Schriftsteller aber kaum reüssieren konnte, und auch, wie wenig seine Frau letztendlich über ihn weiß. Aus ihrem geradezu voyeuristischen Blickwinkel werden dem Leser einige weitere Figuren vorgestellt. Da ist zunächst die Hotelangestellte Maria, mit der Christoph ein Verhältnis hatte, was sie der Witwe in einem der wenigen Gespräche, die die Handlung direkt voranbringen, freimütig gesteht. Oder der Taxifahrer Stefano, der Maria liebt und als eifersüchtiger Mann zumindest vom Motiv her als Täter in Frage käme. All das Spekulation, Teil der endlosen Gedankenspiele und Projektionen der Ich-Erzählerin, und auch über sie selbst übrigens erfährt der Leser herzlich wenig. Es ist eine äußerst minimalistische Erzählweise, mit der hier Illusionen aufgearbeitet, die Realitäten in einem Prozess des ständigen Sinnierens hinterfragt werden, und in der immer wieder über die Leerstellen und Lügen einer Ehe spekuliert wird.
Geschickt bindet die Autorin die trostlose griechische Landschaft, in der erst vor kurzem ein Waldbrand gewütet hat, in Ihre nicht minder trostlose Geschichte ein, die viele Fragen bewusst offen lässt. Ihre narrative Emotionslosigkeit macht nachdenklich, es wird damit eine Betroffenheit beim Leser erzeugt, die resignativ wirkt, die die Schrecken von Trennung und Tod evident werden lässt. Eine ziemlich makabre Szene spielt sich – darauf hinzielend – im Haus einer der im ländlichen Raum noch typischen Klageweiber ab, die bei einem Besuch der jungen Witwe eine Kostprobe ihres Klagegesangs zum Besten gibt und sich dabei exstatisch in ihren Gesang hineinsteigert. Das Todesmotiv taucht übrigens bereits am Anfang des Romans auf, Christoph recherchiert nämlich für ein Buch über Trauerrituale, er war mutmaßlich auch genau deswegen dorthin gereist. Mit irritierender Distanz und gelegentlich durchschimmernder Ironie wird in diesem psychologischen Roman jenes weibliche Gefühlsleben thematisiert, das mit dem langsamen Auflösungsprozess einer Ehe einhergeht, in der paradoxer Weise die Trennung selbst schlussendlich obsolet wird.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Für den idealen Leser
Für den idealen Leser Nachdem ein Tsunami die Ostküste der USA verwüstet hat, finden sich Dean und sein kleiner Bruder Alex in einer Welt wieder, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen gelingt es ihnen, sich in ein Flüchtlingslager in Kanada zu retten. Doch Zeit zum Atemholen bleibt ihnen nicht: Noch immer ist Josies Schicksal ungewiss, die sich nicht mit ihnen aus dem Herzen des Sturms retten konnte und dann spurlos verschwand. Und auch Astrid, Deans Freundin, schwebt in Gefahr: Da sie während des Chemieunfalls, der sich kurz nach der Naturkatastrophe ereignete, schwanger war, zeigt die Regierung nun ein beunruhigendes Interesse an ihr. Astrid fürchtet um ihr Kind und flieht aus dem Flüchtlingslager, begleitet von Dean. Doch sie ahnen nicht, was sie draußen erwartet…
Nachdem ein Tsunami die Ostküste der USA verwüstet hat, finden sich Dean und sein kleiner Bruder Alex in einer Welt wieder, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen gelingt es ihnen, sich in ein Flüchtlingslager in Kanada zu retten. Doch Zeit zum Atemholen bleibt ihnen nicht: Noch immer ist Josies Schicksal ungewiss, die sich nicht mit ihnen aus dem Herzen des Sturms retten konnte und dann spurlos verschwand. Und auch Astrid, Deans Freundin, schwebt in Gefahr: Da sie während des Chemieunfalls, der sich kurz nach der Naturkatastrophe ereignete, schwanger war, zeigt die Regierung nun ein beunruhigendes Interesse an ihr. Astrid fürchtet um ihr Kind und flieht aus dem Flüchtlingslager, begleitet von Dean. Doch sie ahnen nicht, was sie draußen erwartet… Glücklich ist, wer vergisst
Glücklich ist, wer vergisst Prekär wie die gleichnamige Straße
Prekär wie die gleichnamige Straße Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bist du ganz auf dich allein gestellt.
Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bist du ganz auf dich allein gestellt.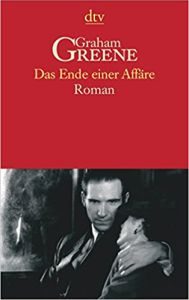 Der dritte Mann
Der dritte Mann
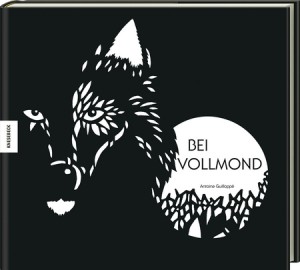
 des Waldes lauschen aufmerksam, ein Wolf öffnet seine Augen, Reineke Fuchs wird nervös und eine Wildschweinmutter grunzt durchs Unterholz. Ein nicht einzuordnendes Geräusch hat die Tiere des Waldes aufgeweckt. Der Vollmond steht in seiner ganzen weißen Pracht am Himmel und alle Tiere sind plötzlich still und lauschen gespannt in den Wald hinein. Was hat sie aufgeweckt? War es die Helligkeit des Vollmondes oder droht von irgendwoher Gefahr? Antoine Guilloppé zeigt alle Tiere des Waldes in Großaufnahme und man sieht sie vor sich, den Wolf, den Fuchs, einen Uhu, einen Hirsch, sogar eine Fledermaus huscht vorbei und ein Wildschwein grunzt einem flüchtendem Kaninchen nach.
des Waldes lauschen aufmerksam, ein Wolf öffnet seine Augen, Reineke Fuchs wird nervös und eine Wildschweinmutter grunzt durchs Unterholz. Ein nicht einzuordnendes Geräusch hat die Tiere des Waldes aufgeweckt. Der Vollmond steht in seiner ganzen weißen Pracht am Himmel und alle Tiere sind plötzlich still und lauschen gespannt in den Wald hinein. Was hat sie aufgeweckt? War es die Helligkeit des Vollmondes oder droht von irgendwoher Gefahr? Antoine Guilloppé zeigt alle Tiere des Waldes in Großaufnahme und man sieht sie vor sich, den Wolf, den Fuchs, einen Uhu, einen Hirsch, sogar eine Fledermaus huscht vorbei und ein Wildschwein grunzt einem flüchtendem Kaninchen nach. Doch dann tauch plötzlich der Bär auf. Was bringt er mit sich? Gefahr? Warum ist er so stumm, hat auch er Angst? Angst vielleicht ja, aber nicht um sich. Denn selbst die grobschlächtigsten Bestien haben ein Herz. Aber Bären sind keine Bestien. Was also hat er? Fühlt er? Eine Entdeckungsreise in den tiefen, tiefen Wald bei Vollmond, was kann es Schöneres zu entdecken geben? Antoine Guilloppé schafft es mit wenigen Worten aber großartigen Bildern die Sinne anzusprechen und sowohl Erwachsene als auch Kinder für eine weitere Entdeckungsreise zu begeistern.
Doch dann tauch plötzlich der Bär auf. Was bringt er mit sich? Gefahr? Warum ist er so stumm, hat auch er Angst? Angst vielleicht ja, aber nicht um sich. Denn selbst die grobschlächtigsten Bestien haben ein Herz. Aber Bären sind keine Bestien. Was also hat er? Fühlt er? Eine Entdeckungsreise in den tiefen, tiefen Wald bei Vollmond, was kann es Schöneres zu entdecken geben? Antoine Guilloppé schafft es mit wenigen Worten aber großartigen Bildern die Sinne anzusprechen und sowohl Erwachsene als auch Kinder für eine weitere Entdeckungsreise zu begeistern.
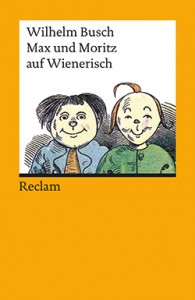

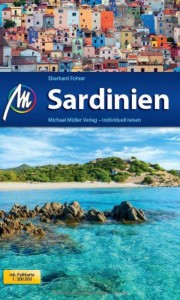 Reiseführer Sardinien in 15. Auflage: Der vorliegende Reiseführer gliedert Sardinien nach den vier Himmelsrichtungen und dem fünften Kapitel „Innersardinien“ in fünf lesens- und besuchenswerte Destinationen. Auf beinahe 700 Seiten wird Sardinien nicht nur als Ferien-, sondern vor allem auch Kulturregion vorgestellt, das jedem etwas zu bieten hat. Sardinien ist immerhin die zweitgrößte Insel des Mittelmeers und Italiens und die fünftgrößte Europas. Auf 24.090 km2 finden sich Gebirge wie die Punta la Marmora (1834m), der Bruncu Spina (1829m) und das Bergmassiv Supramonte bei Nuoro (1463m) ebenso wie Strand- und Wüstenlandschaften oder Wälder resp. die Macchia. Das italienische Festland ist ca. 190 km entfernt, Tunesien aber sogar nur 180 km. Und was Sardinien besonders attraktiv macht: es gehört zu den Ländern/Inseln mit der geringsten Bevölkerungsdichte: nur 1,66 Millionen Menschen leben auf Sardinien, die meisten davon arbeiten im benachbarten In- oder Ausland.
Reiseführer Sardinien in 15. Auflage: Der vorliegende Reiseführer gliedert Sardinien nach den vier Himmelsrichtungen und dem fünften Kapitel „Innersardinien“ in fünf lesens- und besuchenswerte Destinationen. Auf beinahe 700 Seiten wird Sardinien nicht nur als Ferien-, sondern vor allem auch Kulturregion vorgestellt, das jedem etwas zu bieten hat. Sardinien ist immerhin die zweitgrößte Insel des Mittelmeers und Italiens und die fünftgrößte Europas. Auf 24.090 km2 finden sich Gebirge wie die Punta la Marmora (1834m), der Bruncu Spina (1829m) und das Bergmassiv Supramonte bei Nuoro (1463m) ebenso wie Strand- und Wüstenlandschaften oder Wälder resp. die Macchia. Das italienische Festland ist ca. 190 km entfernt, Tunesien aber sogar nur 180 km. Und was Sardinien besonders attraktiv macht: es gehört zu den Ländern/Inseln mit der geringsten Bevölkerungsdichte: nur 1,66 Millionen Menschen leben auf Sardinien, die meisten davon arbeiten im benachbarten In- oder Ausland.
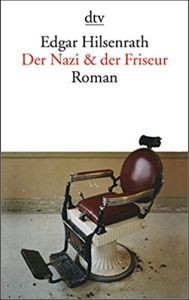 Widerlegt Adornos Diktum
Widerlegt Adornos Diktum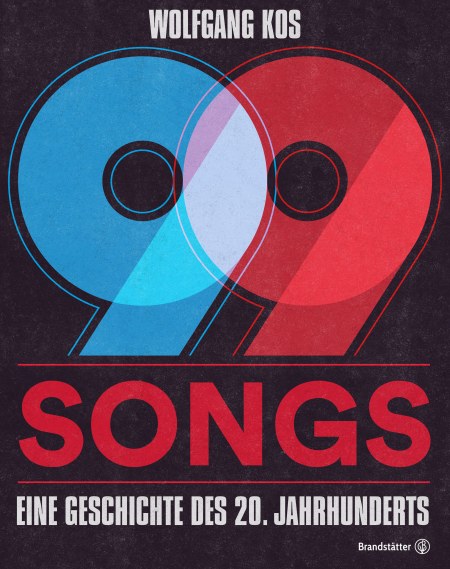
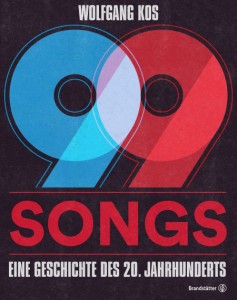 Der Autor will in seinem Buch am Beispiel seiner frei und völlig subjetkiv ausgewählten 99 Songs „gesellschaftliche Hintergründe, kollektive Sehnsüchte oder Konsumentwicklungen und Zeitbrüche erkunden“. Konsenslieder ebenso wie abseits der kommerziellen Warenproduktion entstandene Songs, die zwar keine Hits, aber dafür politische Identifikation bieten und bei Demonstrationen als Protestsongs einsetzbar waren ebenso wie Gassenhauer. Kos’ „99 Songs“ kommen aus unterschiedlichen Musikepochen und kulturellen Milieus und reichen stilistisch von der Oper, dem Musical zu Blues und Country, Schlager und 20er Jahre hin zum Great American Songbook der 30er und 40er, aber auch Chansons und Folk, Rock’n’Roll, Beat, Soul, Rock, Hip-Hop und Rap, partiell wird auch auf Tango, Bossa Nova, Reggae oder Pop aus Afrika zurückgegriffen, um sich dem Vorwurf des Eurozentrismus zu erwehren bevor er noch artikuliert wird. Und natürlich geht es auch um Sex. Und Liebe.
Der Autor will in seinem Buch am Beispiel seiner frei und völlig subjetkiv ausgewählten 99 Songs „gesellschaftliche Hintergründe, kollektive Sehnsüchte oder Konsumentwicklungen und Zeitbrüche erkunden“. Konsenslieder ebenso wie abseits der kommerziellen Warenproduktion entstandene Songs, die zwar keine Hits, aber dafür politische Identifikation bieten und bei Demonstrationen als Protestsongs einsetzbar waren ebenso wie Gassenhauer. Kos’ „99 Songs“ kommen aus unterschiedlichen Musikepochen und kulturellen Milieus und reichen stilistisch von der Oper, dem Musical zu Blues und Country, Schlager und 20er Jahre hin zum Great American Songbook der 30er und 40er, aber auch Chansons und Folk, Rock’n’Roll, Beat, Soul, Rock, Hip-Hop und Rap, partiell wird auch auf Tango, Bossa Nova, Reggae oder Pop aus Afrika zurückgegriffen, um sich dem Vorwurf des Eurozentrismus zu erwehren bevor er noch artikuliert wird. Und natürlich geht es auch um Sex. Und Liebe.
 Die Herausgabe der Erich Mühsam Tagebücher ist ein sehr aufwendiges Projekt des Verbrecherei Verlages, das sich derzeit bei Band 12, 1922-1924, befindet und noch bis zum Frühjahr 2019 mit Band 15 1924 fortgesetzt wird. Der gesamte Rahmen umfasst also die Jahre 1910-1924, runde 15 Jahre des anarchistischen Schriftstellers und Dichters Erich Mühsam. Seine Tagebücher erscheinen zugleich auch als Online-Edition und werden unter der gleichnamigen URL im Netz auch von einem Anmerkungsapparat mit kommentiertem Namensregister, Sacherklärungen, ergänzenden Materialien und Suchfunktionen ergänzt. So entsteht eine historisch-kritische Ausgabe, ein großes Vorhaben und „der erste wirklich überzeugende Versuch, Buch und Internet plausibel und produktiv zu kombinieren“, wie rbb Kulturradio über das ambitionierte Projekt schreibt. Auch die Ausstattung ist übrigens wunderschön: in schwarzes Leinen gebunden mit Lesebändchen genügt sich auch ästhetischen Anarchisten des Wortes.
Die Herausgabe der Erich Mühsam Tagebücher ist ein sehr aufwendiges Projekt des Verbrecherei Verlages, das sich derzeit bei Band 12, 1922-1924, befindet und noch bis zum Frühjahr 2019 mit Band 15 1924 fortgesetzt wird. Der gesamte Rahmen umfasst also die Jahre 1910-1924, runde 15 Jahre des anarchistischen Schriftstellers und Dichters Erich Mühsam. Seine Tagebücher erscheinen zugleich auch als Online-Edition und werden unter der gleichnamigen URL im Netz auch von einem Anmerkungsapparat mit kommentiertem Namensregister, Sacherklärungen, ergänzenden Materialien und Suchfunktionen ergänzt. So entsteht eine historisch-kritische Ausgabe, ein großes Vorhaben und „der erste wirklich überzeugende Versuch, Buch und Internet plausibel und produktiv zu kombinieren“, wie rbb Kulturradio über das ambitionierte Projekt schreibt. Auch die Ausstattung ist übrigens wunderschön: in schwarzes Leinen gebunden mit Lesebändchen genügt sich auch ästhetischen Anarchisten des Wortes.
 Aus einer ursprünglich im tropischen Regenwald lebenden „Urkrähe“ hätten sich die Krähenvögel in der Zeit vom späten Oligozän bis zum Miozän herausentwickelt und über die ganze Erde verbreitet. Die Kulturgeschichte des Menschen habe sich quasi unter der Beobachtung der Krähen vollzogen, denn beide haben sich entwicklungsgeschichtlich aus dem dichten Dschungel in offene Landschaften bewegt. Auf der Flucht vor Jägern hat sich diese Entwicklung allerdings einige tausend Jahre später wieder umgedreht, denn die Krähen sind vom Land in das Stadtgebiet geflüchtet, wo sie Schutz vor Freiwild-Erklärung des Menschen finden und so ihre Populationen wieder ansteigen konnten. Es gab nämlich eine Zeit da wurde tatsächlich Jagd auf die armen Vögel gemacht, weil diverse Vorurteile über sie kursierten. Diese zu bekämpfen, dazu trägt auch diese wunderschön illustrierte Krähenschau des Matthes & Seitz Verlages aus Berlin bei.
Aus einer ursprünglich im tropischen Regenwald lebenden „Urkrähe“ hätten sich die Krähenvögel in der Zeit vom späten Oligozän bis zum Miozän herausentwickelt und über die ganze Erde verbreitet. Die Kulturgeschichte des Menschen habe sich quasi unter der Beobachtung der Krähen vollzogen, denn beide haben sich entwicklungsgeschichtlich aus dem dichten Dschungel in offene Landschaften bewegt. Auf der Flucht vor Jägern hat sich diese Entwicklung allerdings einige tausend Jahre später wieder umgedreht, denn die Krähen sind vom Land in das Stadtgebiet geflüchtet, wo sie Schutz vor Freiwild-Erklärung des Menschen finden und so ihre Populationen wieder ansteigen konnten. Es gab nämlich eine Zeit da wurde tatsächlich Jagd auf die armen Vögel gemacht, weil diverse Vorurteile über sie kursierten. Diese zu bekämpfen, dazu trägt auch diese wunderschön illustrierte Krähenschau des Matthes & Seitz Verlages aus Berlin bei.

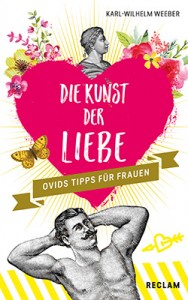 Ovids Liebestipps: „exue fastus, curam mansuri quiquis amoris habes“: Legt allen euren Stolz ab, alle, die Ihr Interesse an einer dauerhaften Liebesbeziehung habt, rät Ovid seinen Liebesschülern und es kommt noch dicker. Als „fairer Mittler“ gibt Ovid nicht nur einer Partei Waffen in die Hand, sondern „trainiert auch die andere Seite mit Ratschlägen“. Aus diesem Grund ist vorliegende amüsante Lektüre von beiden Seiten lesbar: die eine für die Männer, die andere für die Frauen. Wer Ovid deswegen Verrat an seinen Geschlechtsgenossen vorwerfen möchte, dem sei die aufklärerische Note seiner Schrift ans Herz gelegt. Denn obwohl Ovid seine Schrift „ars amatoria“ schon um Christi Geburt schrieb und veröffentlichte sind seine Ansichten bezüglich den Frauen durchwegs fortschrittlich zu nennen. Entgegen damaliger Vorstellungen gesteht er nämlich auch den Frauen Seitensprünge zu und verteidigt stets die erotischen und materiellen Interessen der Frau – wohl auch im Eigeninteresse. Seine fortschrittlichen Ansichten führten übrigens auch zur Verbannung und so verstarb er statt in seinem geliebten Rom am Schwarzen Meer.
Ovids Liebestipps: „exue fastus, curam mansuri quiquis amoris habes“: Legt allen euren Stolz ab, alle, die Ihr Interesse an einer dauerhaften Liebesbeziehung habt, rät Ovid seinen Liebesschülern und es kommt noch dicker. Als „fairer Mittler“ gibt Ovid nicht nur einer Partei Waffen in die Hand, sondern „trainiert auch die andere Seite mit Ratschlägen“. Aus diesem Grund ist vorliegende amüsante Lektüre von beiden Seiten lesbar: die eine für die Männer, die andere für die Frauen. Wer Ovid deswegen Verrat an seinen Geschlechtsgenossen vorwerfen möchte, dem sei die aufklärerische Note seiner Schrift ans Herz gelegt. Denn obwohl Ovid seine Schrift „ars amatoria“ schon um Christi Geburt schrieb und veröffentlichte sind seine Ansichten bezüglich den Frauen durchwegs fortschrittlich zu nennen. Entgegen damaliger Vorstellungen gesteht er nämlich auch den Frauen Seitensprünge zu und verteidigt stets die erotischen und materiellen Interessen der Frau – wohl auch im Eigeninteresse. Seine fortschrittlichen Ansichten führten übrigens auch zur Verbannung und so verstarb er statt in seinem geliebten Rom am Schwarzen Meer.