 Eine „Laudatio auf den Schlaf“ nennt Till Roenneberg seine „Kampfschrift“. Der Professor am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Schlafforscher und Chronobiologe, also ein Erforscher unserer biologischen Uhr. Er beherrscht damit das Thema und möchte Nichtfachleuten Wissen vermitteln. Ob es ihm gelingt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Weiterlesen
Eine „Laudatio auf den Schlaf“ nennt Till Roenneberg seine „Kampfschrift“. Der Professor am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Schlafforscher und Chronobiologe, also ein Erforscher unserer biologischen Uhr. Er beherrscht damit das Thema und möchte Nichtfachleuten Wissen vermitteln. Ob es ihm gelingt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Weiterlesen
Archiv
Das Recht auf Schlaf
Ein Festtag
 Elegant und federleicht erzählt
Elegant und federleicht erzählt
Ist der Roman «Ein Festtag» von Graham Swift auch ein Festtag für den Leser? Mehr als einen Tag nämlich wird er kaum brauchen, um diesen internationalen Bestseller mit seinen 142 Seiten zu lesen, in denen es, wie so oft bei diesem englischen Schriftsteller, um die Erinnerung als literarisches Faszinosum geht. Was da alles in die wenigen Buchseiten hineingepackt ist an Gefühlen, Lebensweisheiten, an historischem und gesellschaftlichem Hintergrund, das ist verblüffend, nicht etwa weil so komprimiert erzählt wird, sondern weil all das ganz unterschwellig auch mit anklingt.
«Mothering Sunday», so der Buchtitel im Original, ist ein Feiertag der Church of England, hier im Roman ist dieser sonnige Tag im März 1924 der alles verändernde Schicksalstag für seine Protagonistin. Traditionell haben alle Dienstboten an diesem Tage arbeitsfrei, viele besuchen ihre Mutter, aber Jane ist ein Findelkind, sie wurde im Waisenhaus großgezogen und arbeitet als Dienstmädchen in einem Herrenhaus. Die 24Jährige hat seit Jahren heimlich ein Verhältnis mit Paul, dem verwöhnten Sohn wohlhabender Nachbarn, anfangs hatte er sie mit einem Sixpence bezahlt, inzwischen ist daraus Liebe geworden. Er nutzt die Abwesenheit seiner Eltern und trifft Jane an diesem Festtag zum ersten Mal bei sich zuhause, und nach den vielen unbequemen, improvisierten Treffen diesmal erstmals sogar in seinem Bett. Ohne obszön zu werden schildert Swift die postkoitale Zweisamkeit en detail und spart auch den Fleck nicht aus, den die gehabten Genüsse als feuchte Spuren verräterisch auf dem Laken hinterlassen haben. Bei aller Ekstase ist dem nun nackt auf dem Bett liegenden Pärchen bewusst, dass dies ihr letzter Beischlaf war, sie werden sich nie wiedersehen, Paul wird in zwei Wochen Emma heiraten, eine arrangierte Ehe mit einer «guten Partie». Und während Jane vor sich hin sinnierend ihr bisheriges Leben Revue passieren lässt, putzt sich Paul schweigend für ein Treffen mit Emma heraus, und zwar aufreizend langsam, obwohl er inzwischen viel zu spät dran ist und empörte Vorhaltungen seiner Verlobten fürchten muss.
Zwei Drittel der Geschichte sind diesem Tête-à-Tête gewidmet, aus der Perspektive der jungen Jane wird darin sehr anschaulich ihr bisheriges Leben rekapituliert, bis nach mehr als hundert Seiten ein plötzlicher Zeitsprung ins hohe Alter von Jane Fairchild führt, die nach Tätigkeit im Buchhandel eine erfolgreiche Schriftstellerin geworden ist. Dieser zweite Teil ihres Lebens wird in Form von Interviews erschlossen, in denen die Hochbetagte nach ihrem Lebensweg befragt wird. «Alles ausgedacht» hatte sie einst als 48Jährige nach dem Tod ihres Mannes, eines Philosophen in Oxford, ihr erstes Buch betitelt. In den Gesprächen finden sich dann geistreiche Reflexionen von ihr über Literatur, über den Schreibprozess als solchen und die Fiktionalisierung der Realität, über das Lesen und ihre persönliche Annäherung an die Literatur insbesondere durch Joseph Conrad, den sie geradezu hymnisch verehrt hatte.
Es ist bewundernswert, wie Graham Swift, mit wenigen Worten sparsam erzählend, in seinem raffiniert konstruierten Plot derart tiefgründig in das Gefühlsleben seiner Figuren eindringt und anschaulich die Atmosphäre in den privilegierten englischen Herrenhäusern mit ihren gesellschaftlichen Umbrüchen schildert. Folgt man der Definition von Goethe, ist diese Geschichte mit ihrer – von mir aus Fairness potentiellen Lesern gegenüber verschwiegenen – «unerhörten Begebenheit» eine äußerst elegant geschriebene, klassische Novelle. Die, und das ist das Schöne daran, wegen ihrer Kürze natürlich zu allerlei Deutungen und Ergänzungen durch den geneigten Leser geradezu herausfordert. Was auch immer aber man herauslesen zu können glaubt, all diese wohlfeilen Spekulationen über das «Was-wäre-wenn» ändern nichts daran, dass dies eine angenehm unterhaltende, federleicht erzählte Novelle ist, literarisch also durchaus «auch ein Festtag für den Leser»!
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Bei Regen im Saal
 Die Romanhaftigkeit des Lebens
Die Romanhaftigkeit des Lebens
Das Markenzeichen des Büchner-Preisträgers Wilhelm Genazino ist ‹der gedehnten Blick›, den er in seinem gleichnamigen Essay konkret beschrieben hat und der auch den Roman «Bei Regen im Saal» prägt. Gemeint ist damit eine zeitlich gedehnte, intensive Wahrnehmung auch kleinster, banaler Details des Alltags. Erst bei längerer Betrachtung erschließe sich «die Tiefendimension eines Gegenstandes oder einer Situation», und damit verliere sich auch das Triviale, hat er im Interview erklärt. Ein weiteres Merkmal seiner Prosa ist der elegische, resignative Grundton, die Protagonisten sind misanthropische Antihelden, das Milieu ist durch die «kleinen Leute» gekennzeichnet im Kampf mit dem alltäglichen Wahnsinn unserer immer komplizierter werdenden, modernen Zeit.
Der erst ganz am Ende als Reinhard ‹benamste› Ich-Erzähler ist ein 43jähriger, promovierter Philosoph, ein Verlierertyp, der sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben schlägt und schließlich als Redakteur bei einer Lokalzeitung landet. Als unverbesserlicher Eigenbrötler wohnt er im Chaos seiner spartanisch möblierten, verschmutzten Wohnung, ein schlecht gekleideter, schlecht rasierter, schmuddeliger und ungepflegter Mann. Er ist antriebslos und verrichtet seine Arbeit gleichgültig, ohne jeden Ehrgeiz. Seinem tristen Zuhause, seiner ereignislosen Existenz entflieht der Flaneur durch häufige Streifzüge durch die Stadt, er beobachtet dabei mit scharfem Blick sein ihm immer unverständlicher werdendes, urbanes Umfeld. Einziger Lichtblick in seinem ansonsten bindungsarmen Leben ist seine Freundin Sonja, eine dralle Finanzbeamtin, mit der er ein äußerst erfülltes Sexualleben führt. Der auch vom Aussehen her wenig attraktive Mann mit seinen Marotten ist ein ausgesprochener Busenfetischist, BHs und Brüste üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn aus. Und erstaunlicher Weise machen ihm viele Frauen recht deutlich Avancen, weil sie seine Begehrlichkeit spüren, er aber weicht dem immer aus, seine eh schon schwach ausgeprägte Bindungsfähigkeit lässt ihn vor flüchtigen Affären zurückschrecken, seine Liebe gilt allein Sonja.
Eine Handlung ist in diesem kurzen Roman kaum auszumachen, das Wenige davon hier auszuplaudern wäre unfair, denn eine gewisse Spannung ergibt sich trotzdem, – es geht ja schließlich um Liebe, und die ist immer für Überraschungen gut! Die Geschichte als Ganzes lebt von den als Gedankenstrom erzählten Grübeleien und inneren Monologen des ewigen Flaneurs, den jede noch so kleine Begebenheit interessiert und oft zu abseitigen, philosophischen Betrachtungen animiert. Das Große im Kleinen zu erkennen, die tiefere Bedeutung auszuloten ist das erklärte Anliegen des Autors. Wobei politische, religiöse, ökonomische oder soziologische Aspekte ausgeklammert bleiben, das alltäglich Banale des menschlichen Seins steht im Fokus, hinzu kommen gelegentlich auch Beobachtungen in der Natur. Als Ergebnis solcher Selbstreflexion, als Extrakt dieser willkürlichen, sprunghaften Denkprozesse ergeben sich dann häufig völlig absurde, eigenwillige Einsichten und skurrile Assoziationen.
Wilhelm Genazino überrascht seine Leser zuweilen mit gelungenen Wortschöpfungen in einer angenehm lesbaren, den narrativ vorherrschenden Bewusstseinsstrom stimmig abbildenden, schnörkellosen Sprache. Zu der allfälligen Kritik an seinen handlungsarmen Plots hat der sich selbst als randständig verortende Schriftsteller in einem Interview angemerkt: «Denn unter den Lesern sind natürlich auch sehr viele, die nicht die entsprechende Muße aufbringen und stattdessen mehr Action wollen. Für diese Leser muss es viel mehr vordergründige Handlungsmuster geben, da müssen irgendwelche Scheidungen stattfinden und Liebesabenteuer usw. Wenn das nicht stattfindet, dann legen diese Leser so ein Buch wie eines von mir schnell beiseite und sagen: ‹Ach, wie langweilig›!» Die Romanhaftigkeit des Lebens ist selten actionreich, das wird beim Lesen dieses Romans sehr deutlich.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Früchte des Zorns
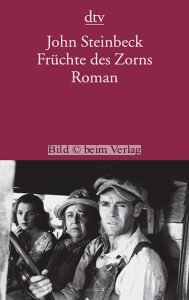 Mit sozialem Scharfsinn
Mit sozialem Scharfsinn
Aus dem Werk des US-amerikanischen Schriftstellers John Steinbeck hebt sich der sozialkritische Roman «Früchte des Zorns» von 1939 auch heute noch besonders hervor. Er hat damit den Arbeitsmigranten in der Zeit der Großen Depression allgemein und den verächtlich als «Okies» bezeichneten, entwurzelten Wanderarbeitern aus Oklahoma, die damals in Massen nach Kalifornien auf Arbeitssuche gezogen sind, im Besonderen ein Denkmal gesetzt. Das Nobelkomitee lobte den Autor 1962 «für seine einmalige realistische und phantasievolle Erzählkunst, gekennzeichnet durch mitfühlenden Humor und sozialen Scharfsinn». Dieser Roman ist auch heute noch Schullektüre in vielen englischsprachigen Ländern, er wird mit seinem Realismus und der beeindruckenden Detailfülle auch als willkommene historische Quelle angesehen.
Auslöser der hunderttausendfachen Armutsmigration war neben jahrelanger Dürre vor allem die «Urbarmachung» der Prärie in den dann später als «Dust Bowl» bezeichneten Gebieten in der Mitte der USA. Die Prärie musste dem Baumwoll- und Weizenanbau weichen, das fehlende Präriegras ließ den Boden schnell austrocknen, verheerende Sandstürme waren die Folge, die «Staubschüssel» entstand. Und so schildert Steinbeck denn auch gleich im ersten der dreißig Kapitel des Romans sehr eindringlich diese von Menschen verursachte Katastrophe, bei der die Farmer ihr Land verloren haben, weil sie wegen der ausfallenden Ernten ihre Kredite bei den Banken nicht mehr bedienen konnten. Auf Handzetteln wurden Erntehelfer für die riesigen Obstplantagen in Kalifornien gesucht, es gab wilde Gerüchte über den Garten Eden dort, und so macht sich denn auch die Familie Joad aus Oklahoma auf den Weg, nachdem die Traktoren der neuen Großgrundbesitzer bis dicht an ihr Haus heran alles umgepflügt hatten und im Begriff waren, nun auch noch das armselige Farmhaus zu zerstören, weil es der modernen, hocheffizienten Bewirtschaftung im Wege steht.
«Route 66» als legendärer, auch aus der Musik bekannter Highway ist über weite Teile der Geschichte Schauplatz des Geschehens. Die entwurzelte Großfamilie, die sich aus drei Generationen zusammensetzt, erlebt auf der beschwerlichen Reise mit einer zum Lastwagen umgebauten, klapprigen Limousine immer wieder herbe Rückschläge und beschämende Demütigungen. Das wenige Geld wird erschreckend knapp, ihr Auto kann nur noch notdürftig repariert werden, wie Wegelagerer beuten Händler am Wegesrand die durchreisenden, auf Hilfe angewiesenen Okies immer wieder schamlos aus, und auch die Sheriffs machen ihnen das Leben zur Hölle. Das alles ändert sich leider nicht, als sie mit ihren letzten Dollars in Kalifornien ankommen, denn Arbeit gibt es dort keine für sie. Und wenn doch, dann zu Löhnen, die wegen des Überangebots von Arbeitskräften nicht mal für das Essen ausreichen, ein perfides, staatlich gestütztes Ausbeutungssystem hat sich etabliert, ermöglicht durch eine der marxschen entsprechende, agrarische Reservearmee.
In all dieser Not zeichnet Steinbeck seine durchweg sympathischen Figuren als einfältige, skurrile, ungebildete Menschen, die gleichwohl aufrichtig durchs Leben gehen und stets ihre Würde wahren, allem Unbill zum Trotz. Berührend ist dabei auch der fast schon archaische Wille der Familie, zusammenzuhalten, komme was da wolle. «Früchte des Zorns» wird als realistischer Roman chronologisch erzählt, wobei der dialogreichen Geschichte der Familie auf ihrer Reise ins vermeintliche El Dorado jeweils ein zusammenfassendes Kapitel politischen, ökonomischen oder soziologischen Inhalts vorangestellt wird, das in diesem realistischen Roman als kontemplativ wirkender Hintergrund dient. Der dickleibige Roman ist ein großartiges Zeitzeugnis mit einer Botschaft, die nichts an Aktualität eingebüßt hat über all die Jahre, denn die darin angeprangerten kapitalistischen Mechanismen sind im Prinzip zeitlos, also unverändert auch heute noch wirksam. Ein hervorragender Roman des vergangenen Jahrhunderts!
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Von dieser Welt
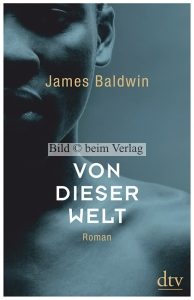 Apokalyptisches Klagelied
Apokalyptisches Klagelied
Der Hype um den in den USA wiederentdeckten farbigen Schriftsteller James Baldwin hat nun auch uns erreicht, die aktuelle Neuübersetzung seines autobiografischen Debütromans von 1953 «Go Tell It on the Mountain» wird vom Feuilleton allenthalben gefeiert. Wobei der Titel der neuen deutschen Ausgabe «Von dieser Welt» ein wenig ablenkt von dem, was den Leser wirklich erwartet, bezieht sich doch der Originaltitel auf ein allseits bekanntes, oft gehörtes Spiritual. Womit das beherrschende Thema des Romans weitaus treffender verdeutlicht wird, es geht nämlich um religiöse Inbrunst, ausgelöst hier durch das schreiende Unrecht der Rassendiskriminierung. Die aber ist auch heute noch weitgehend unveränderte Wirklichkeit im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten», entsprechende Nachrichten von dort, untermauert durch die einschlägigen Polizeistatistiken, erinnern uns regelmäßig wieder daran. Und der offen rassistische Präsident ist als Nachfolger des ersten Farbigen in diesem Amt ein überdeutliches Indiz für diese reaktionäre Entwicklung, eine Rolle rückwärts also in der Rassenfrage. «Sein Werk altert nicht» heißt es über Baldwin im Vorwort, dabei wünscht man sich, dieser Roman wäre weniger aktuell.
Anders als die meisten seiner Zunft entwickelt Baldwin seine Thematik fast ausschließlich aus dem Innenleben seiner Figuren heraus, berichtet von den seelischen Verheerungen, die das schreiende Unrecht bei der unterdrückten farbigen Bevölkerung anrichtet. In der Rahmenhandlung der im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts angesiedelten Geschichte fungiert John als äußere Klammer, er droht auf der Suche nach sich selbst zu scheitern. «Alle hatten immer gesagt, John werde später mal Prediger» lautet der erste Satz. Als ihm 1935, am Morgen seines 14ten Geburtstages, seine nächtliche Masturbation bewusst wird, als in seiner Fantasie ein Fleck an der Zimmerdecke sich in eine nackte Frau verwandelt, ist sein Schrecken grenzenlos, er fühlt sich auf ewig verdammt. Der Tag endet in der Kirche, wo er in einer rauschhaften Erweckungsszene, im rasenden Kampf wütend mit sich selbst ringend, vor dem Altar liegt und endlich zu Gott findet.
In drei Teilen behandelt der Roman in Rückblicken die Biografie von Johns Stiefvater, unerbittlicher Laienprediger und böser Heuchler zugleich, von seiner Mutter und der Schwester des Vaters. Alle drei waren Kinder von Sklaven, die der Gewalt des Südens zu entkommen suchten, um dann in New York das Elend zu finden. Baldwin thematisiert den Hass der Farbigen, wobei der sich erstaunlicher Weise gegen sie selbst richtet, sie fühlen sich schuldig und sind Opfer ihrer Selbstverachtung. Ihr Leben wird bestimmt von Armut, Angst, Hass, Gewalt, – und von der Hölle, die ihnen ein rigider Pietismus unermüdlich einredet, indem er selbst alltägliche Ereignisse permanent als Menetekel an die Wand malt, immer nach dem Motto: Es gibt keine Unschuldigen! Als Sohn eines Baptistenpredigers ist dem Autor dieser religiöse Fanatismus quasi schon mit der Muttermilch eingegeben, die fatale Lebensfeindlichkeit seiner Geschichte ist also vorbestimmt, verschärft noch durch seine, auch im Roman anklingende, Homosexualität. Die naive Gläubigkeit seiner Figuren dient als Ausweg aus ihrem Dilemma, kompensiert den Unbill ihres prekären Lebens.
Streckenweise liest sich dieser Roman, seiner unverblümten Indoktrination wegen, wie naivste Erbauungsliteratur, deren Sprache in Diktion, Melodie und Rhythmus, in ihren häufigen Wiederholungen zudem, stark an das Alte Testament erinnert. Vergleicht man Baldwin mit Jerome David Salinger, Harper Lee, William Faulkner, E. L. Doctorow, so fällt die einseitige Perspektive von Baldwin auf, er stimmt ein apokalyptisches Klagelied an, das alle anderen Aspekte ausblendet und die Welt einseitig als Jammertal darstellt. Spätestens bei der Religion aber endet jede rationale Diskussion, über die Lesefrüchte, die dieser Roman uns beschert, hüllen wir also besser den Mantel des Schweigens.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Der Stechlin
 Ein literarisches Labsal
Ein literarisches Labsal
Nur wenige Wochen vor seinem Tode hat Theodor Fontane die Arbeit an dem Roman «Der Stechlin» beendet, ein Zeitroman nach eigenem Bekunden. Als typischer Vertreter des bürgerlichen Realismus hat er mit diesem 1898 erschienenen Buch ein literarisches Meisterwerk geschaffen, es wird als sein bedeutendster Roman angesehen. Und das, obwohl fast nichts geschieht darin! In einem Brief an seinen Verleger hatte er dazu geschrieben: «Zum Schluss stirbt ein Alter und zwei Junge heiraten sich; das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht. Alles Plauderei, Dialog, in dem sich die Charaktere geben, mit und in ihnen die Geschichte». Diese Art eines Plots in Form der Causerie ist hier auf die Spitze getrieben, Konversation vom Feinsten also, geistreich, wortgewaltig, amüsant, ein literarisches Labsal.
Protagonist des Romans ist der 66jährige Dubslav von Stechlin, Schlossherr in der Grafschaft Ruppin, ein Major a. D. und märkischer Junker, dessen Besitzung den gleichnamigen, von Legenden umwobenen See mit einschließt. Fontane charakterisiert seine Figur im Roman als «eines jener erquicklichen Originale, bei denen sich selbst die Schwächen in Vorzüge verwandeln». Dessen Lebensumstände beschreibt nun Fontane, indem er uns einen Besuch des Sohnes Woldemar, Rittmeister in Berlin, auf Schloss Stechlin schildert. Dabei wird auch das nahe gelegene Kloster Wutz besucht, dessen Domina des alten Stechlins ältere Schwester ist, eine sauertöpfische Pietistin. Über sie heißt es: «Wickelkinder, wenn sie sie sehen, werden unruhig, und wenn sie zärtlich wird, fangen sie an zu schreien». In Berlin schließlich wirbt Woldemar um die Tochter eines reichen Adeligen, in Stechlin scheitert derweil der Alte – ziemlich erleichtert übrigens – bei der Reichstagswahl als Kandidat der Konservativen. Woldemar wird als Repräsentant seines Regiments auf eine Mission nach England geschickt, verlobt sich nach der Rückkehr und reist schließlich mit seiner Verlobten zu Weihnachten nach Stechlin. Im Frühjahr dann findet die Hochzeit statt, und ausgerechnet während der mehrwöchigen Hochzeitsreise nach Italien erkrankt zuhause der Alte und stirbt wenig später.
Die Geschichte wird von einem auktorialen Erzähler – aus kritischer Distanz – chronologisch erzählt, sie umfasst einen Zeitraum von etwa einem Jahr, über die Jahre 1896/97 hinweg. Die Figuren sind wunderbar treffend, geradezu brillant charakterisiert, was sich in weiten Teilen insbesondere in herrlichen, vor Geist und Witz geradezu funkelnden Dialogen artikuliert, in einer fiktionalen, natürlich ironisch überhöhten Konversation. Und dabei ist speziell die Figur des alten Stechlin von einer tiefen Menschlichkeit geprägt, die Standesunterschiede zwar nicht negiert, im Umgang mit den einfachen Leuten aber von wohltuender Konzilianz ist. Was insbesondere auch für seinen treuen Diener Engelke gilt, der immerhin fünfzig Jahre mit ihm durchlebt hat. Gerade die altväterliche Sprache, in der diese Geschichte erzählt ist, macht den Reiz dieses vor mehr als 120 Jahren geschriebenen, großen Romans aus. Sie lässt die vielen markanten, oft skurrilen, aber fast immer auch sehr sympathischen Figuren vor des Lesers Augen lebendig werden, wobei das weibliche Gegenstück zu Dubslav die ältere Schwester der Braut ist, die ebenso geistreiche wie schöne Melusine, – was für ein Name!
Ich habe diesen Roman vor Jahren als Hörbuch kennen gelernt, unübertrefflich gelesen von Gert Westphal, und schon damals ging es mir so wie jetzt wieder bei der Lektüre: Ich fühlte mich so wohl wie die Katze auf der warmen Ofenbank, ich hätte schnurren können vor Behagen! Außer dem unterhaltsamen Wohlbehagen, das kaum ein anderer Roman derart verschwenderisch erzeugen kann, ist der Leser auch tief hineingezogen in die politischen Verhältnisse der damaligen Epoche, die Fontane bei all seiner offensichtlichen Sympathie für das ostelbische Junkertum hier auch gesellschaftskritisch beleuchtet. Ein Jahrhundertroman!
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
Die Aspern-Schriften
 Vom steinernen Zölibatär
Vom steinernen Zölibatär
Der im angelsächsischen Sprachraum als Kultautor verehrte Schriftsteller Henry James hat auch in dem Roman «Die Aspern-Schriften» von 1888 ein grandioses Beispiel geliefert für seine Kunst, psychologisch ausgefeilte Frauenfiguren zu erschaffen, das andere Geschlecht also vielschichtig und tiefgründig darzustellen. Dabei bleibt allerdings eine – nicht ganz unwichtige – Komponente des Weiblichseins völlig ausgeschlossen. Der Autor hat sich selbst mal als einen «sexuellen Selbstversorger» bezeichnet, seine Geschichte – wen wundert’s – ist ein geradezu puritanisch anmutender Text ohne jeden erotischen Esprit. Aber auch Wittgenstein hat ja in seinem berühmten Tractatus logico-philosophicus gefordert: «Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen». Es bleibt aber, das sei vorweg gesagt, genügend übrig aus dem fragwürdigen Innenleben seiner Figuren, was diesen subtilen Roman trotzdem zu einem Lesevergnügen werden lässt.
In einem kammerspielartigen Plot mit nur drei Hauptfiguren und einem verfallenen Palazzo in Venedig als Bühne wird die Geschichte einer literarischen Obsession erzählt. Ein amerikanischer Ich-Erzähler, der namenlos bleibt und auch altersmäßig unbestimmt, ist als Herausgeber von Werken des – etwa um 1820 herum – jung verstorbenen, romantischen Dichters Jeffrey Aspern auf der Suche nach hinterlassenen Schriften von ihm. Dabei ist er auf Juliana Bordereau gestoßen, die einst zu seinen Musen gehörte und in seinem Werk etliche Spuren hinterlassen hat. Sie lebt hochbetagt mit Tina, ihrer Nichte ebenfalls unbestimmten Alters, die genau so gut auch ihre Großnichte sein könnte, völlig zurückgezogen in Venedig. Auf schriftliche Anfrage wird der Romanheld denn auch brüsk abgewiesen, also versucht er mit einer List, in die Nähe der uralten Dame, – eine Hundertjährige mutmaßlich -, und damit auch an die bei ihr vermuteten, begehrten Papiere zu kommen, Liebesbriefe höchstwahrscheinlich. Und tatsächlich zieht er unter falschem Namen und unter einem trickreichen Vorwand für eine horrende Summe als Untermieter in den Palazzo ein und kann auch tatsächlich, nach anfänglich eiskalter Abweisung seitens der Damen, allmählich einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Seine wahnhafte Gier nach schriftlichen Zeugnissen seines Dichter-Idols, den er auf einer Stufe sieht mit Shakespeare, lässt ihn alle Demütigungen ertragen und bringt ihn finanziell an den Rand des Ruins. Moralische Skrupel kennt er nicht, «es gibt keine Niederträchtigkeit, die ich nicht um Jeffrey Asperns willen begehen würde» sagt er im Roman. Der Nichte verrät er schließlich den wahren Grund seines Aufenthalts im Palazzo, und nach dem ersten Schrecken deutet sie vage an, ihm vielleicht ja helfen zu können.
Die in neun Kapiteln konventionell erzählte, spannende Geschichte, die zeitlich nur einige wenige Monate umfasst, steigert sich in einer geschickten Dramaturgie auf ein so nicht unbedingt vorhersehbares Ende zu. Mit ihrem kenntnisreichen Nachwort gibt die Übersetzerin dem Leser eine hochwillkommene Ergänzung des Textes zur Hand, die auf dessen viele Bezüge zum Ambiente Venedigs eingeht, auf die im Roman beschriebenen Kunstwerke zudem, vor allem aber auf das verwirrend komplexe psychische Geflecht der drei Protagonisten. An dieser Stelle erfahren wir auch, dass all dem eine Anekdote zugrunde liegt von einem Geschehen, das sich im Jahre 1879 in Florenz zugetragen habe, – mit identischem Ausgang der Geschichte übrigens.
Der sprachlich recht altbackene Roman mit seiner enigmatischen Erzählweise lässt den Lesern reichlich Raum für eigene Interpretationen. Mit kriminalistischen Anklängen wird da von beiden Seiten ein ebenso schlitzohriger wie erbitterter, skrupelloser Kampf zwischen den Damen und dem im Nachwort als «steinerner Zölibatär» bezeichneten Ich-Erzähler geführt. Keiner von ihnen kann wirklich gewinnen, was einen nicht unwesentlichen Teil des – zugegeben – schadenfrohen Lesevergnügens ausmacht, bei mir war es jedenfalls so!
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Das Ende einer Affäre
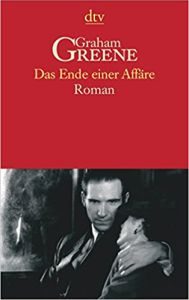 Der dritte Mann
Der dritte Mann
Auf der im Dezember 2015 von der BBC veröffentlichten Liste der hundert bedeutendsten britischen Romane ist Graham Greene dreimal vertreten, wobei sein Roman «Das Ende einer Affäre» von den 82 nicht-britischen Juroren als sein bester auf Platz 31 gewählt wurde. Das 1951 erschienene Buch des mehrfach erfolglos für den Nobelpreis nominierten Autors wurde zweimal verfilmt, es gibt auch eine Adaption als Oper. Beherrschende Themen seiner Werke ist das Menschsein insbesondere in Hinblick auf Schuld, Verrat und Glaube, er wird wegen seiner religiösen Bindung zu der in Frankreich entstandenen literarischen Bewegung Renouveau catholique, der Religiösen Erneuerung gerechnet. Seine frühen Romane sind von einer düsteren, traurigen Atmosphäre gekennzeichnet, für die im englischen Sprachraum der Begriff «Greeneland» geprägt wurde. Auch der vorliegende Roman zählt dazu, er gehört thematisch zu den «catholic novels» dieses Autors. Es finden sich darin diverse autobiografische Bezüge, auch der Ich-Erzähler des Romans ist Schriftsteller, hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau, und eine Konversion zum katholischen Glauben, wie sie der Autor auch selbst vollzogen hat, ist letztendlich das Schlüsselelement dieser moralinsauren Geschichte.
Maurice Bendrix, lediger und wenig erfolgreicher Schriftsteller, hat während des Zweiten Weltkriegs eine leidenschaftliche Affäre mit Sarah, der Frau des hohen Beamten Henry Miles in London, deren kinderlos gebliebene Ehe in liebloser Alltagsroutine erstarrt ist. Als bei einem Rendezvous ganz in der Nähe eine deutsche V1-Rakete einschlägt und Sarah Maurice im Hausflur tot unter Trümmern liegen sieht, gelobt sie Gott, – an den sie nicht glaubt -, im Gebet verzweifelt, die Liaison sofort zu beenden, wenn Maurice wieder lebendig würde. Der aber war tatsächlich nur ohnmächtig und konnte sich fast unverletzt aus den Trümmern befreien. Sarah fühlt sich nun an ihr Gelöbnis gebunden und wendet sich von ihrem Geliebten ab, ohne ihm den Grund zu sagen. Nach mehr als einem Jahr, in dem sie sich nicht sehen, trifft der eifersüchtige Maurice, der an einen neuen Liebhaber glaubt, 1946 zufällig Sarahs Mann. Der erzählt ihm bei einem Drink von seiner Befürchtung, dass Sarah ihn betrügt, er zögere aber, des Skandals wegen, einen Detektiv zu engagieren. Maurice, immer noch rasend eifersüchtig, greift Henrys Idee auf und engagiert seinerseits einen Detektiv. Es findet sich aber kein neuer Liebhaber, nur ein charismatischer Atheist und Straßenredner, den Sarah regelmäßig aufsucht, damit er sie von der Nichtexistenz Gottes überzeuge. Was sie letztendlich dann von ihrem Gelübde entbinden würde, denn sie liebt Maurice nach wie vor inniglich.
Die in fünf «Bücher» untergliederte Geschichte wird, abgesehen von einer längeren Tagebuch-Passage, von Maurice in Ich-Form erzählt. In dem Tagebuch, das sich direkt an Gott wendet, lesen wir von Sarahs verzweifelten Versuchen, gottgläubig zu werden, ihre Schuld zu sühnen, ihren Seelenfrieden wieder zu finden. Liebe und Glaube stehen sich hier also als moralische Instanzen entgegen und zerstören Sarah seelisch durch ihre tragische Unvereinbarkeit. Die ja, das lehrt diese Geschichte, nicht Gott anzulasten ist, sondern dem katholischen Klerus mit seinen ebenso willkürlichen wie unversöhnlichen Dogmen. In Maurice aber, der inzwischen selbst an die Existenz Gottes glaubt, ist nur tiefer Hass ihm gegenüber.
Der Plot wirkt arg konstruiert, er ist ganz in Hinblick auf das moralische Dilemma seiner weiblichen Protagonistin angelegt, das der Autor hier wenig glaubwürdig vor uns ausbreitet. Das uralte Thema der Frau zwischen Ehemann und Liebhaber erfährt hier eine Ausweitung ins Metaphysische, Gott selbst ist der dritte Mann in diesem Rührstück, dessen Kernthema einer Konversion zum Katholizismus banal und langatmig abgehandelt wird von einem missionarisch bemühten Graham Greene. Schade, dass er sein literarisches Können hier so naiv zweckgebunden eingesetzt hat!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Der Nazi und der Friseur
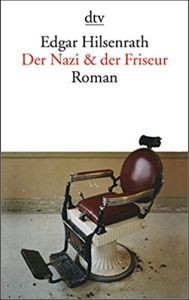 Widerlegt Adornos Diktum
Widerlegt Adornos Diktum
Bis auf wenige Ausnahmen erfolgt die literarische Aufarbeitung des Holocausts unverändert in ehrfürchtiger Betroffenheit aus der Sicht der Opfer. Edgar Hilsenrath verlässt mit seinem Roman «Der Nazi und der Friseur» diesen Konsens, er erzählt aber nicht nur aus der Täter-Perspektive, sondern benutzt unbeirrt auch noch die Form des Schelmenromans, damit genüsslich sämtliche gängigen Klischees zu diesem höchst sensiblen Thema ad absurdum führend. Obwohl von dem 1971 in den USA erschienenen, auf Deutsch verfassten Roman bereits mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft waren, wurde das Buch damals von mehr als 60 deutschen Verlagen unter fadenscheinigen Gründen feige abgelehnt, ehe es 1977 schließlich doch noch auch in Deutschland erschien, – mit großem Erfolg übrigens, gleich vom Start weg!
In dem als Groteske angelegten Plot erzählt der SS-Mann Max Schulz seine Lebensgeschichte. Als Sohn einer Nutte verbindet den aufgeweckten Jungen eine innige Freundschaft mit Itzig Finkelstein, dem Sohn des jüdischen Friseurs in der Nachbarschaft. Itzig ist gut aussehend, blond und blauäugig, während der arische Max wie ein Jude aussieht, schwarzhaarig, mit Hakennase, wulstigen Lippen und schlechten Zähnen. Bei Itzigs Vater lernt er schließlich den Beruf des Friseurs und arbeitet dort jahrelang sehr erfolgreich. Als die Naziherrschaft beginnt, tritt Max in die SA ein und wechselt später zur SS. Er folgt im Krieg mit seiner Einheit der Wehrmacht in die besetzten Gebiete Russlands, um dort die Juden auszurotten. Max landet 1942 schließlich als Aufseher im KZ Laubwalde in Polen, wo er im Winter 1944 auf der Flucht vor der Roten Armee von der Front überrollt wird. Bis Kriegsende versteckt er sich bei der alten «Waldhexe» Veronja und macht sich schließlich mit einem Sack voller Goldzähne aus dem KZ auf den Weg nach Deutschland. Die polnischen Behörden halten ihn für tot, sie identifizieren eine Leiche im Wald als den gesuchten SS-Mann Max Schulz.
In Deutschland nimmt Max die Identität von Itzig Finkelstein an, der den Holocaust nicht überlebt hat. Er besorgt sich neue Papiere, lässt sich von einem verschwiegenen Arzt beschneiden, seine SS-Tätowierung wegoperieren und eine Auschwitznummer auf den Arm tätowieren. Mit den Goldzähnen als Startkapital macht er nun Geschäfte am Schwarzmarkt in Berlin, bis ihn seine «blonde Gräfin» bei einer riskanten Transaktion um sein gesamtes Kapital bringt. Als die Gründung eines jüdischen Staates greifbar wird, entschließt er sich, stets in Furcht vor seiner Enttarnung, zur Emigration nach Palästina. Er fasst schnell Fuß dort und baut den neuen Staat Israel mit auf, heiratet auch, macht einen Friseursalon auf und beteiligt sich an den Kriegen mit den arabischen Nachbarn. Immer wieder aber holt ihn die Vergangenheit ein, ist er in Gedanken Max Schulz und nicht Itzig Finkelstein. Am Ende geht er gar eine Wette mit einem pensionierten Amtsgerichtsrat ein: Er sei sicher, dass Max Schulz lebe. Aber keiner nimmt ihn ernst, er habe einen Dachschaden von den schrecklichen Erlebnissen, heißt es, – aus seiner Rolle kommt er nicht mehr heraus!
In dieser mit schwärzestem Humor gewürzten, spannenden Groteske berichtet Ich-Erzähler Max in betont naiver Sprache geradezu lapidar von dem Ungeheuren, das er miterlebt oder als Täter – ohne jedes Schuldgefühl – selbst begangen hat. Der durch einen realen Fall inspirierte Hilsenrath konterkariert mit seiner scharfsinnigen Verspottung des verlogenen Philosemitismus auch die gängige Erwartungshaltung der Leser. In absurden Szenen ist sein ambivalenter Romanheld eine gelungene Karikatur seiner selbst, man kommt aus dem Schmunzeln kaum noch heraus, erfährt aber en passant auch viel Wissenswertes über die jüdische Geschichte, von der Thora über den Holocaust bis zur Gründung Israels. Zwischen abstrusem Witz und blutigem Ernst hat Hilsenrath hier literarisch eine bewundernswerte Balance gefunden und Adornos berühmtes Diktum über Auschwitz widerlegt.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Irgendwas ist immer
Tucholsky: Humor mit fünf Sinnen
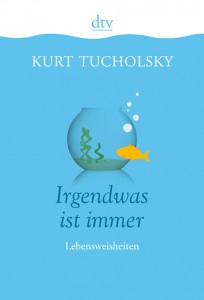 „Besser ein Anzug nach Maß als eine Gesinnung von der Stange“, schreibt der Mann, der Zeit seines Lebens wohl nie in einen Anzug gepasst hätte: Kurt Tucholsky. Den einen war er zu links, den anderen zu konservativ und doch hat „Tucho“ – ein Pseudonym mit dem er gerne seine Briefe unterschrieb – sie alle zum Lachen gebracht. Der „kleine Berliner, der mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte“ (Erich Kästner) war nicht nur ein begnadeter Feuilletonist, sondern auch Schriftsteller und Kabarettist. Niemals analysierte er die Welt als Parteigänger einer bestimmten politischen Richtung, sondern immer als Mensch und zwar als Mensch mit „allen fünf Sinnen“, wie auch der Herausgeber, Günter Stolzenberger, im Nachwort betont. Seine Lyrik ist zutiefst humanistisch, denn seine Themen greifen aus dem Alltagsleben und egal ob er über politische Schandtaten oder defekte Wasserhähne schreibe, immer habe er es mit dem Augenmaß der einfachen Menschen getan, die ihn auch verstanden und sogar seine Chanson und Lieder sangen.
„Besser ein Anzug nach Maß als eine Gesinnung von der Stange“, schreibt der Mann, der Zeit seines Lebens wohl nie in einen Anzug gepasst hätte: Kurt Tucholsky. Den einen war er zu links, den anderen zu konservativ und doch hat „Tucho“ – ein Pseudonym mit dem er gerne seine Briefe unterschrieb – sie alle zum Lachen gebracht. Der „kleine Berliner, der mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte“ (Erich Kästner) war nicht nur ein begnadeter Feuilletonist, sondern auch Schriftsteller und Kabarettist. Niemals analysierte er die Welt als Parteigänger einer bestimmten politischen Richtung, sondern immer als Mensch und zwar als Mensch mit „allen fünf Sinnen“, wie auch der Herausgeber, Günter Stolzenberger, im Nachwort betont. Seine Lyrik ist zutiefst humanistisch, denn seine Themen greifen aus dem Alltagsleben und egal ob er über politische Schandtaten oder defekte Wasserhähne schreibe, immer habe er es mit dem Augenmaß der einfachen Menschen getan, die ihn auch verstanden und sogar seine Chanson und Lieder sangen.
Animation zum Denken
Das Leben und Leiden der einfachen Menschen sei stets im Fokus seines Engagements gestanden und durch stilistische Meisterschaft habe er es mittels seines federleichten Humors auch erträglicher gemacht, wer in seinem Werke wühle, so Stolzenberger, der gehe in den Wald in einem guten Pilzjahr: „Man hat nicht nur die Freude des Findens sondern kehrt auch noch mit vollem Korb zurück.“ Und so hat sich zu dem einen Büchlein, das sich seinen Lebensweisheiten widmet, auch gleich ein zweites gesellt, das mehr seine Lieder, Chansons und Schmonzetten beinhaltet. Zwischen 1907 und 1932 hat Kurt Tucholsky unter den unterschiedlichsten Pseudonymen insgesamt 2500 Artikel, Feuilletons und Reiseberichte, 800 Gedichte, Stellungnahmen zum Zeitgeschehen, zwei Liebesromane und ein Reisebuch veröffentlicht. Da ihm Bücher „zu langsam“ waren bevorzugte er es zeit seines Lebens Woche für Woche eine ganze Reihe Zeitungen und Zeitzschriften mit seinen Texten zu bombardieren, darunter Die Weltbühne, Vorwärts, das Berliner Tageblatt und viele andere mehr. Theobald Tiger – so eines seiner Pseudonyme – habe die Massenkultur mit ihren eigenen Mitteln bekämpft, denn er nutzte die Form der Unterhaltung, „um es klammheimlich oder offen zum Denken zu animieren“, so der Herausgeber.
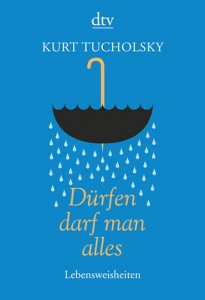
Tucholskys gestossne Seufzer
Peter Panter – auch das ein Pseudonym – blieb auch als Dichter Journalist, denn zu genau und treffend sind seine Beschreibungen und Analysen des alltäglichen Lebens in der Weimarer Republik. Der als Schüler ausgerechnet in Deutsch sitzen gebliebene legte sein Abitur ab, um wenig später ein juristisches Studium in Bestzeit abzuschließen. Seine ersten Texte werden ausgerechnet von einer Zeitschrift namens „Ulk“ veröffentlicht, aber auch Pan, März und Simplicissimus drucken seine Glossen und Gedichte. Als Ignaz Wrobel oder Kaspar Hauser schreibt er Satire und wird nach Ableisten seines Militärdienstes auch bald politisiert, denn schließlich erlebte er auch den Ersten Weltkrieg und kannte die Verheerungen die der Krieg in einem Land und seiner Bevölkerung hinterlässt. Sein kurzes Tete a Tete mit der USPD und deren Zeitung Freiheit mögen ihm manche Demokraten übel nehmen, aber Tucholsky blieb doch stets Kabarettist. 1924 wird er sogar Korrespondent in Paris und pendelt zwischen den beiden Hauptstädten in denen er jeweils eine Geliebte und eine Ehefrau hat. „Golf“, schreibt Tucholsky an einer Stelle, „ist ein verdorbener Spaziergang“, aber man könne einen Hintern schminken, wie man wolle, es werde nie ein ordentliches Gesicht daraus. „Mensch, wenn du so lang wärst wie de dumm bist, könntste aus der Dachrinne saufen“. Diese und weitere Lebensweisheiten können sie in den beiden Sammlungen von Günter Stolzenberger „Dürfen darf man alles“ und „Irgendwas ist immer“, erschienen als Hardcover-Taschenbuch bei dtv nachlesen. Und zu guter letzt noch ein „gestossner Seufzer“ aus dem Tucholsky-Gedicht „Ein gestossner Seufzer“, das sich wunderbar als Motto für einen langen Ausgehabend eignet: „Trink aus der Nachbarin Champagnerglas!/Bleib schuldig Miete, Liebe, Arzt und Glas!/Bezahl den Apfel – friß die Ananas!/Wer also handelt bringts zu was.“
Günter Stolzenberger (Hrsg.)
Kurt Tucholsky
Dürfen darf man alles. Lebensweisheiten
EUR 9,90 € [DE], EUR 10,20 € [A]
dtv Literatur
Herausgegeben von Günter Stolzenberger
176 Seiten, ISBN 978-3-423-14011-9
Günter Stolzenberger (Hrsg.)
Kurt Tucholsky
Irgendwas ist immer. Lebensweisheiten
EUR 12,00 € [DE], EUR 12,40 € [A]
dtv Literatur
Originalausgabe, 208 Seiten, ISBN 978-3-423-28119-5
7. April 2017
Die dreifache Maria
 Peregrina
Peregrina
Der kürzlich verstorbene Peter Härtling hinterlässt ein breit gefächertes literarisches Werk aus Lyrik und Prosa, in dem er sich thematisch der Aufarbeitung der Geschichte widmet, auch der eigenen. Wobei die Romantik einen Schwerpunkt bildet in seinem Œuvre, eine ganze Reihe von Roman-Biografien über Musiker und Dichter dieser Epoche künden davon, und ebenfalls dazu gehört das 1982 veröffentlichte Büchlein «Die dreifache Maria». Eng eingebunden in viele seiner Werke ist außerdem die Heimat, bei ihm das als seine Wahlheimat geltende Württemberg, dessen Mundart sich immer wieder findet in seiner Geschichte von der folgenreichen Begegnung Eduard Mörikes mit der ebenso schönen wie geheimnisvollen Maria Meyer.
Als er in einem Ludwigsburger Gasthaus, wo sie als Bedienung arbeitet, 1823 auf Maria trifft, verliebt sich der junge Dichter heftig in das ungewöhnlich attraktive Mädchen. «Eine junge, tollkühne Person», beschreibt Härtling sie, «die aus erprobter Freiheit auf keine Regel achtet, die sich, immerfort lügend, Wahrheiten zutraut, die ihre Begierden und Hoffnungen nicht unterdrückt, sondern unverhohlen auslebt, die, wenn sie liebt, nicht auf Anstand und Absprache achtet, sondern sich preisgibt, die weiß, dass sie für die Gesellschaft, in die sie geriet und die sie ohne Gewissensbisse ausnützt, ein rätselhaftes Wesen darstellen soll, die schöne Fremde, die romantische Vagantin, die herausbekommen hat, wie sie in die Zeit passt, als Hilflose, Verlorene oder als tanzende Zigeunerin, die nichts besitzt als ihren Mut, ihre Leidenschaft, ihre Kenntnisse, ihre Schläue». Die authentische Figur der Maria Meyer aus Schaffhausen ist ähnlich von Mythen umrankt wie Johann Georg Faust aus Knittlingen. Sie gehörte zum Gefolge der Schriftstellerin Juliane von Krüdener, die als Galionsfigur eines prophetisch-ekstatischen Pietismus gilt, eine Sektenstifterin mit großem Einfluss, die immerhin den russischen Zaren auf dem Wiener Kongress vertreten hat.
In fünf Kapiteln beschreibt Härtling das Leben des 1804 geborenen Eduard Mörike, beginnend mit dem Kapitel «Flucht», in dem die Adoleszenz des kränkenden Schülers beschrieben wird, er behandelt ferner in «Die Kinderbraut» die erste Liebe des angehenden Poeten. Die titelgebenden drei Kapitel schließlich erzählen zunächst unter «Maria Meyer» von der aufwühlenden Begegnung der fortan unsterblich Verliebten, unter «Peregrina» von der späteren, natürlich lyrischen Umsetzung dieser großen Liebe in dem gleichnamigen Gedicht-Zyklus, und sie enden schließlich mit einem letzten Blick der inzwischen verheirateten «Maria Kohler» auf ihren Eduard, der dann spät, erst 1851 heiratet. Die stürmische Schwärmerei des Jünglings zu der Unperson Maria hat ihn seelisch zwar noch auf Jahre hinaus beschäftigt, ging aber über eine von ihm schon bald abgebrochene Korrespondenz nicht hinaus. Schließlich brach der Kontakt nach einem von ihm brüsk verweigerten Wiedersehen ein Jahr später völlig ab. Zu übermächtig war wohl der empörte, ablehnende Einfluss seiner frömmelnden Familie auf den zögernden, wankelmütigen Mörike. Immerhin aber verdankt die lesende Nachwelt dieser Begegnung jenen berühmten Gedichtzyklus, mit dem er seine Jugendliebe als Pegrina zumindest literarisch unsterblich gemacht hat, ein weiteres Denkmal hat er ihr in dem Roman «Maler Nolten» gesetzt.
In wohlgesetzten Worten berichtet Härtling von den Geschehnisse so gekonnt, dass man gut nachvollziehen kann, welche seelischen Kämpfe der Protagonist mit sich auszufechten hat. Wenn schlussendlich der Pietist in ihm siegt, so schimmert bei aller Wohlanständigkeit doch stets auch eine gewisse Ungeduld über die eigene, lustfeindliche Spießigkeit mit durch, ja es nagt an ihm als innerster Zweifel sogar die Angst vor einem womöglich total verfehlten Leben. Was sprachlich altväterlich erscheint, ist trickreich der Epoche angepasst. Eine bereichernde Lektüre, die zudem amüsant ist, weil gelegentlich auch ganz köstlich geschwäbelt wird.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Frau Jenny Treibel
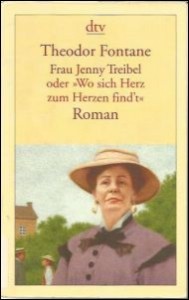 Vom Meister der Plaudertons
Vom Meister der Plaudertons
Dem Olymp der deutschen Schriftsteller zugehörig, ist Theodor Fontane ohne Zweifel der bedeutendste Romancier der Bismarck-Zeit, und «Frau Jenny Treibel», letzter seiner Berliner Romane, nimmt dabei den Spitzenplatz ein. Der Schillers Gedicht «Das Lied von der Glocke» entlehnte Untertitel «Wo sich Herz zum Herzen find’t» deutet ironisch auf einen Liebesroman hin. Die wahre Intention des Autors jedoch kann man einem Brief entnehmen: Dieser Roman sei geschrieben worden, erklärt er darin, um «das Hohle, Phrasenhafte, Lügnerische, Hochmütige, Hartherzige des Bourgeoisstandpunktes zu zeigen, der von Schiller spricht und Gerson meint». Mit Letzterem spielt er auf ein mondänes Modehaus der Hautevolee am Werderschen Markt in Berlin an, um damit das profan Materielle der Kleidermode in Gegensatz zum erhaben Geistigen des Dichterfürsten zu stellen, soziologisch also Bildungs- und Besitzbürgertum zu vergleichen. Wobei Fontanes uneingeschränkte Sympathie dem Geistigen gilt, und auch ein überschaubares Landleben zieht er der ungeliebten Großstadt mit ihren sozialen Fallstricken ganz entschieden vor.
Es findet sich kein Herz zum Herzen in diesem Roman, das ist die deprimierende Quintessenz dieser Geschichte, alles ist Kalkül, eine Ehe wird arrangiert und eine zweite initiiert, das alles natürlich nach erheblichen Irrungen und Wirrungen, um einen Romantitel Fontanes zu benutzen. Die Titelheldin verhindert letztendlich erfolgreich eine für die Familie finanziell unvorteilhafte Eheschließung Leopolds, ihres jüngsten, eher antriebslosen Sohnes, mit Corinna, der geistreichen und charmanten, aber vermögenslosen Tochter des verwitweten Gymnasialprofessors Schmidt. Der ist ein früherer Freier der aus einfachen Verhältnissen stammenden Jenny, die damals dann aber doch lieber den gut situierten und mit dem Ehrentitel Kommerzienrat bedachten Fabrikanten Treibel geheiratet hat. Und auch Corinna handelt mit hedonistischem Kalkül, will sich durch die Ehe mit Leopold ein finanziell sorgenfreies Leben sichern. Wie schon sein Bruder wird aber auch Leopold wohl in eine reiche Hamburger Familie einheiraten, die Mutter hat schon die entsprechenden Fäden gespannt, und die kluge Corinna geht in sich und heiratet schließlich einen viel besser zu ihr passenden Geistesmenschen, den angehenden Archäologen Marcell, ihren Vetter.
Wie immer bei Fontane entwickelt sich seine handlungsarme Geschichte fast vollständig aus einer äußerst lebendigen Konversation seiner Figuren heraus. Der dabei angeschlagene, ebenso gescheite wie amüsante und sympathische Plauderton erzeugt eine derart anheimelnde Atmosphäre, dass man als vergnügter Zuhörer gerne mit dabei wäre bei diesen, – natürlich dichterisch überhöhten -, Gesprächen der vielen Protagonisten. Wunderbar stimmig gezeichneten Figuren wie dem konzilianten Treibel oder dem durchgeistigten Prof. Schmidt mit seinen unter dem Signum «Sieben Waisen Griechenlands» regelmäßig zusammentreffenden Kollegen als Sympathieträgern stehen diametral die scheinheilige, sich permanent selbst belügende Jenny samt ihrer geltungssüchtigen, unbedarften, aber schönen Schwiegertochter gegenüber.
Insoweit ist dieser Roman über Schein und Sein weniger zeitgebunden, als es seine frühe Entstehungszeit vermuten lässt, die darin angeschnittenen Probleme jedenfalls sind ja durchweg auch heutig, der Tanz ums goldene Kalb ist virulent wie ehedem, und menschliche Selbstverwirklichung, zumal weibliche, bleibt immer noch ein weitgehend unerreichtes, hehres Ziel. Geistiges, Bildung vor allem, sofern sie nicht kommerziell verwertbar ist, zählt wenig gegenüber materiellem Besitz. Fontane ist all dies sehr verhasst gewesen, um so mehr erstaunt der versöhnliche, menschenfreundliche Duktus seiner Prosa. Die beim Leser immer wieder ein Schmunzeln auslöst und ihn, wenn er so geartet ist wie ich, in eine wohlig anheimelnde Stimmung versetzt, und ihm somit ein formidables Lesevergnügen beschert, – im wahrsten Sinne des Wortes.
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
Nachgetragene Liebe
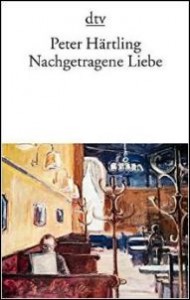 Von der Seele geschrieben
Von der Seele geschrieben
In dem autobiografischen Band «Nachgetragene Liebe» widmet sich der 1933 geborene Schriftsteller Peter Härtling seiner eigenen Vergangenheit, er erinnert sich darin an seine Kindheit bis hin zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zeitlich also denkungsgleich mit der unsäglichen Geschichte des Nationalsozialismus. Es ist eine späte Aufarbeitung des Verhältnisses zu seinem Vater, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Erinnerungen war Härtling immerhin schon sechzig Jahre alt. Im umfangreichen Werk dieses vielseitig interessierten, mit Vielem befassten Autors hat die Thematik des Erinnerns und der Bewältigung der Vergangenheit, sowohl in seiner Lyrik als auch in seiner Prosa, einen gewichtigen Anteil.
«Mein Vater hinterließ mir eine Nickelbrille, eine goldene Taschenuhr und ein Notizbuch, das er aus grauem Papier gefaltet und in das er nichts eingetragen hatte als ein Gedicht Eichendorffs, ein paar bissige Bemerkungen Nestroys und die Adressen von zwei mir Unbekannten. Er hinterließ mich mit einer Geschichte, die ich seit dreißig Jahren nicht zu Ende schreiben kann». Diesen einleitenden Worten folgt eine im Präsens erzählte Geschichte, beginnend mit den ersten Entdeckungstouren des fünfjährigen Peter Härtling auf dem Dreirad, der wissbegierig seinen Heimatort Hartmannsdorf bei Chemnitz erkundet. Schon die ersten Seiten dieser Erzählung erzeugen einen Sog, dem man sich als Leser kaum entziehen kann, mir ging es jedenfalls so, man fühlt sich wohl im Strom der Worte und will mehr wissen. Besonders reizvoll dabei ist die ungewohnte Ich-Perspektive eines Kindes, aus der heraus der Autor erzählt, er hat dafür eine überzeugende sprachliche Form gefunden, die man nirgendwo als aufgesetzt oder unglaubwürdig empfindet.
Härtlings Vater erscheint abweisend, fast unnahbar, ist als Richter und später als Rechtsanwalt immer beschäftigt, er ist die Respektsperson der Familie, nur selten auch Vollstrecker von Strafen, kümmert sich aber sonst kaum um die Erziehung des Sohnes. Umso stärker ist deshalb die Beziehung zur Mutter und zu den Großeltern, zu Onkeln und Tanten, die Peter in regem Wechsel gerne besucht. Zunehmend jedoch spielt die politische Situation in dieses friedliche Leben hinein, die Familie zieht nach Olmütz in Mähren um, wo sich Peter der Hitlerjugend anschließt, eine unbedachte und grobe Provokation seinen regimekritischen Eltern gegenüber, er entfernt sich dadurch erschreckend weit von seinem Vater. Der hilft als Anwalt tschechischen und jüdischen Mitmenschen gegen die Naziwillkür, ohne viel bewirken zu können, und wird bald zur Wehrmacht eingezogen, Peter sieht ihn für längere Zeit nicht mehr. Gegen Kriegsende, die Front rückt immer näher, taucht der Vater unerwartet wieder auf und evakuiert die Familie nach Zwettl in Niederösterreich. Dort hilft er im Chaos der Truppenauflösung als Offizier beherzt den flüchtenden Soldaten, indem er ihnen unautorisiert Entlassungsscheine ausstellt. Allmählich erscheint er dem vom Endsieg träumenden Peter in einem ganz anderen Licht. Kurz darauf jedoch stirbt der Vater in russischer Gefangenschaft, ohne dass Peter Gelegenheit zu einer Versöhnung mit ihm hatte, ohne dass er vorbehaltlos wieder Sohn werden konnte.
Als Zeitdokument beleuchtet dieses Buch eindrucksvoll das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, vor dessen Hintergrund sich schicksalhaft eine Vater-Sohn-Beziehung entwickelt, die mit ihrer zunehmender Entfremdung die politischen Ungeheuerlichkeiten widerspiegelt. Präzise erinnert, ebenso detailreich wie glaubhaft erzählt, entsteht das damalige Leben vor dem Auge des Lesers, und mittendrin immer Peter Härtling, der sich Jahrzehnte später hier offensichtlich etwas von der Seele schreiben musste.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Der Virtuose
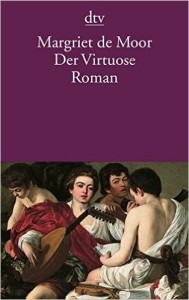 Ein Trockenstoß
Ein Trockenstoß
Mit Caravaggios Gemälde I Musici auf dem Frontdeckel und dem Titel «Der Virtuose» ist die Thematik des Romans von Margriet de Moor gekonnt verdeutlicht, auch die Zeit des Barock ist damit bereits benannt. Aber es geht um mehr als nur Musik, zu den Genüssen dieser als sinnenfroh beschriebenen Epoche gesellt sich hier als weiterer Aspekt die Liebe, in der reduzierten Spielart einer bedenkenlos ausgelebten und virtuos praktizierten Sexualität allerdings, beides bedingt sich geradezu. Den besonderen Kick aber erhält diese thematische Gemengelage noch dadurch, dass ausgerechnet ein Kastrat als Protagonist hier Virtuose und Liebhaber in Personalunion ist.
Der Erlös aus dem Verkauf seines Sohnes Gasparo ist der Einsatz in einem Spiel, welches sein spielsüchtiger Vater verliert. Der Sohn, mit einer wunderschönen Stimme gesegnet und von Carlotta maßlos bewundert, verschwindet daraufhin für immer aus dem Dorf, er landet in einem der einschlägig bekannten Internate für Kastraten. Jahre später trifft ihn Carlotta, lebenshungrige Tochter des damaligen Spielgewinners und inzwischen mit dem wesentlich älteren und wohlhabenden Berto verheiratet, in Neapel wieder, er ist ein gefeierter Sänger geworden. Binnen kurzem macht sie den unerfahrenen Jüngling zu ihrem Geliebten, ihr heißes Begehren ist unverkennbar auch musikalisch inspiriert. Denn sein betörendes Äußere als unmännlich schön erscheinender Adonis wirkt ebenso anziehend auf sie wie die himmlische Stimme, mit der er sein ihm zu Füßen liegendes Publikum verzaubert.
Mit viel Sachverstand schildert de Moor den Opernbetrieb jener Zeit, in der das Geschehen auf der Bühne zuweilen skurrile Formen annahm, bis hin zu – auf offener Bühne ausgetragen – Rivalitäten zwischen den Sängern. Allzu häufige Exkursionen in die tiefsten Geheimnisse der Phonetik und in die Besonderheiten zeitgenössischer Partituren, samt deren diverser Varianten der Interpretation, überfordern musiktheoretische Laien wie mich allerdings hoffnungslos, sie tragen daher auch rein gar nichts zum Lesegenuss bei. Eher kommen Voyeure auf ihre Kosten, sie erfahren immerhin, dass Sex mit Kastraten sehr wohl möglich ist, was auch ich nicht wusste, und was ein «Trockenstoß» ist. Carlotta lebt ihre hedonistische Maxime erfrischend offen aus, Musik und Sex, und zwar in Kombination miteinander, bilden nun mal ihr ganzes Lebensglück. Diese Hymne auf die Wollust ist eine Bejahung des menschlichen Daseins ohne Wenn und Aber. Emotional allerdings ist ihr Lover eine herbe Enttäuschung, mehr als freundschaftliche Zuneigung empfindet er nicht für sie, die Musik steht an erster Stelle in seinem Leben, und Frauen als solche sind ihm ebenfalls nicht so wichtig, ein schöner Gesangsschüler lockt ihn nicht weniger, ist am Ende sogar wichtiger für ihn als Carlotta. Sexuelle Anziehungskraft, eine Binsenweisheit ja eigentlich, hat eine kurze Halbwertszeit, sie taugt auf Dauer nicht als Bindemittel.
Der Roman ist in einer lebhaften, kurzweiligen Art geschrieben, sprachlich gekonnt und leicht lesbar mit gedanklichen Sprüngen, die den Leser zuweilen fordern, ohne ihn allerdings je den Faden verlieren zu lassen. Das Lokalkolorit ist plastisch eingefangen, bis auf ein kurzes Intermezzo über das Leben von Carlottas Zofe bildet der Kleinadel Neapels den gesellschaftlichen Hintergrund und die barocke Oper dessen alles beherrschende Projektionsfläche. Dabei wird dann auch klar, warum die Frauenrollen damals mit Kastraten besetzt waren, die man heute bei der Aufführung Alter Musik nur unzureichend durch Countertenöre zu ersetzen sucht. Was jedoch den Sex anbelangt, hätte der musikalischen Kunst eher die Erotik als Liebeskunst entsprochen, mit vergleichbaren emotionalen Empfindungen. Der Roman hingegen fokussiert das Geschehen einseitig auf den fleischlichen Akt, von dem wir ja wissen, dass er im vorliegenden Fall stets mit einem Trockenstoß endet, ein mit der fehlenden Erotik in dieser Geschichte durchaus vergleichbares Manko.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Das periodische System
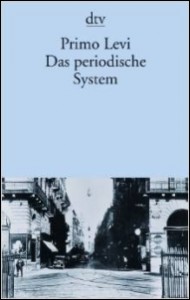 Belletristik vs. Populärwissenschaft
Belletristik vs. Populärwissenschaft
Chemie war im Gymnasium, lang ist’s her, eines der unerfreulichsten Fächer für mich, und so habe ich «Das periodische System» von Primo Levi denn auch einigermaßen skeptisch zur Hand genommen. Zum Teil mag es an meiner inzwischen gewachsenen Aufnahmebereitschaft liegen, ohne Zweifel jedoch ist es dem italienischen Chemiker und Schriftsteller vor allem gelungen, mit seinem diesbezüglichen Erzähltalent mein Interesse für den einst verschmähten Unterrichtsstoff zu wecken, mir die damals vergällte Lehre von den Stoffen – mangels Fachkenntnissen natürlich nur rudimentär – verständlich und damit auch einigermaßen zugänglich zu machen. Denn in den 21 Kapiteln seines autobiografischen Buches, deren jedes nach einem chemischen Element benannt ist, finden sich wahrhaft spannende Geschichten, – insoweit sollte das Buch Pflichtlektüre sein für Chemielehrer, deren Schüler einzuschlafen drohen.
Es sind nicht nur spannende Geschichten, die der jüdische Autor und Auschwitz-Überlebende zu erzählen weiß, es sind auch sehr bewegende Episoden aus seinem Leben, chronologisch lose aneinandergereiht, meist ohne direkten Zusammenhang. Beginnend mit einem Rückblick auf seine Vorfahren, dem er das träge Gas «Argon» als Kapitelüberschrift vorangestellt hat. «Das Wenige, was ich von meinen Vorfahren weiß, lässt sie diesen Gasen ähnlich erscheinen» schreibt er im ersten Kapitel, bei dem die Überlieferung innerhalb der Familie oder die Fantasie des Autors, vermutlich jedoch beides zusammen, in Anekdoten verpackt wahrhaft skurrile Ahnen aufzeigt, die eher Karikaturen sind als reale Figuren. Schon im zweiten Kapitel «Wasserstoff» geht es dann aber um Chemie, ein missglückter Laborversuch bei seinem Schulfreund, der mit einem Knall endete und bei dem Wasserstoff eine Rolle spielte, wie Levi richtig vorausgesagt hatte. Im Laufe seines Lebens als Chemiker wird er immer wieder mit Phänomenen konfrontiert, für die es zunächst keine logische Erklärung gibt, oder mit Problemen in der Produktion, die schwer in den Griff zu bekommen sind. Es ist tatsächlich auch für Laien interessant, wenn der Autor beschreibt, wie er sich dem Thema genähert, welche Erklärungen, welche Lösungen sich ergeben haben. Das erinnert sehr stark an kriminaltechnische Untersuchungen, man verfolgt viele Spuren, die alle nichts ergeben, bis dann endlich die richtige Fährte gefunden ist, die zum Erfolg führt.
Sicherlich das am meisten berührende Kapitel unter der Überschrift «Cer» handelt von seiner Zeit in Auschwitz, wo er als Häftling für die IG-Farben in einem Labor beschäftigt war. Unter Lebensgefahr hat er sich dort mit einem Freund zusammen durch Diebstahl von Cereisen und Umarbeitung zu runden Feuersteinen, wie sie für Feuerzeuge gebraucht werden, ein für ihr Überleben wichtiges Tauschgut geschaffen, mit dem sie genug Brot eintauschen konnten, bis schließlich die Rote Armee im Januar 1945 das KZ befreit hat. In einem ebenfalls beklemmenden Kapitel schildert er seinen geschäftlichen Kontakt zu einem ehemaligen Angestellten der IG-Farben, der ihn damals in Auschwitz fachlich überwacht hatte und nun, allerdings vergeblich, mit dem schweren Erbe seiner Vergangenheit umzugehen versucht.
Levi schreibt so begeistert von seinem Beruf, «der eigentlich ein Sonderfall, eine besonders wagemutige Form von Lebenskunst sei», dass auch der Leser unwillkürlich mitgerissen wird. Weniger beeindruckend ist allerdings die sprachliche Umsetzung seiner Geschichten, sein Schreibstil ist sachlich und schlicht, die Handlung geradlinig simpel, seine blutleeren Figuren bleiben unkonturiert, sie vermögen kaum Empathie zu wecken, und alles Private ist weitgehend ausgeblendet. Zwei deutlich früher entstandene, nicht autobiografische Kapitel hätte der Autor besser ganz weggelassen, sie wirken literarisch fast peinlich. Populärwissenschaft also, oder doch Belletristik? Ich bin mir da nicht so ganz sicher bei diesem zwiespältigen Buch!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de

