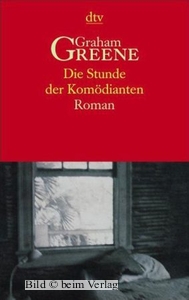 Wohl kaum nobelpreisfähig
Wohl kaum nobelpreisfähig
Mit «Die Stunde der Komödianten» hat der britische Schriftsteller Graham Greene einen der für ihn typischen Romane vorgelegt, in dem menschliche Eigenschaften wie Glaube, Schuld und Verrat in abenteuerlichen Geschichten thematisiert werden. Seine Romane sind zumeist im Stil von spannenden Kriminal- oder Spionagegeschichten erzählt, enthalten aber auch einige Thriller-Elemente in Stories, die politische Inhalte haben als Grundlage des Erzählstoffs. Der vorliegende Roman erweist sich als Kritik am Kolonialismus und dessen unrühmlichen Folgen. hier explizit am Terrorregime des Diktators François Duvalier, genannt ‹Papa Doc›, der die Macht auf Haiti vor allem durch die paramilitärische Miliz der Tonton Macoute an sich reißen konnte. Trotz der düsteren Atmosphäre, in der auch dieser Roman angesiedelt ist, fehlt es im Erzählten nicht an einer Prise des typischen schwarzen, britischen Humors, worauf ja auch der Buchtitel hinweist.
Und in der Tat, es sind skurrile Figuren, die 1963 auf einem kleinen Schiff von New York nach Haiti reisen. Protagonist des Romans und Ich-Erzähler ist der etwa 50jährige, in Monte Carlo geborene Mr. Brown, der nach drei Monaten in New York wieder nach Haiti zurückkehrt. In Rückblenden erzählt er von seinem Leben, er hatte in Europa einen lukrativen Handel mit gefälschten und falsch signierten Gemälden aufgezogen, die er jeweils einem jungen Maler in Auftrag gab. Mit den Fälschungen in einem Wohnwagen zog er als ambulante Galerie von Ort zu Ort und machte gute Geschäfte mit unwissenden Kunden, bis er irgendwann aufflog! Er floh nach Haiti, wo seine Mutter in Porte aux Prince ein respektables Hotel besaß, das er nach ihrem Tod geerbt hat. Voller Elan stürzte er sich ins Geschäft und brachte das Trianon erfolgreich zu neuem Glanz. Im Spielcasino lernte er Martha, die deutsche Frau eines Botschafters kennen, sie wurde seine Geliebte. Durch das Terrorregime aber kam der Tourismus auf Haiti fast vollständig zum erliegen, niemand wollte sein Hotel kaufen, weil die Touristen schlagartig weggeblieben sind.
Auf der sechstägigen Überfahrt von New York lernte Brown den britischen Major Jones kennen, der mit seinen Kriegs-Abenteuern prahlt, ein äußerst charismatischer, jovialer Mann, den er aber nicht recht durchschauen kann, mit dem er dann auch nach der Ankunft regen Umgang pflegt. Und er trifft auf das etwas seltsame, aber grundanständige Ehepaar Smith aus den USA, wo der Ehemann 1948 Präsidentschafts-Kandidat war für die winzige Partei der Vegetarier. Mr. Smith will ‹Papa Doc›, den haitischen Präsidenten, für den Bau eines Vegetarier-Zentrums in Porte aux Prince gewinnen. Ein, wie sich herausstellt, sinnloses Unterfangen angesichts der wild wuchernden Korruption in diesem maroden Staat. Dass Paar reist ernüchtert ab! Im dritten Teil des Romans gerät Major Jones ins Visier der Tonton Macoute, wird verhaftet, kommt wieder frei, bekommt dann durch den Ich-Erzähler Brown Asyl in der Botschaft von Marthas Ehemann. Ein Eigentor für Brown, denn jetzt ist Jones ständig mit Martha, seiner Geliebten, zusammen, Brown wird eifersüchtig. Jones flüchtet bei Nacht und Nebel aus der Botschaft und schließt sich einer Rebellentruppe an, die den Diktator vom benachbarten Santo Domingo aus stürzen will.
Alles Schall und Rauch, wie sich am Ende herausstellt, die Figuren des Romans sind allesamt Traumtänzer, fast alles ist gelogen. Jones war nie im Krieg, und Browns wilde Pläne enden damit, dass er einen Job als Beerdigungs-Unternehmer antritt. Als Thriller mag dieser in einer klaren, zielgerichteten Sprache erzählte Roman seine Leser gut unterhalten, die politische Absicht, die Verdammung von staatlichem Terror, bleibt dagegen seltsam kraftlos schon im Ansatz stecken. Gauner und Spione interessieren wohl nicht nur im Kino, sondern auch in der Literatur ein breites Publikum. Um nobelpreisfähig zu sein mangelt es hier narrativ aber so ziemlich an allem, sogar an Spannung!
Fazit: mäßig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
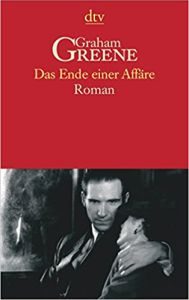 Der dritte Mann
Der dritte Mann Roman vs. Spielfilm
Roman vs. Spielfilm