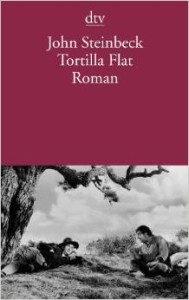 Geschichte einer Naturgottheit
Geschichte einer Naturgottheit
Die Ritter der Tafelrunde haben Pate gestanden für diesen Schelmenroman des amerikanischen Nobelpreisträgers John Steinbeck, wie uns das Vorwort erläutert, eine Thematik, die dem Autor jedenfalls sehr vertraut war, hat er doch, viel später allerdings, sogar eine moderne Übersetzung der Sage um König Artus geschrieben. Auch in «Tortilla Flat» geht es um solch eine mystisch erhobene, zentrale Figur, die hier jedoch aus einem ganz anderen Milieu stammt, welches man nach heutigem Sprachgebrauch als Prekariat bezeichnen würde. Danny, der Held des Romans, ist ein bettelarmer, kleinkrimineller Lebenskünstler. Um ihn scharrt sich, wie in der Artussage, eine wachsende Gruppe von Gleichgesinnten, allesamt Landstreicher und Tagediebe wie er. Sie sind Brüder im Geiste sozusagen, in den Tag hinein lebende Nichtstuer, die Leichtigkeit des Seins genießend mit ihrer naiven Zuversicht.
Ort der Handlung ist die namensgebende Siedlung oberhalb von Monterey in Kalifornien, in der nach dem Ersten Weltkrieg unter armseligsten Bedingungen die Paisanos leben, eine ethnisch gemischte Gruppe alteingesessener Bewohner dieser kleinen Küstenstadt, und Tortilla Flat ist ein Slum an deren Rande, ohne feste Straßen, Wasser und Strom. Als Dannys Großvater stirbt, wird aus dem obdachlosen Habenichts über Nacht der Eigentümer zweier baufälliger Holzhütten. Zögernd nur entschließt er sich, eine dieser alten Hütten zu beziehen, und mit dem neuen Besitz ändert sich nun schlagartig sein Leben. Er erlebt das jedoch eher als Last denn als Bereicherung. Schließlich vermietet er eine der Hütten an seinen besten Freund, obwohl klar ist, dass er nie auch nur einen Cent Miete erhalten wird. Und nach und nach kommen immer neue, skurrile Mitbewohner hinzu.
In einem lose verbundenen Zyklus von siebzehn Geschichten erlebt der Leser den alltäglichen Kampf dieser bunten Clique ums Essen und Trinken. Bei Letzterem handelt es sich fast ausschließlich um Wein, der, aller Prohibition zum Trotz, in Mengeneinheiten von Gallonen konsumiert wird von der trinkfesten Bruderschaft. Nur im äußersten Notfall verdingt sich mal einer von ihnen als Tagelöhner, ansonsten lebt man vom listenreichen Schnorren oder kleineren Diebstählen. Am liebsten sitzt man müßig in der Sonne und erzählt sich die neuesten Geschichten, den Tratsch und Klatsch der kleinen, pazifischen Küstenstadt. Und auch für die sexuellen Bedürfnisse ist gesorgt, es findet sich immer eine Frau, ob verheiratet oder nicht, wobei manche Schwangere später nicht mehr zu sagen vermag, wer von dieser Clique denn als Vater in Frage käme. Steinbeck wäre kein Nordamerikaner, wenn er diesen Aspekt menschlicher Existenz nicht derart verklausuliert erzählen würde, dass man entsprechende Textpassagen wortwörtlich in jedem Märchenbuch abdrucken könnte.
Mit der Burleske um die «Naturgottheit» Danny will Steinbeck, wie es in seinem Vorwort heißt, «jetzt und für immer das spöttische Lächeln von den Lippen säuerlicher Gelehrter verbannen». Man darf den Roman nicht kurzerhand als Hymne auf das einfache Leben interpretieren, er ist eher als Gegenentwurf zum Tanz ums Goldene Kalb zu sehen, als Abgesang auf eine Gesellschaft von Konsumidioten mit ausschließlicher Fixierung auf alles Materielle, in Geldeinheiten Messbare, wo jedweder Müßiggang und eine fatalistische Genügsamkeit von vornherein suspekt sind. Wunderbar plastisch sind Steinbecks Figuren dieser gesellschaftlichen Randgruppe beschrieben, und er lässt sie äußerst schlitzohrig agieren, obwohl sie immer auch ein wenig trottelig wirken, auf ihre spezielle Art aber grundehrlich sind. Das ist oft ziemlich verblüffend, vielleicht jedoch gerade dadurch aber sehr amüsant zu lesen, man kommt aus dem Schmunzeln nicht mehr heraus. Und Dannys Tod schließlich und seine Beerdigung wird liebevoll ironisch zu einem grandiosen Ereignis verklärt, das einen Platz in der Weltgeschichte verdiene, zumindest aber in der von Monterey.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Kunst plus Haltung
Kunst plus Haltung Roman vs. Spielfilm
Roman vs. Spielfilm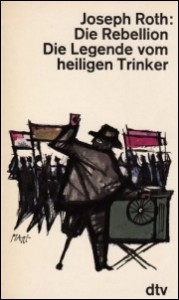 Wahrheit und Gerechtigkeit
Wahrheit und Gerechtigkeit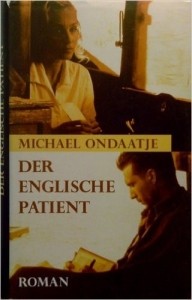 Mit Herodot in der Wüste
Mit Herodot in der Wüste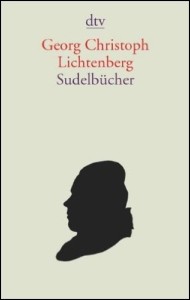 Gar nicht hohl
Gar nicht hohl Sehr eigenständiger Duktus
Sehr eigenständiger Duktus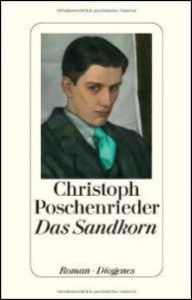
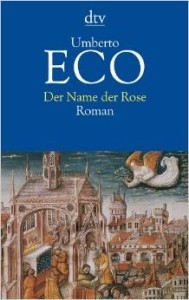 Viel Mönchslatein
Viel Mönchslatein Club der toten Dichter
Club der toten Dichter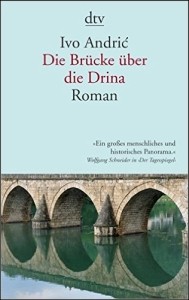 Im Kanon der Weltliteratur
Im Kanon der Weltliteratur Nichts für faule Leser
Nichts für faule Leser Gestern wird sein, was morgen gewesen ist.
Gestern wird sein, was morgen gewesen ist.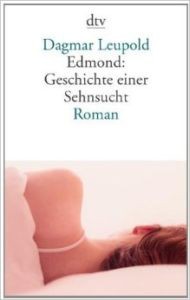 Eine Nabelschau
Eine Nabelschau Ein hintergründiges Triptychon
Ein hintergründiges Triptychon