 Bukowskis Jugendjahre. „Für alle Väter“ lautet die Widmung, die Charles Bukowski, der im August dieses Jahres 100 Jahre alt werden würde, seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen voranstellt. Denn Bukowski ist nicht nur der Autor zahlreicher Gedichte und Short Stories, sondern auch von einigen Romanen.
Bukowskis Jugendjahre. „Für alle Väter“ lautet die Widmung, die Charles Bukowski, der im August dieses Jahres 100 Jahre alt werden würde, seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen voranstellt. Denn Bukowski ist nicht nur der Autor zahlreicher Gedichte und Short Stories, sondern auch von einigen Romanen.
Bukowski: Class of `39
„Post Office“, sein Romandebüt widmete sich seiner einzigen festen Anstellung bei der amerikanischen Post. In „Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend“ geht Charles Bukowskis aber noch weiter in seinen Erinnerungen zurück, nämlich bis in seine Jugend im Amerika der 20er und 30er Jahre. Sein Vater, der jeden Morgen pünktlich das Haus verlässt, damit die Nachbarn nicht merken, daß er arbeitslos ist, war von der oben angeführten Zueignung und Widmung wohl ausgeschlossen. „Die rohe Gewalt, die in ihm rumorte, verscheuchte alles andere.“ Denn er züchtigte seinen Sohn Charles mit dem Lederriemen und verursachte damit wohl genau jene Entzündungen, die später als eitrige Akne ausbrachen und Bukowski damit sein Leben (oder zumindest seinen Körper) versauten. Aber so schlecht war dieses Leben nicht mehr, zumindest ab dem Zeitpunkt als er sein Elternhaus verließ. Genau über die Zeit davor handelt der vorliegende autobiographische Roman.
„Fump, fump, fump,fump …“
Bukowski nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er spricht über Tabus, damit auch andere sich trauen, darüber zu reden. Seine Worte machen Mut und lösen eigene Erinnerungen aus, die vielleicht ebensolche Traumata auslösten. In der Schule war er noch ein Sportass, aber bald verlässt ihn der Ehrgeiz, da er schon früh anfängt zu trinken. „Das hier machte das Leben zu einer reinen Freude. Es machte einen Mann unerschütterlich und unangreifbar“, schreibt er über seinen ersten Rausch, bei dem er sich an Weinfässern des Vaters eines Mitschülers bediente. „So wohl war mir noch nie gewesen. Es war besser als Onanieren.“ Bukowski war noch keine 14. Bei der Beschreibung einer Tätigkeit eines anderen Mitschülers während des Unterrichts, bedient sich Bukowski auch der Lautsprache: „Fump, fump, fump,fump …“ lautet sein Kommentar zu den Beinen von Mrs. Gredis. Eine Parallelmontage der ganz anderen Art. Aber Bukowski zeigt auch viel Gefühl, etwa wenn er seine Beziehung zu der Krankenschwester beschreibt, die ihm seine Pusteln ausbrannte, Miss Ackermann. Aus seinem ersten McJob wird er wegen einer Schlägerei rausgeschmissen, aber mit der Pünktlichkeit hatte er es damals schon nicht so genau genommen. Seine ersten Tage als Student werden ebenso angeschnitten, wie seine Entscheidung nicht in den Krieg zu ziehen. Die Class of `39 war nämlich trotz Pearl Harbor schon pazifistisch gesinnt, obwohl `68 noch weit entfernt war.
Charles Bukowski wusste wohl damals schon, dass er sich ein Leben lang als Außenseiter durchschlagen muss. Nach weiteren McJobs als Tankwart, Schlachthof- und Hafenarbeiter (und natürlich als Postmann) starb Bukowski am 9. März 1994 in San Pedro/LA.
Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend
Roman
dtv Allgemeine Belletristik
Aus dem amerikanischen Englisch von Carl Weissner
2007, 352 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-423-20963-2
10,95 EURO


 Klösterliche Identitätssuche
Klösterliche Identitätssuche Augenzwinkern inklusive
Augenzwinkern inklusive

 Wo er recht hat, hat er recht
Wo er recht hat, hat er recht Schlafrock-Existenz als Allegorie
Schlafrock-Existenz als Allegorie Unselige Allianz von Schicksal und Zufall
Unselige Allianz von Schicksal und Zufall Grieche trifft Schwedin
Grieche trifft Schwedin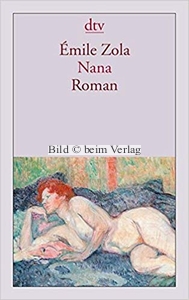 Lichtenberg bringts auf den Punkt
Lichtenberg bringts auf den Punkt Debüt eines literarischen Olympiers
Debüt eines literarischen Olympiers Der Poet als gottgleicher Schöpfer
Der Poet als gottgleicher Schöpfer Mehr Selbstkritik geht ja nicht
Mehr Selbstkritik geht ja nicht Tragischer Pantoffelheld
Tragischer Pantoffelheld «Leser mir nach!»
«Leser mir nach!»