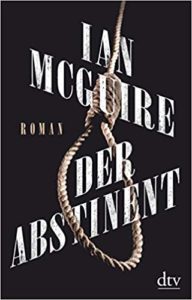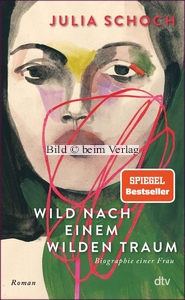
Der jüngst erschienene Roman «Wild nach einem wilden Traum» von Julia Schoch ist der letzte einer unter dem Titel «Biografie einer Frau» erschienenen, unabhängig voneinander zu lesenden Buchreihe. Auf dem Umschlag des Buches hat sie dazu erklärt: «Was ich in der Trilogie erzähle? Dass wir unterschiedliche Rollen im Leben haben und oft nicht wissen, was wir für andere sind. In den drei Büchern möchte ich Gerechtigkeit walten lassen. Ein Wunschtraum, vielleicht. Aber ein schöner.» Herausgekommen ist dabei zum Abschluss nun dieser autofiktionale Roman, in dem von einer Schriftstellerin aus Mecklenburg-Vorpommern erzählt wird, die an einem Kipppunkt ihres Lebens steht. Die namenlos bleibende Protagonistin des Romans erzählt in zwei Handlungs-Strängen von der Liebesaffäre mit einem Mann und von der für ihr Leben folgenreichen Begegnung als Mädchen mit einem jungen Soldaten.
Anlässlich eines Stipendiums in den USA lernt sie als angehende Schriftstellerin einen spanischen Kollegen kennen, der nicht müde wird zu betonen, er sei Katalane. Was sie als in der DDR aufgewachsenes Kind sehr erstaunt, war doch die Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten für sie ein endlich wahr gewordener, lang ersehnter Traum. Der ebenfalls namenlos bleibende Katalane hingegen träumt von der staatlichen Abtrennung seiner Region von Spanien. Sie ist fasziniert von diesem charismatischen Mann, der als Schriftsteller bereits sehr erfolgreich ist, und sucht bei den abendlichen Gesprächen der Stipendiaten seine Nähe. Denn er ist auch ein begnadeter mündlicher Erzähler, dem alle gern zuhören. Als er ihr wenige Tage später nach einem Abendessen per Handzeichen signalisiert, er erwarte sie in fünf Minuten in seinem Zimmer, folgt sie ihm ohne Zögern. Sofort, ohne jedes verliebte Vorgeplänkel, haben sie einfach nur rauschhaften Sex miteinander. Unmittelbar danach reden sie dann wieder über Literatur und das Schreiben, für das sie ja alle hierher gekommen sind, in die ablenkungsfreie Ruhe einer ländlichen Ödnis nahe New York.
Die Begegnung der damals zwölfjährigen Protagonistin mit dem jungen NVA-Soldaten aus der benachbarten Garnison am Stettiner Haff, in der auch ihr Vater als Offizier stationiert ist, markiert einen zweiten Kipppunkt ihres Lebens. Sie trifft ihn zufällig bei einem Spaziergang im Wald, wo er Pilze sucht, unterhält sich angeregt mit ihm, und bald treffen sie sich dann regelmäßig an gleicher Stelle. Er ist sehr an Literatur interessiert und bestärkt sie wirkungsvoll in ihrem «wilden Traum», eine Schriftstellerin zu werden. Beide Themen, die Liebe und die Schriftstellerei, werden in diesem Roman abwechselnd und in parallelen Handlungssträngen mit allerlei philosophischen Gedankengängen verknüpft. Erzählerisch auffallend distanziert, quasi nebenbei, erfährt der Leser dass die Protagonistin verheiratet ist, zwei Kinder hat, früher gerne mit ihrem Mann gereist ist und ihn jetzt nur noch manchmal zum Essen in einem Restaurant trifft. Mehr erfährt man nicht dazu!
Julia Schoch nähert sich ihrer Thematik völlig emotionslos. Der Katalane im Roman ist Liebhaber der Ich-Erzählerin für wenige Wochen, von einer verzehrenden Liebe ist hier nicht die Rede. Ihre Affäre mit ihm war letztendlich nur der Anstoß für die Protagonistin, ihr bisher eher langweiliges, angepasstes Leben neu zu ordnen. Es geht um das Verstehen in diesem Roman eines Frauenlebens, um die Wechselwirkungen des Lebens und des Schreibens, letztendlich um die Frage, was wahr ist. Schafft das Schreiben eine neue Wahrheit? Verändert das Schreiben die Wahrheit? Ist Liebe Wahrheit oder Illusion? Ist Liebe überhaupt ein eindeutiger Begriff? Wie verändert Zeit die Liebe? Kann Literatur Wirklichkeit schaffen? In stilistischer Form des Bewusstseinstroms geht ein wahrer Regen an Fragen auf den Leser nieder, die ihn förmlich zu kontemplativer Mitwirkung anregen, vielleicht sogar dazu zwingen. Wenn Literatur das schafft, hat sie wahrhaftig ihren Zweck erfüllt!
Fazit: erstklassig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
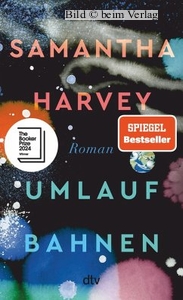 Raumfahrt für Träumer
Raumfahrt für Träumer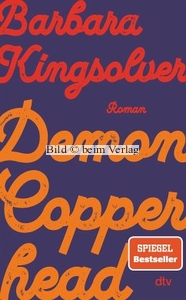 Epos von der Chancenlosigkeit
Epos von der Chancenlosigkeit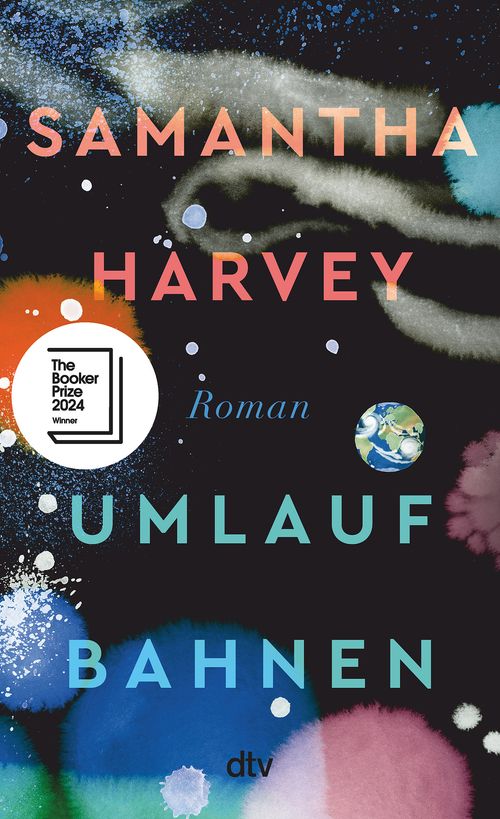
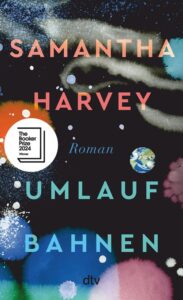 Umlaufbahnen. Orbital. Ausgezeichnet mit dem Booker Prize 2024 und Hawthornden Prize for Literature 2024, nominiert für den Orwell Prize for Political Fiction 2024 sowie den Ursula K. Le Guin Prize 2024: Orbital von Samantha Harvey, ihr fünftes Werk.
Umlaufbahnen. Orbital. Ausgezeichnet mit dem Booker Prize 2024 und Hawthornden Prize for Literature 2024, nominiert für den Orwell Prize for Political Fiction 2024 sowie den Ursula K. Le Guin Prize 2024: Orbital von Samantha Harvey, ihr fünftes Werk.
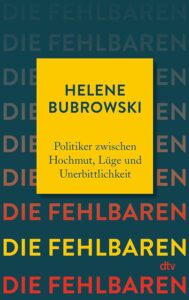 Helene Bubrowski ist mir als häufiger Gast bei Lanz bekannt, wo sie noch nie etwas Dummes gesagt hat, aber an richtigen Stellen lächelt. Das Buch lag in der Stadtbücherei bei Neuheiten, Rezensionen kannte ich nicht, nach der Lektüre eigentlich unverständlich, denn es ist sehr lesenswert.
Helene Bubrowski ist mir als häufiger Gast bei Lanz bekannt, wo sie noch nie etwas Dummes gesagt hat, aber an richtigen Stellen lächelt. Das Buch lag in der Stadtbücherei bei Neuheiten, Rezensionen kannte ich nicht, nach der Lektüre eigentlich unverständlich, denn es ist sehr lesenswert.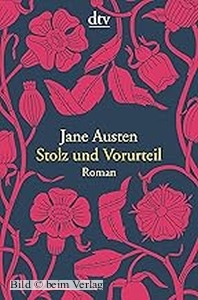
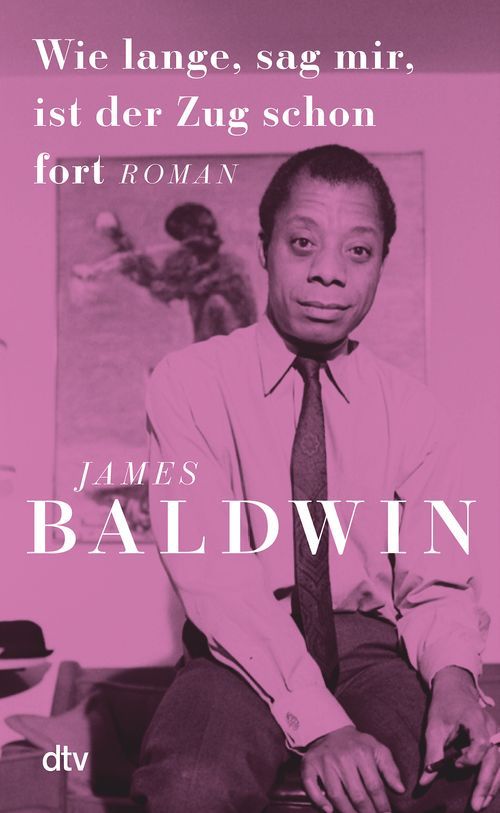
 Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort. “Sie erinnerte mich an alles, was ich nie zu vergessen hoffte.” Zum 100. Geburtstag von James Baldwin erscheint bei dtv eine Neuauflage seiner Werke. Sein vierter Roman, der hier in gebundener Ausgabe vorliegt, erschien 1968, ein Jahr, das auch große politisch Bedeutung erhielt. Der Protagonist, Leo Proudhammer, wächst in den Straßen Harlems auf und schafft es als Schauspieler auf die Bühnen der Welt.
Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort. “Sie erinnerte mich an alles, was ich nie zu vergessen hoffte.” Zum 100. Geburtstag von James Baldwin erscheint bei dtv eine Neuauflage seiner Werke. Sein vierter Roman, der hier in gebundener Ausgabe vorliegt, erschien 1968, ein Jahr, das auch große politisch Bedeutung erhielt. Der Protagonist, Leo Proudhammer, wächst in den Straßen Harlems auf und schafft es als Schauspieler auf die Bühnen der Welt.
 Löwenherz. Die Trilogie Bagage-Vati-Löwenherz beschäftigt sich mit ihrer Familie. Der dritte Band ist ganz ihrem Bruder Richard gewidmet, der durch den frühen Tod seiner Mutter mehr aus dem Gleichgewicht rät als seine drei Schwestern. Oder gibt es noch einen anderen Grund?
Löwenherz. Die Trilogie Bagage-Vati-Löwenherz beschäftigt sich mit ihrer Familie. Der dritte Band ist ganz ihrem Bruder Richard gewidmet, der durch den frühen Tod seiner Mutter mehr aus dem Gleichgewicht rät als seine drei Schwestern. Oder gibt es noch einen anderen Grund?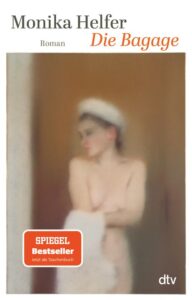 Hund, Schamasch, von einem Jäger erschossen und Kitti stürmt mit zwei Henkern seine Wohnung, um ihm Putzi wieder wegzunehmen. Zu dieser Zeit hat Richard zwar eine Freundin, Tanja, die ihn noch fünf Jahre auffangen kann, aber dann geschieht doch das Unvermeidliche. Nach seiner Mutter, Schamasch nun der dritte Verlust. Das kann einen Menschen für immer knicken. Richard entscheidet das “für immer”. Niemand sonst hat schuld.
Hund, Schamasch, von einem Jäger erschossen und Kitti stürmt mit zwei Henkern seine Wohnung, um ihm Putzi wieder wegzunehmen. Zu dieser Zeit hat Richard zwar eine Freundin, Tanja, die ihn noch fünf Jahre auffangen kann, aber dann geschieht doch das Unvermeidliche. Nach seiner Mutter, Schamasch nun der dritte Verlust. Das kann einen Menschen für immer knicken. Richard entscheidet das “für immer”. Niemand sonst hat schuld.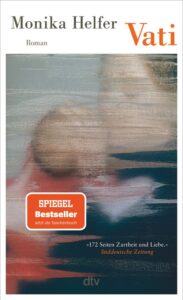 Versäumnissen, den Vorwürfen? Am schlimmsten wiegt eine ihrer Erinnerungen, als ihr einfällt, dass Richard ihrer Schwester und ihr einmal als Baby vom Wickeltisch gerollt war. Das Geräusch klang noch nach als Richard längst erwachsen war. Aber die Folgen des Sturzes könnten seine autistische Art erklären, denn Richard kann sich nicht mitteilen oder erfindet einfach Geschichten. Ein “Schmähtandler”, Gschichtldrucker. Münchhausen, Luftikus. “Was herrscht für ein Zustand, wenn einer den letzten Knopf zuhat, aber trotzdem keine Krawatte?” frägt sie sich. Vielleicht bringt es dieser Satz auf den Punkt, was Richard ausmachte. Liebe und Angst gehören zusammen, heißt es an einer Stelle, “die eine befördert die andere, die andere verdirbt die eine”. Die Liebe zu Putzi hielt ihn aufrecht, den Richard, aber die Enteignung dieser Lieber war wohl zu viel für sein schwaches Herz. Monika Helfer beschreibt das Leben ihres Bruders, als wäre man selbst dabei gewesen. “Löwenherz” ist ein Buch, das einen in den Sessel drückt und weiterlesen lässt, bis es leider zu Ende ist. Vielleicht ist Bücher schreiben nicht die einzige Möglichkeit ein Trauma aufzuarbeiten, aber wohl die nachhaltigste. Denn so hilft es auch anderen.
Versäumnissen, den Vorwürfen? Am schlimmsten wiegt eine ihrer Erinnerungen, als ihr einfällt, dass Richard ihrer Schwester und ihr einmal als Baby vom Wickeltisch gerollt war. Das Geräusch klang noch nach als Richard längst erwachsen war. Aber die Folgen des Sturzes könnten seine autistische Art erklären, denn Richard kann sich nicht mitteilen oder erfindet einfach Geschichten. Ein “Schmähtandler”, Gschichtldrucker. Münchhausen, Luftikus. “Was herrscht für ein Zustand, wenn einer den letzten Knopf zuhat, aber trotzdem keine Krawatte?” frägt sie sich. Vielleicht bringt es dieser Satz auf den Punkt, was Richard ausmachte. Liebe und Angst gehören zusammen, heißt es an einer Stelle, “die eine befördert die andere, die andere verdirbt die eine”. Die Liebe zu Putzi hielt ihn aufrecht, den Richard, aber die Enteignung dieser Lieber war wohl zu viel für sein schwaches Herz. Monika Helfer beschreibt das Leben ihres Bruders, als wäre man selbst dabei gewesen. “Löwenherz” ist ein Buch, das einen in den Sessel drückt und weiterlesen lässt, bis es leider zu Ende ist. Vielleicht ist Bücher schreiben nicht die einzige Möglichkeit ein Trauma aufzuarbeiten, aber wohl die nachhaltigste. Denn so hilft es auch anderen.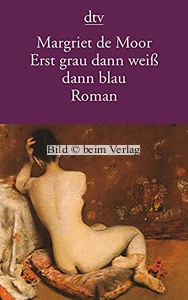 Was nicht erzählt wird, gibt es nicht
Was nicht erzählt wird, gibt es nicht Der Tod als Programmfehler
Der Tod als Programmfehler Hoffen und Scheitern
Hoffen und Scheitern Der Flug ist das Leben wert
Der Flug ist das Leben wert Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.
Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.