 Ein Narrativ als Selbstgespräch
Ein Narrativ als Selbstgespräch
Nach zehn Jahren hat Judith Zander mit «Johnny Ohneland» kürzlich ihren zweiten Roman veröffentlicht, ein Werk, das in vielerlei Hinsicht überrascht. Da ist zunächst der Vorname im Titel, der sich als angenommener Name eines Mädchens mit dem schönen Namen Joana erweist, der Nachname Ohneland spielt auf den unglücklichen Bruder von Richard Löwenherz an. Das Mädel hat schon früh ihre Weiblichkeit durch diesen Vornamen zu verdrängen versucht, für alle ist sie nur noch Johnny, es geht folglich um die Gender-Problematik als zentralem Thema. Ungewöhnlich ist neben dem, ‹was› erzählt wird, aber auch, ‹wie› erzählt wird, denn die Geschichte ist bis auf wenige Seiten am Schluss komplett in Du-Form erzählt. Johnny spricht also im Präteritum zu sich selbst, in einem endlosen inneren Monolog. An diesen zunächst irritierenden Erzählstil gewöhnt man sich allmählich als Leser, was aber nicht darüber hinweghilft, dass die auf diese Art entstehenden, komplizierten und zuweilen stilblütenverdächtigen Satzgebilde den Lesefluss oft erheblich stören. Weiter im Du-Ton:
Von früh an, schon im Kindergarten, führst du ein Außenseiter-Dasein. Du bist extrem introvertiert, zudem äußerst kontaktscheu und folglich immer allein, sieht man mal von deinem zwei Jahre jüngeren Bruder Charlie ab, mit dem du dich meistens gut verstehst. Ihr werdet oft für Zwillinge gehalten, so sehr gleicht ihr euch äußerlich, besonders seit du deine Haare jungenhaft kurz geschnitten hast und dir nur noch knabenhafte Klamotten anziehst. In diesem typischen Entwicklungsroman bist du ein unangepasstes Mädchen auf der Suche nach deinem wahren Ich, deine Lieblingsbeschäftigung ist Nachdenken, hast du erkannt. Du kommst aus einer namenlosen Kleinstadt in MeckPom, dein Vater ist Bäcker, deine Mutter arbeitet in einem Blumenladen, eine bildungsferne Herkunft mithin. Orte der Handlung sind neben der pommerschen Provinz auch Finnland, wo du in Helsinki studiert hast, außerdem Australien, dort hast du nach dem Studium deinen ersten Arbeitsplatz am Goethe-Institut von Sydney gefunden. Vom Kindergarten angefangen über Grundschule, Gymnasium und Studium ist dein Leben von den Schwierigkeiten deiner Selbstfindung bestimmt gewesen, geradezu analytisch schilderst du als Protagonistin dein Seelenleben in allen Details. Eine Zäsur stellte dabei das plötzliche Verschwinden deiner Mutter dar, die der Familie in einen Zettel auf dem Küchentisch lapidar mitgeteilt hat, dass sie ein neues Leben ohne euch begonnen habe, sie würde nie mehr zurückkommen, und ihr sollt nicht nachforschen.
Nach deiner Entjungferung, durch ein maskulines Wesen immerhin, wirst du geradezu magisch zum eigenen Geschlecht hingezogen, mehr als Herumknutschen findet dabei aber nie statt. Zwischendurch hast du dann sogar noch den einen oder anderen Lover, als One-Night-Stand, nie für länger. Bis du am Ende deines Australien-Aufenthalts schließlich doch noch mit einer Frau intim wirst, – was dich dann aber auch nicht recht überzeugen kann. Jedenfalls, wird dir da endlich klar, bist du ja tatsächlich bisexuell, du sitzt quasi zwischen den Stühlen!
Diese Geschichte, die eher einer Meditation gleicht, ist mit Intertextualität üppig angereichert, im Anhang sind fast hundert Quellen benannt. Außerdem finden sich unzählige Redensarten, Sprüche, Zitate und Songtexte, viele auf Englisch. In klugen Selbstreflexionen werden metaphernreich Johnnys Seelenleben, ihre genderspezifischen Probleme und manch anderes Ungemach in der Welt beleuchtet. Beste, aber leider einzige amüsante Episode ist ein Discobesuch, bei dem der DJ gnadenlos die Tanzfläche leer fegt, indem er plötzlich, zur Ankurbelung des Getränkekonsums, nur noch öde Schnulzen auflegt. Zweifellos ist die Sprache das erfreulichste Merkmal dieses Narrativs, ein wortmächtiger, sehr spezifischer Stil. Dabei wird allerdings selbstverliebt oft weit über das Ziel hinausgeschossen, was den Text gewaltig aufbläht, weniger wäre hier mehr gewesen!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Genre: RomanIllustrated by dtv München
 Abdel-Samad ist in Ägypten geboren, lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Mich interessieren immer die Meinungen derer, die nicht hier geboren sind, aber unser Land gut kennen. Aus der anderen Perspektive sieht man vieles besser, das indigene Deutsche gar nicht wahrnehmen, weil es für sie selbstverständlich ist.
Abdel-Samad ist in Ägypten geboren, lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Mich interessieren immer die Meinungen derer, die nicht hier geboren sind, aber unser Land gut kennen. Aus der anderen Perspektive sieht man vieles besser, das indigene Deutsche gar nicht wahrnehmen, weil es für sie selbstverständlich ist. Einfach genial
Einfach genial
 Symbiose von Moral und Wortwitz
Symbiose von Moral und Wortwitz Pageturner par excellence
Pageturner par excellence Ein Narrativ als Selbstgespräch
Ein Narrativ als Selbstgespräch Ein Glücksfall der Gegenwartsliteratur
Ein Glücksfall der Gegenwartsliteratur


 Rhetorische Floskel
Rhetorische Floskel
 Bukowskis Jugendjahre. „Für alle Väter“ lautet die Widmung, die Charles Bukowski, der im August dieses Jahres 100 Jahre alt werden würde, seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen voranstellt. Denn Bukowski ist nicht nur der Autor zahlreicher Gedichte und Short Stories, sondern auch von einigen Romanen.
Bukowskis Jugendjahre. „Für alle Väter“ lautet die Widmung, die Charles Bukowski, der im August dieses Jahres 100 Jahre alt werden würde, seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen voranstellt. Denn Bukowski ist nicht nur der Autor zahlreicher Gedichte und Short Stories, sondern auch von einigen Romanen.
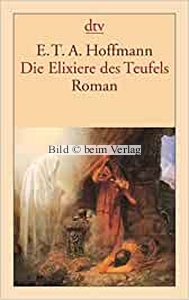 Klösterliche Identitätssuche
Klösterliche Identitätssuche Augenzwinkern inklusive
Augenzwinkern inklusive

 Wo er recht hat, hat er recht
Wo er recht hat, hat er recht