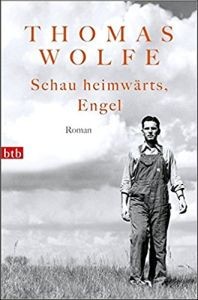 Vom «feinsten Scheitern»
Vom «feinsten Scheitern»
Den 1929 erschienenen Debütroman «Schau heimwärts, Engel» des amerikanischen Schriftstellers Thomas Wolfe nannte Hermann Hesse damals «Die stärkste Dichtung aus dem heutigen Amerika», und auch die Nobelpreisträger Faulkner und Lewis schätzten ihren Kollegen literarisch sehr hoch ein. Ein Riesenerfolg also gleich auf Anhieb, an den spätere Werke des früh verstorbenen Autors nicht mehr anknüpfen konnten. Seit 2009 liegt dieser inzwischen zum Klassiker avancierte Roman nun in einer überzeugend gelungenen Neuübersetzung vor.
Wir haben es mit einem typischen Entwicklungsroman zu tun, dessen Held Eugene eingebettet ist in eine kinderreiche Familie mit markanten, lebenshungrigen Charakteren, deren wechselvolles, unangepasstes Leben letztendlich das fatale Scheitern des American Dream widerspiegelt. Die autobiografischen Bezüge in diesem Erstling sind überdeutlich, so zum Beispiel der unschwer als Thomas Wolfes Geburtsstadt Ashville in North Carolina erkennbare Handlungsort, – was ihm denn auch prompt einigen Ärger einbrachte bei seinen Mitbürgern, die sich im Roman wieder erkannten und verunglimpft fühlten. Aber auch viele Gemeinsamkeiten in der Familie und insbesondere im Werdegang seines Helden sind unübersehbar, er fühlt sich ebenfalls zum Schriftsteller berufen, und auch sein Vater ist Steinmetz. So ist also der «mit einem Lächeln milder Statueneinfalt» aus Granit gemeißelte Engel im Roman nicht nur titelgebend, sondern wird schon auf der zweiten Seite auch leitmotivisch eingesetzt, er begleitet den Leser fortan ganz ohne religiöse Konnotation als sinnfällige Metapher für ein wohlbehütetes Leben.
Es ist das Auf und Ab im Daseinskampf, die Widersprüchlichkeit des Lebens, die den heranwachsenden, hochbegabten Eugene zunehmend verzweifeln lässt. Seinem stadtbekannten Vater als versoffenem, schwadronierendem Künstlertyp mit großer Attitüde steht die äußerst energische, geschäftstüchtige, aber geradezu krankhaft geizige Mutter gegenüber. Er und seine Geschwister stehen zwischen diesen Fronten eines nimmer endenden Ehekriegs ihrer völlig entzweiten Eltern, deren konträre Visionen ebenso kläglich scheitern wie die ihrer höchst verunsicherten Kinder. Ihnen allen ist kein Glück beschieden, und Eugene erlebt gleich bei seiner ersten Liebe einen schnöden Verrat, der den Gutgläubigen völlig aus der Bahn wirft. Sein Glück, soviel ahnt er dann als unschlüssig dahin Treibender nach dem Ende seines Studiums, liegt in ihm selbst, nicht in der großen weiten Welt, in die es ihn hinauszieht, in die er sich geradezu flüchten will auf der Suche nach Lebenssinn und Erfüllung.
Vom «feinsten Scheitern», wie Faulkner es umschrieb, handelt dieser stilistisch hochklassige Roman, der mit einigem Pathos erzählt wird. Er überzeugt mit einer geradezu genialen Beschreibungskunst, mit lebensecht gezeichneten Figuren und stimmigen Dialogen, mit einer sinnreich ausgeklügelter Metaphorik vor allem, die ihresgleichen sucht. Die Stofffülle ist selbst nach den radikalen Kürzungen des Manuskriptes noch sehr üppig geblieben, der gleichwohl ziemlich handlungsarme Roman erfordert zudem mit seiner geradezu ausufernden Intertextualität und den vielen historischen, politischen und kulturellen Anspielungen, – die hilfreichen Anmerkungen hierzu umfassen allein 45 Buchseiten mit 614 Verweisen -, so einiges an Durchhaltevermögen beim Leser. Der episodische Roman schildert in seiner stärksten Szene sehr ergreifend einen qualvollen Todeskampf und endet mit einer ebenso faszinierenden Geisterszene, in der Eugene auf seinen verstorbenen Bruder Ben trifft, der ihm als Todesengel die Tür zur scheinbar entschwundenen Welt weist, die in ihm selber läge. Der «Homer des modernen Amerika», wie Kritiker ihn überschwänglich nannten, folgte seiner Theorie «Wir sind die Summe aller Augenblicke unseres Lebens». Entsprechend weit verzweigt und üppig ist das Geflecht unzähliger Impressionen in diesem an den «Ulysses» angelehnten, grandiosen Klassiker.
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
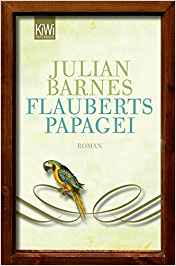 Ein Vexierspiel
Ein Vexierspiel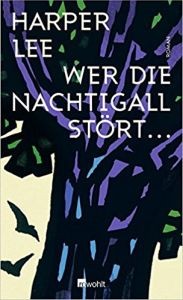 Neues von der Spottdrossel
Neues von der Spottdrossel Albtraum für Bibliophile
Albtraum für Bibliophile Big Apple als Protagonist
Big Apple als Protagonist
 Trailer ab. Es treten auf :
Trailer ab. Es treten auf :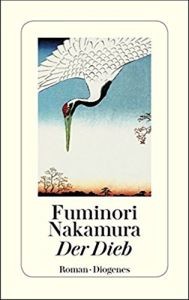 Nishimura ist ein erfahrener Taschendieb. Ein Maßanzug verleiht ihm Anonymität, elegant und unauffällig bewegt er sich durch Tokios Menschenmassen und stiehlt Fremden ihre Geldbörsen. Sein Gewerbe hat er zur Kunst erhoben, fließend und kaum merkbar sind seine Bewegungen. Der Diebstahl geschieht reibungslos und unbemerkt, manchmal so unbemerkt, dass nicht einmal er selbst sich an alle Diebstähle erinnern kann.
Nishimura ist ein erfahrener Taschendieb. Ein Maßanzug verleiht ihm Anonymität, elegant und unauffällig bewegt er sich durch Tokios Menschenmassen und stiehlt Fremden ihre Geldbörsen. Sein Gewerbe hat er zur Kunst erhoben, fließend und kaum merkbar sind seine Bewegungen. Der Diebstahl geschieht reibungslos und unbemerkt, manchmal so unbemerkt, dass nicht einmal er selbst sich an alle Diebstähle erinnern kann.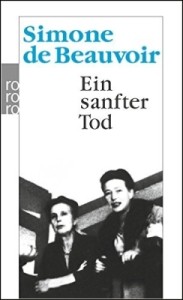 Meistverdrängtes Menschheitstrauma
Meistverdrängtes Menschheitstrauma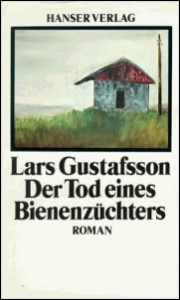 Kein Jahrhundertroman
Kein Jahrhundertroman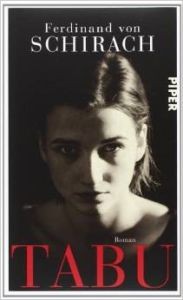 Nomen est omen
Nomen est omen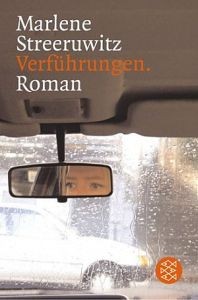 Für die Fragen- und Denkbereiten
Für die Fragen- und Denkbereiten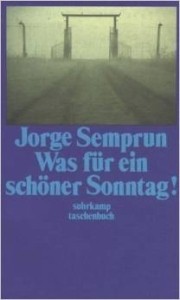 Was für ein schöner Kommunismus!
Was für ein schöner Kommunismus!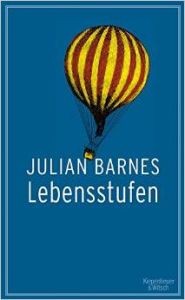 Ein literarisches Taj Mahal
Ein literarisches Taj Mahal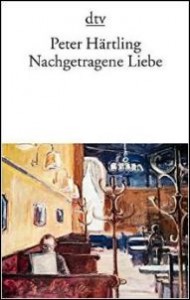 Von der Seele geschrieben
Von der Seele geschrieben