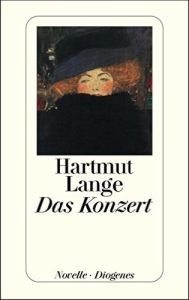 Unerhörtes aus dem Totenreich
Unerhörtes aus dem Totenreich
Als «Geheimtipp» hat Hartmut Lange sich selbst mal ironisch in einem Interview bezeichnet und ein zwischen kurzfristigem Hochjubeln und totalem Vergessen polarisierendes Feuilleton beklagt: «In so einer Atmosphäre können Sie Literatur nur aus Triebtäterschaft machen.» Sein Œuvre besteht seit Anfang der achtziger Jahre zum überwiegenden Teil aus Novellen, jene literarische Gattung, zu der Goethe angemerkt hat, sie berichte typischer Weise über eine «unerhörte Begebenheit.» Insoweit ist «Das Konzert» ganz klassisch konzipiert, mit einer konzisen Darstellung des uralten Themas von Schuld und Vergebung, hier exemplarisch an einem surrealen Aufeinandertreffen von Tätern und Opfern im Totenreich dargestellt. «Wer unter den Toten Berlins Rang und Namen hatte, wer es überdrüssig war, sich unter die Lebenden zu mischen, wer die Erinnerung an jene Jahre, in denen er sich in der Zeit befand, besonders hochhielt, der bemühte sich früher oder später darum, in den Salon der Frau Altenschul geladen zu werden, und da man wusste, wie sehr die elegante, zierliche, den Dingen des schönen Scheins zugetane Jüdin dem berühmten Max Liebermann verbunden war, schrieb man an die Adresse jener Villa am Wannsee, in der man die Anwesenheit des Malers vermutete.» Mit diesem Satz beginnt die Exposition dieser 1986 erschienenen Novelle.
Hauptfigur der Geschichte ist der 28jährige, hochbegabte Pianist Rudolf Lewanski, der während der Naziherrschaft in Litzmannstadt durch Genickschuss getötet wurde. Die Salondame alter Schule mit dem beziehungsreichen Namen wurde ebenfalls ermordet und nackt, mit verrenkten Gliedern, in eine Grube geworfen. Ihr ganzes Streben als Tote richtet sich nun darauf, ein Konzert in der Philharmonie zu veranstalten, in dem Lewanski die E-Dur-Sonate op. 109 von Ludwig van Beethoven spielen soll. Ein für ihn schwieriges Stück, für das er sich nicht reif genug fühlt als ewig 28Jähriger, er scheitert immer wieder an einer bestimmten Stelle. Als er nach intensivem Üben sich dem Konzert dann doch gewachsen fühlt, landet er auf dem Weg zur Philharmonie im zugeschütteten Bunker der ehemaligen Reichskanzlei. «Mein Mann und ich sind voller Sorge, dass es Ihnen nicht gelingen könnte, uns zu verzeihen.» Die da spricht ist die frisch verheiratete Eva Braun, und so spielt Lewanski nach einigem Zögern vor den versammelten toten Nazigrößen. Wieder scheitert er an der kritischen Stelle. «Litzmannstadt … Litzmannstadt » platzt es aus ihm heraus, «Sie hören es selbst: Um dies spielen zu können, sollte ich erwachsen sein. Man hat mich zu früh aus dem Leben gerissen.»
Der ermordete Schriftsteller Schulze-Bethmann, der ebenfalls in jenem Salon verkehrt, sieht keinen Grund, den Kontakt mit seinem eigenen Mörder, einem schwarz uniformierten SS-Mann, zu meiden. Und zum Konzert erklärt er: «Ich kann kein Unglück darin sehen, dass der Pianist Rudolf Lewanski den Mut, oder sagen wir, die Gelegenheit hatte, vor seinen Mördern auf dem Klavier zu spielen. Der Täter und sein Opfer – was bleibt uns im Tode anderes übrig, als in Betroffenheit beieinander zu sitzen und darüber zu staunen, welche Absurditäten im Leben allerdings und unwiderruflich geschehen sind.»
Der Autor versteht es, uns Lesern ohne aufdringliche Moral ein fürwahr schwieriges Thema nahe zu bringen, über das es sich weiterzudenken lohnt. Nur der Blick aus dem Totenreich vermag dabei hilfreich sein, nur so wird deutlich, dass die Untaten den Tätern ja letztendlich gar nichts nützen. Nur ewiges Bereuen und ewiges Verzeihen ist die Folge. Dieses surreale erzählerische Konstrukt erweist sich als wunderbar stimmig in Hinblick auf die hochgradig emotionsgeladene Holocaust-Thematik, die mit Sühne und Vergebung als ewigem Menetekel belastet ist. Ein, wie die Liebe und anderes mehr, nur dem Menschen eigenes, in der Natur, im Universum, nicht vorhandenes transzendentales Kriterium. Schade, dass es nur so wenige Leser gibt für eine derart tiefgründige Thematik.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
 Comment l’esprit vient aux filles
Comment l’esprit vient aux filles Nichts Halbes und nichts Ganzes
Nichts Halbes und nichts Ganzes Das auf ewig Unfassbare
Das auf ewig Unfassbare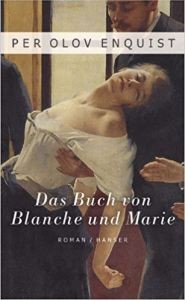 Omnia vincit amor
Omnia vincit amor Mit Sonnenuntergang
Mit Sonnenuntergang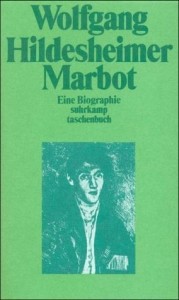 Die Fiktion als Wahrheit
Die Fiktion als Wahrheit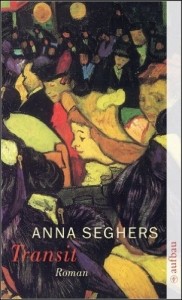 Chaos auch damals
Chaos auch damals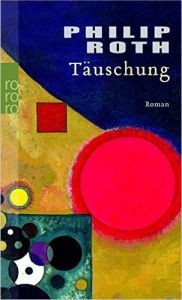 Postkoitales Verwirrspiel
Postkoitales Verwirrspiel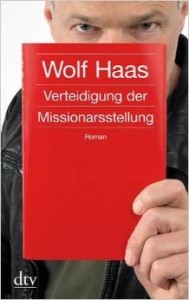 Alle Kreter sind Lügner, sagte der Kreter
Alle Kreter sind Lügner, sagte der Kreter Vom Gewinn beim Scheitern
Vom Gewinn beim Scheitern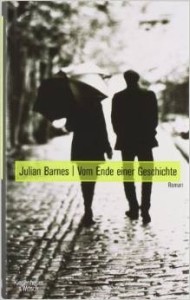 Ein literarischer Spaltpilz
Ein literarischer Spaltpilz Gegen den Dornröschenschlaf des Alltagslebens
Gegen den Dornröschenschlaf des Alltagslebens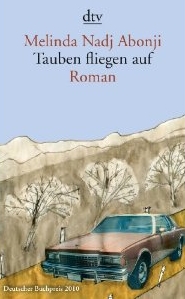 Mahnzeichen für den Balkankrieg?
Mahnzeichen für den Balkankrieg?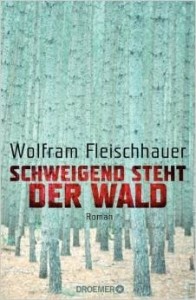 … und schüttelt den Kopf
… und schüttelt den Kopf