 Tonnerwetter
Tonnerwetter
Mit dem Roman «Stiller» gelang dem Schriftsteller Max Frisch 1954 der literarische Durchbruch. Im Prosawerk des Schweizer Autors ist die Identitätssuche des selbstentfremdeten modernen Menschen das zentrale Thema, es findet sich auch in den späteren Romanen «Homo faber» und «Mein Name sei Gantenbein» wieder, die ebenfalls seinem epischen Hauptwerk zuzuordnen sind. Und so wird denn der vorliegende Roman von dem Versuch seines Protagonisten Stiller beherrscht, der Determiniertheit seiner Handlungsweise zu entkommen, die Triebkräfte seines Inneren zu verstehen. Schon Georg Büchner hat in «Dantons Tod» seinem Helden ja die Frage in den Mund gelegt: »Was ist das, was in uns lügt, hurt, stiehlt und mordet»? Hier nun geht der Held den Weg der Selbstverleugnung, indem er einfach seine Identität wechselt, aus dem Schweizer Anatol Ludwig Stiller wird James Larkin White, ein US-Amerikaner.
«Ich bin nicht Stiller!» lautet denn auch der erste Satz, der laut Edgar Allen Poe ja oft schon die ganze Geschichte enthalte. Der bei seiner Einreise Festgenommne leugnet beharrlich, der jahrelang spurlos verschwundene Bildhauer Stiller zu sein, und er setzt auch alles daran, diese Identität nicht annehmen zu müssen, allen Fakten zum Trotz. Seine zunächst ziemlich kafkaesk anmutende Untersuchungshaft bildet den Hauptteil des Romans, in sieben Heften unter dem Titel «Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis» protokolliert er, auf Wunsch seines Verteidigers, das Geschehen aus persönlicher Sicht und kommentiert es. «Die Beziehung zwischen der schönen Julika und dem verschollenen Stiller begann mit der Nussknacker-Suite von Tschaikowsky» schreibt er, eine Musik, die Stiller verächtlich als «virtuose Impotenz» bezeichnete. Er heiratete die grazile Balletteuse ein Jahr später, ihre Ehe aber machte Beide nicht glücklich, ihre Probleme miteinander sind ein zweites Hauptthema des Romans. Und so kommt es zu einer Affäre mit Sibylle, einer verheirateten Frau, die ihren Mann Rolf sehr selbstbewusst darüber informiert. Stiller flieht aus dieser Beziehung und lässt auch seine kranke Frau im Stich, er fährt auf einem Frachter als blinder Passagier in die USA. Der Staatsanwalt, der sich mehr als sechs Jahre später mit seinem Fall zu beschäftigen hat, ist jener Rolf, der nun wieder mit seiner Sibylle zusammenlebt. Er ist es auch, der nach Stillers Verurteilung sein Freund wurde und ein «Nachwort des Staatsanwaltes» schreibt zu den sieben Heften, die er von ihm erhalten hat, wodurch wir Leser den Helden nun noch eine Weile lang begleiten in seiner wahren Identität.
Es ist eine äußerst komplexe Geschichte, in der Max Frisch seine philosophische Thematik, das zu hinterfragende «Ich» also, aufarbeitet. Mit dem Kunstgriff des fingierten «Ichs» in Person von White, aus dessen Perspektive über den Versager Stiller distanziert berichtet werden kann, obwohl die Beiden ja identisch sind, gelingt es ihm, aus einer singulärer Identität auszubrechen und ein zweites, verdecktes «Ich» zu etablieren. Der Ich-Erzähler White berichtet also in der Er-Form über Stiller, aus dieser Position nachdrücklich eine Einheit Stiller/White ausschließend, was dem Text einen gewissen Verfremdungseffekt verleiht und darüber hinaus auch seine Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Trotz dieser komplizierten Erzählsituation ist die Geschichte flüssig zu lesen, häufig sogar wird es auch amüsant, so zum Beispiel in den drei gleichnishaften Geschichten, die der Inhaftierte seinem naiven Wärter erzählt, von diesem immer wieder mit einem erstaunten «Tonnerwetter» begleitet. Zum Schmunzeln fand ich ferner die Beschreibungen des Volkscharakters seiner Schweizer Landsleute wie auch der Amerikaner, ebenso köstlich sind die bissigen Anmerkungen zur Architektur in seiner Heimat. Max Frisch erweist sich als ein großartiger, detailversessener Beobachter, seine sprachliche Könnerschaft liegt in der absoluten Treffsicherheit bei der Wortwahl.
«Ohne Mitwirkung des Lesers ist der Stiller weder zu lesen noch zu begreifen» hat Friedrich Dürrenmatt resümiert. Dem kann ich nur zustimmen, möchte aber ergänzen: Der Mühe wert ist es allemal!
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
 Schuster bleib bei deinen Leisten!
Schuster bleib bei deinen Leisten!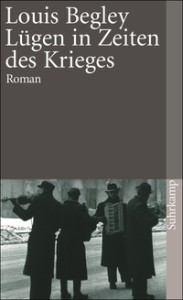 Keine Todsünde
Keine Todsünde Satire oder nicht
Satire oder nicht Es darf gedeutet werden
Es darf gedeutet werden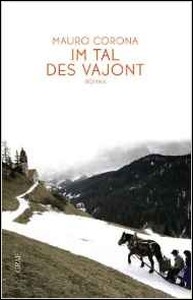 Danebengelungen
Danebengelungen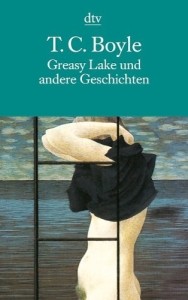 Amerikanisch, daran ist kein Zweifel
Amerikanisch, daran ist kein Zweifel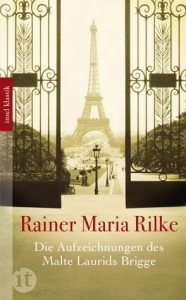 Der Lyriker als Romancier
Der Lyriker als Romancier Spezielle Lesefrüchte
Spezielle Lesefrüchte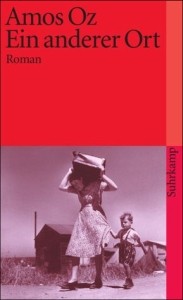 Im Mikrokosmos des Kibbuz
Im Mikrokosmos des Kibbuz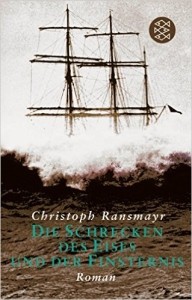 Eisige Chronik
Eisige Chronik Wertheimer war ausexistiert
Wertheimer war ausexistiert Suizid im Bonner Ghetto
Suizid im Bonner Ghetto Realität und Fiktion
Realität und Fiktion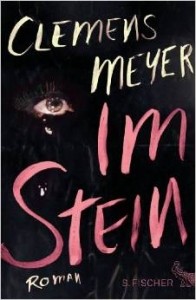 Pecunia non olet
Pecunia non olet