 Zweitlektüre zu empfehlen
Zweitlektüre zu empfehlen
Im Jahre 2008 erschien unter dem Titel «Der Turm» von Uwe Tellkamp der ‹ultimative Wenderoman›, er wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Vier Jahre später erreichte die ARD mit ihrer Verfilmung des Stoffs mehr als sieben Millionen Zuschauer. In seinem Opus magnum hat der Autor die letzten sieben Jahre der DDR bis zum unblutigen Volksaufstand im ersten Arbeiter- und Bauerparadies auf deutschem Boden thematisiert. Und er hat es aus einer ungewöhnlichen Perspektive geschildert, dem auch im Sozialismus durchaus vorhandenen Bildungs-Bürgertum eines noblen Dresdner Villenviertels.
Als Erzähler aus der Mitte einer oppositionell eingestellten, systemfernen Bourgeoisie fungieren dabei der zu Beginn 17jährige Schüler Christian, der Arzt werden will, ferner sein Vater Richard, Oberarzt in einer chirurgischen Klinik, sowie sein Onkel, der studierte Biologe Meno, der fachfremd als Lektor in einem renommierten Verlag tätig ist. In unzähligen Episoden mit einer Hundertschaft von Figuren werden hier Geschichten aus den verschiedensten Milieus erzählt, die in einem dichten Geflecht von Verbindungen allen möglichen Kreisen der Gesellschaft angehören. Neben dem familiären und nachbarschaftlichen Verbund sind dies das Gesundheits-Wesen, für das der Vater steht, ferner das Bildungs-Wesen und die Nationale Volks-Armee, die der Sohn durchläuft und durchleidet, und schließlich auch das Verlagswesen, in dem sich der Onkel zu behaupten hat. Alle Drei sind dabei den bekannt fiesen Pressionen des diktatorischen Regimes ausgesetzt und kämpfen mit dessen sich überall zeigenden, grotesken Unzulänglichkeiten. Über allem wacht als permanente Bedrohung ein Spitzelsystem, das jederzeit mit einem Schlage eine erfolgreiche Karriere endgültig zerstören oder eine sich abzeichnende von vornherein verhindern kann. Im privaten Leben kommt es neben dem täglichen Kampf mit der Mangelwirtschaft und jederzeit drohenden Denunziationen natürlich auch zu amourösen Verwicklungen, die so weit gehen, dass der Vater dem Sohn die Freundin ausspannt. Onkel Meno liegt in ständigem Kampf mit den literarischen Betonköpfen der Kulturbehörden, den er in einem geradezu poetischen Tagebuch festhält, aus dem im Roman immer wieder mal zitiert wird.
Uwe Tellkamp schildert das bourgeoise Milieu, dem er ja ebenfalls entstammt, mit scharfem Blick für kleinste Details durchaus selbstkritisch. Bei allem Realismus wird dem Geschehen aber auch die eine oder andere eher märchenhafte Szene auflockernd beigemischt. In diesem Kaleidoskop sind die einzelnen Textteile, oft in unterschiedlicher Diktion, locker aneinander gereiht. Neben fachsprachlichen Begriffen finden sich da auch Militär- oder Stasi-Jargon, ein lautgetreu geschriebenes, breites Sächsisch, zuweilen aber auch eine poetische, nur in der gehobenen Literatur anzutreffende Ausdrucksweise. «Der Turm» enthält Elemente des Schlüsselromans, mehr als ein Dutzend Figuren sind da mehr oder weniger deutlich erkennbar, ein Who-is-Who der DDR-Literatur-Schaffenden bis hin zu einigen aus dem dekadenten Westen.
Als Tausendseiter hat dieser Roman mit seinen familiären Erzählern nicht nur vom Umfang her gewisse Ähnlichkeiten mit den Buddenbrooks. Besonders deutlich wird das im ersten Teil durch dem vergleichbar bildungssatten wie auch beschaulichen Erzählgestus. Diesem bürgerlichen Realismus mit seinen vielen literarischen Anspielungen und Symbolen steht im zweiten Teil unter dem Titel «Die Schwerkraft» ein eher sozialistisch geprägter Realismus gegenüber. Der zielt, deutlich politischer, auf die sich abzeichnende Wende hin, jene am 9. November 1989 bevorstehende Zäsur, in die der Leser an diesem historischen Tag abrupt entlassen wird. Die gigantische Materialfülle ist letztendlich auch erdrückend, sie übersteigt in ihrer Vielfalt deutlich das Aufnahmevermögen. Was man dann erst beim zweiten Lesen merkt, denn nach mehr als zehn Jahren ist davon kaum noch etwas erinnerlich. Es lohnt sich also jede erneute Lektüre, eine erste aber ist geradezu Pflicht!
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
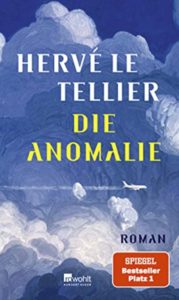
 Weniger wäre mehr gewesen
Weniger wäre mehr gewesen So what?
So what? Porträt eines Großschriftstellers
Porträt eines Großschriftstellers Der Flug ist das Leben wert
Der Flug ist das Leben wert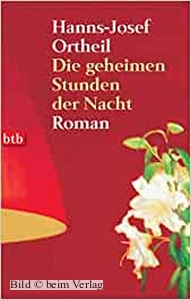 Misslungener narrativer Clou
Misslungener narrativer Clou
 Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau
Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau Liebe in einer verhunzten Welt
Liebe in einer verhunzten Welt Oberflächliche Vater/Sohn-Geschichte
Oberflächliche Vater/Sohn-Geschichte Pikareske Road Novel
Pikareske Road Novel Die Mär der 68er-Generation
Die Mär der 68er-Generation Brief an einen Toten
Brief an einen Toten