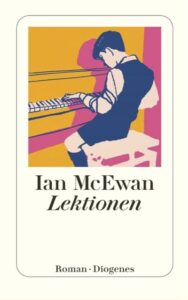
Es gibt Bücher, die Ausschnitte aus dem Leben eines Menschen zum Thema haben oder gar den gesamten Lebenslauf. Letztere nennt man dann am ehesten Biographien. Es gibt Bücher, die verschiedene Epochen der Weltgeschichte beleuchten. Das sind dann meist Sach- oder Geschichtsbücher. Ian McEwan kam irgendwann auf die Idee, in Lektionen beides über eine lange Zeitachse zu fusionieren. Es wäre nicht Ian McEwan, der britische Schriftsteller, der am Fließband Preise und Ehrentitel einheimst wie einst Walt Disney die Oscars (22!) oder Bayern München deutsche Meisterschaften (33!) und dem nur eine Kleinigkeit fehlt, nämlich der Literatur-Nobelpreis (aber jener hat – wie schon in früheren Rezensionen unschwer erkennbar – mit Literatur schon immer weniger zu tun als mit Politik), also es wäre nicht Ian McEwan, wenn er diese Hercules-Aufgabe nicht mit bekannter Bravour meistern würde. Es ist zusammengefasst ein Highlight der Weltliteratur entstanden, ein Werk mit einer fesselnden, autobiografisch angehauchten Story, aber gleichzeitig auch ein Werk, das fast keine heißen gesellschaftlichen Eisen der letzten sieben oder acht Dekaden und der Neuzeit auslässt und damit jede Menge philosophische Denk-Impulse setzt. An dieser Stelle können die Eiligen also bereits aussteigen.
Die Leserschaft begleitet Roland Baines von seiner Geburt Anfang der 50er Jahre bis ins hohe Alter. Auf 720 Taschenbuchseiten oder in 1,9 MB eBook schlagen einen unendlich viele Erfahrungen in den Bann (von McEwan’s exzellentem Schreibstil ganz zu schweigen).
Nur zwei Beispiele.
Beispiel eins. Im Vordergrund steht die sexuelle Beziehung von Roland zu seiner Klavierlehrerin, welche sich im Alter von 11 Jahren anbahnt und mit 14 Jahren körperlich wird. Diese Erfahrung hat Nachwirkungen bis in seine Sechziger/Siebziger. Ist all das eine strafbare Handlung durch die selbst psychisch auffällige, erst knapp über zwanzig Jahre alte Lehrerin? Spontan würden viele einem gesellschaftlich normierten Reflex folgend sofort ja sagen, aber so einfach macht es einem McEwan nicht.
Beispiel zwei. Nach einem Leben des Sich-treiben-Lassens erhofft sich Baines von der Ehe mit Alissa die ersehnte Stabilisierung. Kleines Häuschen und Vorgarten-Idylle eingeschlossen. Doch vier Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes verschwindet Alissa in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, um sich ihre Träume als Schriftstellerin zu erfüllen. Sie möchte dem Schicksal ihrer Mutter entgehen, die als verheißungsvolle Schriftstellerin nach Deutschland kam, aber durch eine Heirat alle hochfliegenden Pläne ad acta legen musste. Und welche für den Rest ihres Lebens unglücklich war („Ich habe das falsche Leben gelebt“).
Was alles steckt alleine in diesem meisterlichen Konstrukt? Von „Regretting Motherhood“ als einem ganz aktuellen Aspekt unserer gesellschaftlichen Gegenwart bis zur ewig gültigen und zeitlosen Frage „Was ist ein glückliches Leben?” und wie erreiche ich dieses.
Sind das die Erfahrungen und „Lektionen“ dieses Buches, die uns den Weg aufzeigen wollen? Mit großer Sicherheit nicht. Niemand kann sich am Ende der Lektüre erdreisten und beurteilen, wessen Leben denn nun glücklicher war – das des fatalistischen Roland Baines, dem das Leben einfach irgendwie passiert, der aus seiner gesellschaftskonformen Passivität, seiner lebenslangen Lethargie fast unmerklich in die senile Depression driftet. Oder das Leben von Alissa, die durch ihre fast schon immense psychische Kraftanstrengung und vielleicht auch durch den Ausbruch aus ihren Mutterpflichten zur weltberühmten Schriftstellerin wird, aber eine Vielzahl anderer Probleme kompensieren muss.
Das gesellschaftliche Denken der jeweiligen Zeit und die jeweiligen historischen Ereignisse bilden für all das das Bühnenbild, das sich mit der Handlung verwebt. Die Kuba-Krise, der Reaktorunfall von Tschernobyl, der Fall der Mauer, die Pandemie und viele andere Ereignisse der Weltgeschichte jener Zeit haben teilweise unmittelbaren Einfluss auf die Geschichte und das Leben und Agieren der Romanfiguren.
Als Leser stellt man sich bei der Lektüre immer wieder zwei Fragen:
Das Buch ist – das gibt Ian McEwan unumwunden zu – stark autobiografisch. Da wird man schon neugierig, was von alledem seinem Leben entspricht und was nicht, ohne dass dies letztendlich wichtig wäre. Ja, es gab den Major als strengen Vater, den verlorenen Bruder und das Klavierzimmer im Internat, aber sonst…?
Und zum anderen: Was sind denn nun die Lektionen oder neudeutsch die Lessons to take home, die Lifehacks? Natürlich kann und will er darauf keine allgemein gültigen Antworten liefern. Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang ein Interview mit Ian McEwan in der „Sternstunde Philosophie“ des Schweizer Fernsehens (SFR Mediathek oder YouTube), in dem McEwan sich im Gespräch mit Barbara Bleisch am ehesten dahingehend äußert, dass die Lektionen des Lebens die Summe der singulären Erfahrungen sind und dass Glück die Summe der bewusst wahrgenommenen glücklichen Momente ist.
Das ist doch schon eine ganze Menge.
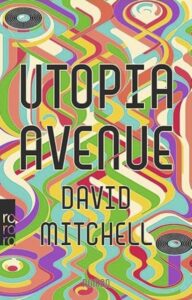 Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.
Was sagen Ihnen die folgenden Namen? Frank Zappa, Jackson Browne, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Herman’s Hermits.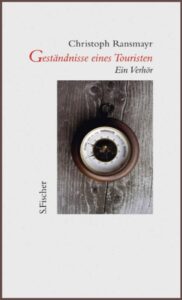

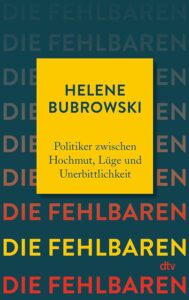 Helene Bubrowski ist mir als häufiger Gast bei Lanz bekannt, wo sie noch nie etwas Dummes gesagt hat, aber an richtigen Stellen lächelt. Das Buch lag in der Stadtbücherei bei Neuheiten, Rezensionen kannte ich nicht, nach der Lektüre eigentlich unverständlich, denn es ist sehr lesenswert.
Helene Bubrowski ist mir als häufiger Gast bei Lanz bekannt, wo sie noch nie etwas Dummes gesagt hat, aber an richtigen Stellen lächelt. Das Buch lag in der Stadtbücherei bei Neuheiten, Rezensionen kannte ich nicht, nach der Lektüre eigentlich unverständlich, denn es ist sehr lesenswert.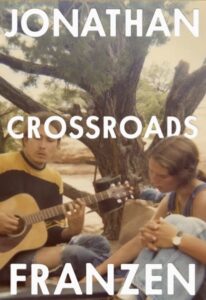
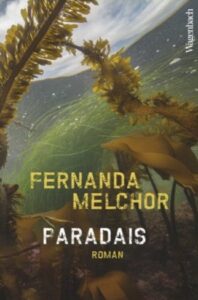 Wenn es eine Autorin mit zwei ihrer vier Romane auf die Short List des Internationalen Booker Price schafft, lässt das aufhorchen. Vielleicht geschah diese Huldigung auch ein Stück weit deshalb, weil Fernanda Melchor Mut hat. Obwohl sie an manchen Schauplätzen ihrer Romanhandlungen aus Angst um ihr Leben nicht recherchieren konnte, schreibt sie dennoch über all die brutalen Drogenkriege, die allgegenwärtigen Misshandlungen von Frauen und die deprimierende Ohnmacht gegenüber den endlosen Missständen in ihrer Heimat Mexiko. So tut sie es auch in „Paradais“.
Wenn es eine Autorin mit zwei ihrer vier Romane auf die Short List des Internationalen Booker Price schafft, lässt das aufhorchen. Vielleicht geschah diese Huldigung auch ein Stück weit deshalb, weil Fernanda Melchor Mut hat. Obwohl sie an manchen Schauplätzen ihrer Romanhandlungen aus Angst um ihr Leben nicht recherchieren konnte, schreibt sie dennoch über all die brutalen Drogenkriege, die allgegenwärtigen Misshandlungen von Frauen und die deprimierende Ohnmacht gegenüber den endlosen Missständen in ihrer Heimat Mexiko. So tut sie es auch in „Paradais“. 


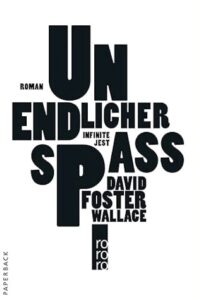
 Christian Kracht ist Schweizer mit deutschen Wurzeln. Er sieht sich selbst als Kosmopolit. Nach eigener Aussage begreift er seine Romane eher „humoristisch“, löst mit seinem Werk und Leben allerdings häufig heftige Kontroversen aus. Ein Mensch und Autor, der nicht einzuordnen ist, und der in Eurotrash offensichtlich immer noch nach seinem eigenen Platz und Stellenwert in einem Leben sucht, dessen materielle Rahmenbedingungen andere bei einem flüchtigen Blick neidvoll als beste Voraussetzungen für unbeschwertes Glück ansehen würden.
Christian Kracht ist Schweizer mit deutschen Wurzeln. Er sieht sich selbst als Kosmopolit. Nach eigener Aussage begreift er seine Romane eher „humoristisch“, löst mit seinem Werk und Leben allerdings häufig heftige Kontroversen aus. Ein Mensch und Autor, der nicht einzuordnen ist, und der in Eurotrash offensichtlich immer noch nach seinem eigenen Platz und Stellenwert in einem Leben sucht, dessen materielle Rahmenbedingungen andere bei einem flüchtigen Blick neidvoll als beste Voraussetzungen für unbeschwertes Glück ansehen würden.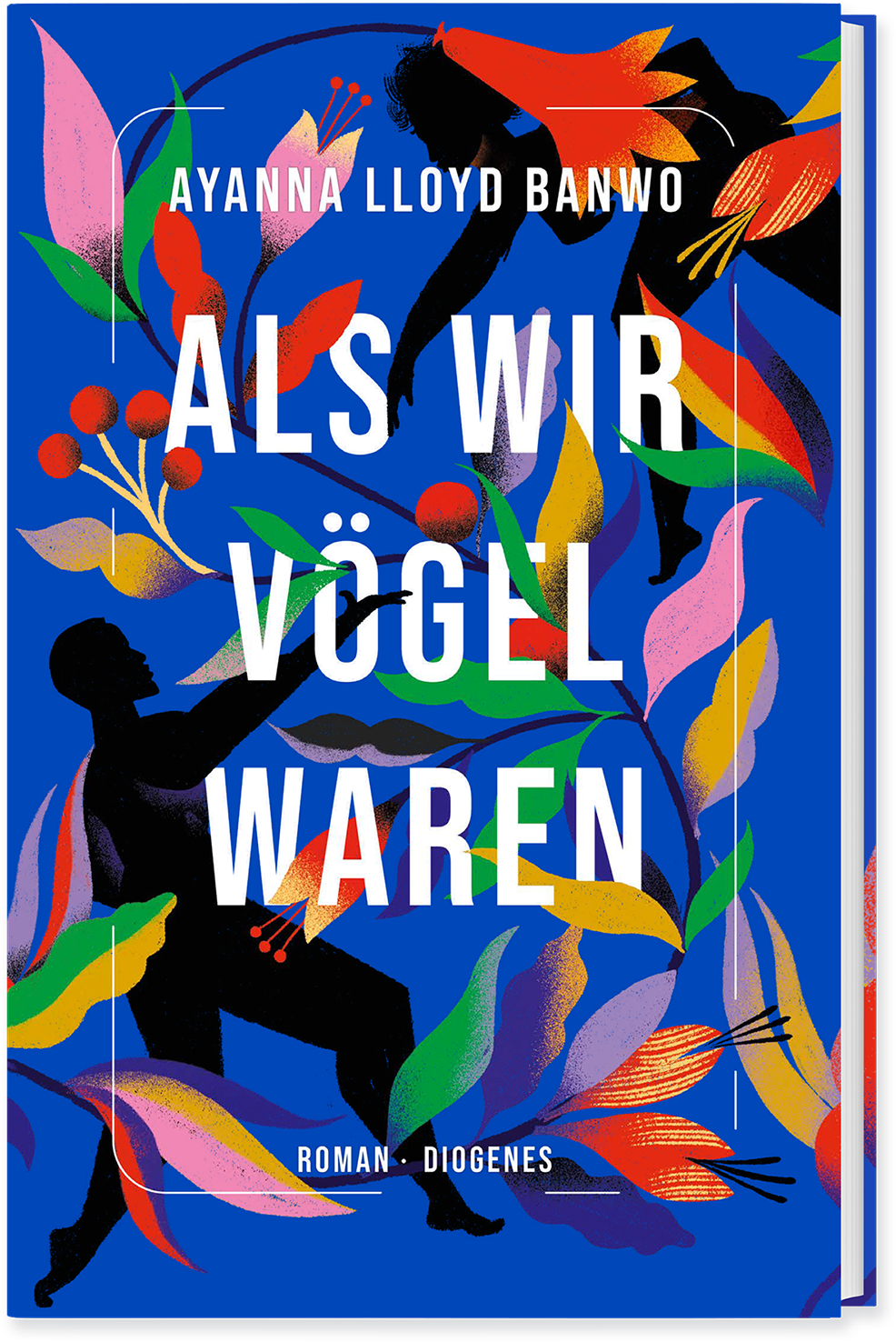

 „Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.
„Spannend… intensiv, verführerisch, erotisch…“, so überschlagen sich Literaturkritiker diverser renommierter Medien bei ihren Rezensionen zu Euphoria. Kombiniert mit dem Wortklang des Titels und dem nach einem fiktiven Pseudonym klingenden Namen der Autorin verführen spätestens Keywords aus der Inhaltsangabe wie „Dreiecksbeziehung in exotischem Setting“ zu völlig unzutreffender Kategorisierung. Also Vorsicht vor voreiligen Schnellschlüssen, denn das Buch bietet aus diesem Genre relativ wenig, aber dafür viel mehr Höherkarätiges.
