 Rote Kreuze: ein Roman gegen das Vergessen. Der fünfte ins deutsche übersetzte Roman des leidenschaftlichen Fußballfans und Autors aus Minsk könnte autobiographisch sein, so wie jede Geschichte ein kleines bisschen Wahrheit enthält. Die in „Rote Kreuze“ geschilderten Ereignisse könnten allerdings tatsächlich genauso geschehen sein. Denn das 20. Jahrhundert ist voll von solchen absurden und traurigen, aber dennoch sehr unterhaltsamen Geschichten.
Rote Kreuze: ein Roman gegen das Vergessen. Der fünfte ins deutsche übersetzte Roman des leidenschaftlichen Fußballfans und Autors aus Minsk könnte autobiographisch sein, so wie jede Geschichte ein kleines bisschen Wahrheit enthält. Die in „Rote Kreuze“ geschilderten Ereignisse könnten allerdings tatsächlich genauso geschehen sein. Denn das 20. Jahrhundert ist voll von solchen absurden und traurigen, aber dennoch sehr unterhaltsamen Geschichten.
„Trauerfanfaren und Tragödienpathos“
Der junge Alexander zieht nach einer Lebenskrise mit seiner Tochter nach Minsk und begegnet in seiner neuen Bleibe der über neunzigjährigen Tatjana Alexejewna, die unter Alzheimer leidet. Bevor sie alles vergisst, will sie aber Alexander noch alles erzählen. Doch dieser weigert sich anfänglich, weil er glaubt, selbst so aus seinem Leben gerissen zu sein, dass seine eigene Tragödie die weitaus schlimmere ist. Aber die alte Dame erzählt ihm die Geschichte ihres Lebens so eindrücklich, dass er bald von selbst bei ihr anklopft, um die Fortsetzung und schließlich das tragische Ende zu erfahren. Schließlich umspannt ihre Geschichte das ganze russische 20. Jahrhundert mit all seinen Schrecken und Tragödien.
„Biographie der Angst“
Ihr Vater gehörte zu einer der wenigen Menschen, der zur Zeit der russischen Revolution nach Russland, „ins Epizentrum der Geschichte“, statt von Russland wegzog. Alexej Alexejewitsch Bely war nicht unbedingt Kommunist, aber er glaubte daran, dass dort der „neue Mensch“ und die „neue Zeit“ beginne. Das war aber erst der Anfang von Tatjana’s Verhängnis. Dann mit dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 begann ihre eigentliche Tragödie, die ihren Anfang eigentlich mit einem absichtlichen Tippfehler nahm. Als Angehörige eines politisch Verfolgten muss Tatjana ihr Leben in einem sowjetischen Lager verbringen, jedoch stellt sich am Ende alles als eine absurde Verwechslung heraus. Die Pointe des Romans hat es tatsächlich in sich und man liest ihn voller Spannung in einem Atemzug zu Ende.
Eine düstere Anklage an Gott. Aber auch an die Sowjetmacht und letztendlich eine Gemahnung, dass man sich die Probleme meist selbst einhandelt, wenn man versucht, etwas vermeintlich Gutes zu tun und sich oder die eigenen zu schützen. Sasha Filipenko hat mit „Rote Kreuze“ den Roman des russischen 20. Jahrhunderts geschrieben.
Sasha Filipenko
Rote Kreuze
Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer
2020, Hardcover, Leinen, Schutzumschlag, 288 Seiten
ISBN: 978-3-257-07124-5
€ (D) 22.00 / sFr 30.00 / € (A) 22.70
Diogenes Verlag
 Wo er recht hat, hat er recht
Wo er recht hat, hat er recht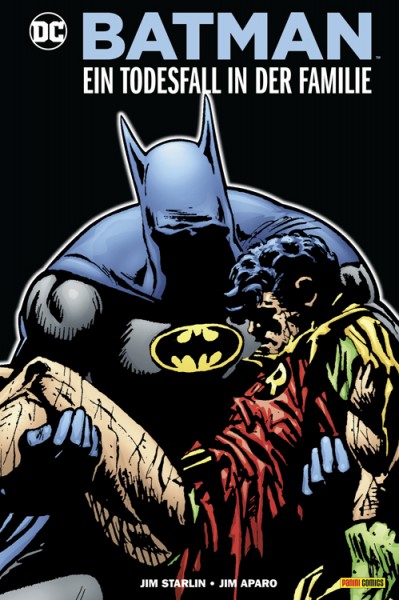

 Der Trinker als soziologische Parabel
Der Trinker als soziologische Parabel Ach, hätte der Autor
Ach, hätte der Autor Vexierbild als Mileustudie
Vexierbild als Mileustudie Ein moderner Plutarch
Ein moderner Plutarch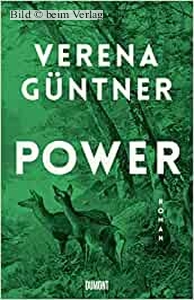 Allegorie auf das Verschwinden
Allegorie auf das Verschwinden Schlafrock-Existenz als Allegorie
Schlafrock-Existenz als Allegorie

 wurde eine fortlaufende Serie gestartet, die bis 2014 lief und sage und schreibe 170 Ausgaben erreichte. Die Serie wurde anfangs von Chuck Dixon gestaltet, dann ab Ausgabe 56 übernahm Gail Simone die Serie federführend. Zuletzt schrieben Duane Swierczynski und Christy Marx die Birds of Prey Geschichten. Die Zeichner der Serie waren verschiedene Künstler, darunter Ed Benes, Joe Bennett, Greg Land und Nicola Scott.
wurde eine fortlaufende Serie gestartet, die bis 2014 lief und sage und schreibe 170 Ausgaben erreichte. Die Serie wurde anfangs von Chuck Dixon gestaltet, dann ab Ausgabe 56 übernahm Gail Simone die Serie federführend. Zuletzt schrieben Duane Swierczynski und Christy Marx die Birds of Prey Geschichten. Die Zeichner der Serie waren verschiedene Künstler, darunter Ed Benes, Joe Bennett, Greg Land und Nicola Scott. 
 Veröffentlichungen zum Film haben natürlich auch ausschließlich Harley Quinn im Fokus. Darunter Band 4 der Knaller-Kollektion und ein weiterer Greatest Hits-Band, sowie ein Birds of Prey: Harley Quinn Special und das erste Album des Dreiteilers Harleen, einer grandiosen Neuinterpretation der Figur von Ausnahmekünstler Stjepan Sejic.
Veröffentlichungen zum Film haben natürlich auch ausschließlich Harley Quinn im Fokus. Darunter Band 4 der Knaller-Kollektion und ein weiterer Greatest Hits-Band, sowie ein Birds of Prey: Harley Quinn Special und das erste Album des Dreiteilers Harleen, einer grandiosen Neuinterpretation der Figur von Ausnahmekünstler Stjepan Sejic.
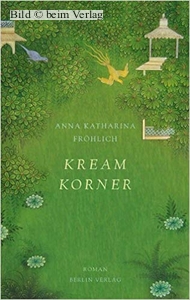 Boheme vs. Dekadenz
Boheme vs. Dekadenz Unselige Allianz von Schicksal und Zufall
Unselige Allianz von Schicksal und Zufall
 Venezianische Affären 2: Venedig steht unter Wasser und die Intrigen des internationalen Adels reichen bis in ferne Kontinente. Das kommt einem irgendwie bekannt vor. Denn auch im Venedig des 18. Jahrhunderts war es nicht anders als heute. Nur dass es jetzt nicht mehr der Adel ist.
Venezianische Affären 2: Venedig steht unter Wasser und die Intrigen des internationalen Adels reichen bis in ferne Kontinente. Das kommt einem irgendwie bekannt vor. Denn auch im Venedig des 18. Jahrhunderts war es nicht anders als heute. Nur dass es jetzt nicht mehr der Adel ist. Grieche trifft Schwedin
Grieche trifft Schwedin