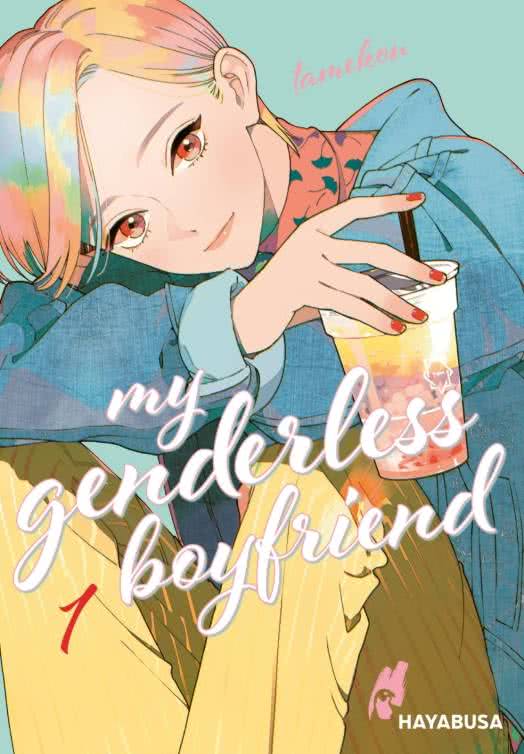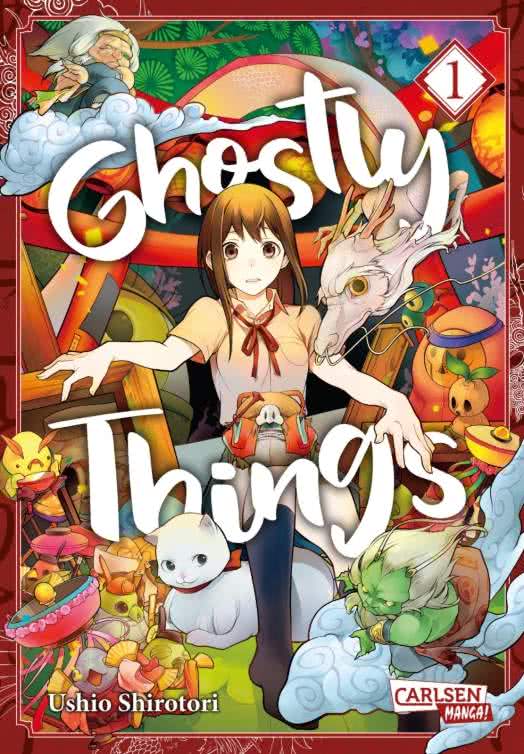Hören versus Schwerhörigkeit
Hören versus Schwerhörigkeit
Taichi fällt dem schwerhörigen Studenten Kohei bei ihrer ersten Begegnung quasi auf den Kopf. Nach einer etwas turbultenten Anlaufphase übernimmt der quirlige Student für seinen ruhigen Mitstudenten Kohei die Mitschriften von Vorlesungen, dafür erhält Taichi Mahlzeiten von ihm. So freunden sich die beiden an, und Taichi gewinnt immer mehr Kenntnisse über die Welt von Schwerhörigen und Gehörlosen. Als er ein Arbeitsangebot von einer Firma erhält, die auf die Bedürfnisse von Gehörlosen spezialisiert ist, schmeißt er sein Studium und nimmt die Arbeit an. Kohei dagegen studiert weiter. Das führt dazu, dass sich die beiden immer weniger sehen. Beide bauen sich ihre Welten jenseits des anderen auf. Kohei trifft mehr Gehörlose. Einer der neuen Bekannten geht davon aus, dass die Welt der Gehörlosen und die der normal Hörenden nicht zueinander passen. Dazu kommt, dass sich Kohei in Taichi verliebt hat, Taichi aber noch mit seinen Gefühlen für Kohei kämpft. Als Kohei Fotos von einem Workshop sieht, den Taichi wegen seiner Arbeit besuchen muss, reagiert er eifersüchtig auf Taichics Chef Chiei, der sehr vertraut mit Taichi scheint.
BL und Menschen mit Handicap
Die Folgeserie der BL-Reihe (BL = boys love) “I hear the sunspot” baut ein retardierendes Moment ein, indem sich die beiden Protagonisten kaum sehen, weil sie jetzt in unterschiedlichen Welten leben. Kohei zweifelt immer mehr, ob seine Gefühle für Taichi bei dem energiegeladenen Tollpatsch auf Gegenliebe stoßen. Taichi dagegen wird sich durch seine Arbeit und die damit verbundene räumliche Trennung von Kohei immer mehr bewusst, dass er Kohei liebt.
Zentral in dieser Serie sind 2 Themen: das der homosexuellen Liebe und das der Menschen mit Handicap, die sich in einer Welt zurechtfinden müssen, die für ihre Bedürfnisse nicht ausgelegt ist. Es ist ungewöhnlich, dass diese beiden Themen kombiniert werden bzw. dass Menschen mit Handicap Manga-Protagonisten werden. Solche Manga dürfte es ruhig öfter geben.
Kohei und Taichi machen einen Prozess durch, in dem sie sich ihrer Gefühle bewusst werden. Kohei ist schließlich der erste, der sich ein Herz fasst und Taichi seine Gefühle gesteht. Ein Outing anderen gegenüber findet aber (noch) nicht statt. Taichi braucht noch länger, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Der Prozess wird im Manga recht glaubhaft dargestellt. Die Probleme, die Homosexuelle innerhalb der Gesellschaft haben, werden hier also im Gegensatz zu vielen anderen Manga deutlicher angesprochen.
Der mit gutem Aussehen gesegnete ruhige Riese Kohei kommt bei Mädchen sehr gut an, empfindet aber die Kommunikation mit ihnen und anderen normal Hörenden als sehr anstrengend. Er und andere Schwerhörige und Gehörlose kämpfen außerdem mit Vorurteilen: Da sie nichts oder nur wenig hören, gelten sie für andere als arrogant, weil sie sie angeblich ignorieren. Da die meisten “Normalos” keine Gebärdensprache sprechen, sind die Gehörlosen auf Lippenlesen und langsames Sprechen angewiesen. Das erschwert eine Teihabe an ansonsten ganz normalen Dingen wie z.B. einer Vorlesung – Taichi muss mitschreiben, weil der Dozent zu weit weg ist, damit Kohei ihn verstehen bzw. von dessen Lippen lesen kann.
Das stellt der Manga gut heraus: Er spricht an, wie Leute mit Handicap von der Gesellschaft behindert werden, und wie sich Missverständnisse und Vorurteile bilden. Taichi ist Vorbild: Er geht ganz unvereingenommen mit Kohei und anderen Gehörlosen um. Außerdem gelingt es ihm, sich in sie hineinzuversetzen. Kohei kommt Taichis laute und extrovertiert-übertriebene Art zugute: So kann er Taichi hören und seine Gesten besser verstehen. Indirekt wird damit angedeutet, dass jede*r gut ist, so wie sie/er ist. Taichi nervt zwar andere Hörende mit seiner extrovertierten Art, aber bei den Gehörlosen kommt er genau deswegen gut an.
Fazit
Gefühlvolle Manga-Reihe, die die romantische homosexuelle Liebe Schritt für Schritt entfaltet und das Leben mit Handicap gut beschreibt.

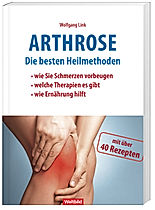
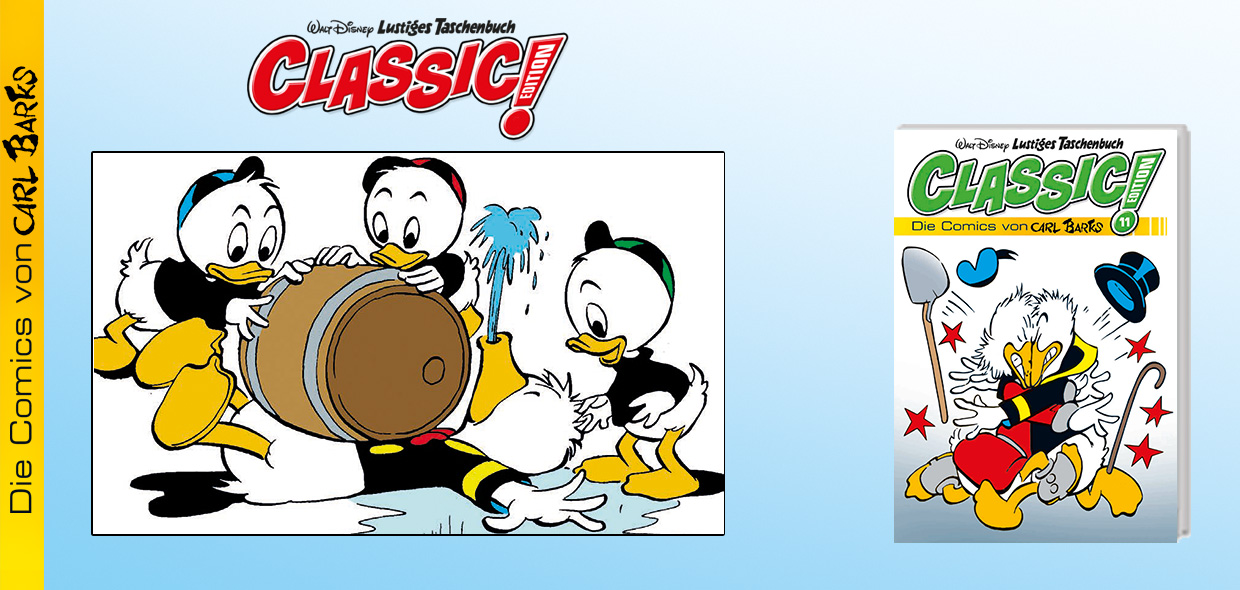

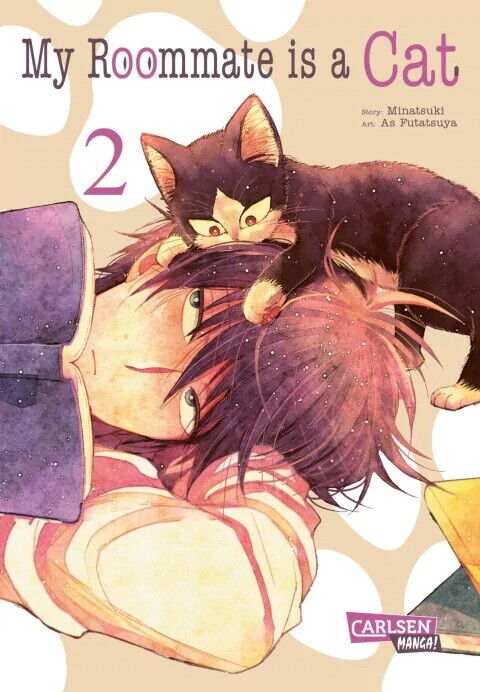

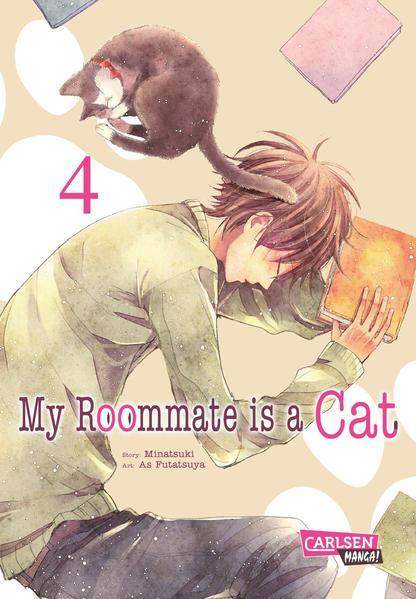
 Einen Wondrak für alle Lebenslagen: Mit 88 Jahren verkündete Janosch in der deutschen Wochenzeitschrift ZEIT, dass er keine Wondraks mehr publizieren werde. Über 350 Wondrak-Zeichnungen waren bis dahin schon erschienen. Über 300 Bücher hatte Janosch zeit seines Lebens publiziert, viele seiner Geschichten waren in 40 Sprachen übersetzt worden. Mit „Wondrak für alle Lebenslagen“ kann man nochmals zurückblicken und sich erinnern. Der Reclam Verlag macht’s möglich.
Einen Wondrak für alle Lebenslagen: Mit 88 Jahren verkündete Janosch in der deutschen Wochenzeitschrift ZEIT, dass er keine Wondraks mehr publizieren werde. Über 350 Wondrak-Zeichnungen waren bis dahin schon erschienen. Über 300 Bücher hatte Janosch zeit seines Lebens publiziert, viele seiner Geschichten waren in 40 Sprachen übersetzt worden. Mit „Wondrak für alle Lebenslagen“ kann man nochmals zurückblicken und sich erinnern. Der Reclam Verlag macht’s möglich.
 Randschaften. Auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit: Wien vor 40 Jahren. In den Achtzigern. Die Stadt war damals grau und verlassen und eine Menge Seniorinnen mit ihren Hunden bevölkerten die ansonsten leeren Straßenbahnen. Meist trugen sie Pelzmäntel und waren grantig. Der typische Wiener Grant, den es damals auch noch an den Häuserfassaden gab. Ein nostalgischer Rückblick „auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit“ anhand von Fotografien und kurzen Texten zeigt in vorliegender Publikation, dass der goldene Westen auch einmal grau war. Dafür aber voller Charme.
Randschaften. Auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit: Wien vor 40 Jahren. In den Achtzigern. Die Stadt war damals grau und verlassen und eine Menge Seniorinnen mit ihren Hunden bevölkerten die ansonsten leeren Straßenbahnen. Meist trugen sie Pelzmäntel und waren grantig. Der typische Wiener Grant, den es damals auch noch an den Häuserfassaden gab. Ein nostalgischer Rückblick „auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit“ anhand von Fotografien und kurzen Texten zeigt in vorliegender Publikation, dass der goldene Westen auch einmal grau war. Dafür aber voller Charme. Vom Ende der Geduld
Vom Ende der Geduld Fanal der Selbstbehauptung
Fanal der Selbstbehauptung
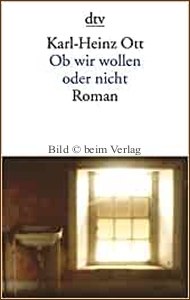 Alles eine Frage der Sprache
Alles eine Frage der Sprache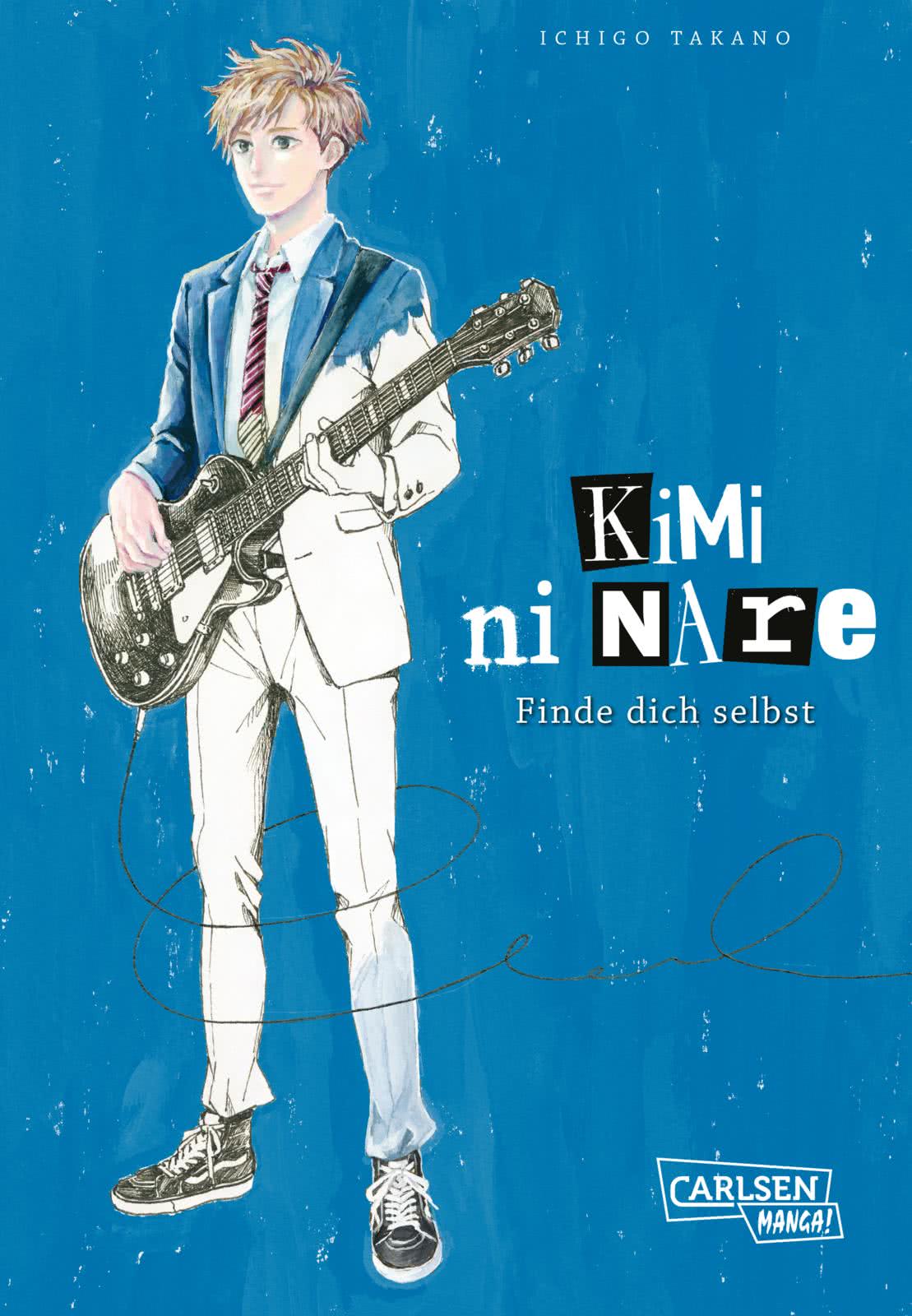 Finde dich selbst
Finde dich selbst Illusionistische Multikulti-Euphorie
Illusionistische Multikulti-Euphorie