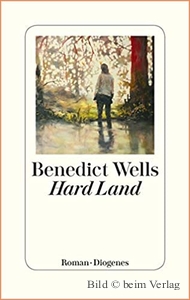 Bittersüßer Roman
Bittersüßer Roman
In seinem fünften Roman «Hard Land» erzählt Benedict Wells eine Coming-of-Age-Geschichte, die er in einer fiktiven Kleinstadt in den USA angesiedelt hat. Sein 15jähriger Protagonist und Ich-Erzähler durchlebt dort im Jahre 1985 die schwierige Phase der Mannwerdung und muss sich als überängstlicher Außenseiter mühsam einen Platz unter seinen Mitschülern erkämpfen. Auch die erste Liebe erweist sich als schwierig, vor allem aber muss er mit dem frühen Tod seiner Mutter fertig werden.
Sam Turner lebt in einer dem Niedergang geweihten 20tausend-Einwohner-Stadt in Missouri, deren einziger großer Arbeitgeber in Konkurs gegangen ist. Auch sein Vater ist arbeitslos, seine seit fünf Jahren krebskranke Mutter betreibt einen kleinen Buchladen. Er erzählt seine Geschichte im Rückblick ein Jahr später. Der erste Satz lautet: «In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb». Die Ferien stehen an, seine Eltern wollen ihn zur Tante schicken, die zwei Jungen in seinem Alter hat. Sein erster Besuch dort war aber ein Horror für ihn, und so nimmt er kurz entschlossen einen Ferienjob im örtlichen Kino an, um dem zu entgehen. Dort trifft er auf Cameron, den schwulen Sohn eines erfolgreichen Fabrikanten, und auf den farbigen Hünen Brandon, den sie nur Hightower nennen und dessen Vater eine Farm betreibt. Dritte im Bunde dieser Clique, die sich um das Kino kümmert, ist Kristie, die Tochter des Kinobetreibers. Alle sind zwei Jahre älter als Sam, haben die Schule abgeschlossen und werden das öde Kaff verlassen, um weit weg in New York, Chicago und Los Angeles ihr Studium zu beginnen. Kaum hat er glücklich Anschluss an diese Clique gefunden, steht also in elf Wochen auch schon wieder der Abschied bevor. Und das schmerzt insbesondere wegen der Beziehung zu Kristie, die sich als zarte Bande entwickelt, obwohl sie längst einen festen Freund hat, während er, als männliche Jungfrau, noch nicht mal bis zum Händchenhalten, Küssen oder gar noch mehr gekommen ist.
Benedict Wells hat in seinen Roman eine Fülle von kreativen Ideen eingebaut, zu denen auch der Buchtitel gehört. Der führt nämlich auf einen fiktiven Schriftsteller des Ortes zurück, der unter «Hard Land» 1893 einen Gedichtzyklus veröffentlich hat, an dem sich die Schüler bei der Prüfung in Literatur heute noch die Zähne ausbeißen. Und so glänzt denn dieser Roman mit der Mutter als Buchhändlerin durch eine reiche Intertextualität, zu der auch Kristies Faible für erste Sätze in Romanen zählt, welches der Rezensent, soviel Persönliches sei hier mal erlaubt, mit dem überaus smarten Mädchen teilt. Ergänzt werden diese literarischen Bezüge noch durch diverse popkulturelle, denn Sam ist als Gitarist sehr musikbegeistert, und seit er den Kinojob macht, entwickelt er sich auch noch zum Cineasten. Das besonders innige Verhältnis zwischen Sam und seiner Mutter symbolisiert ein kleiner blauer Holzlöwe, Lieblingsfigur ihrer Sammlung. Den deponieren Vater und Sohn nach ihrem Tod immer wieder heimlich irgendwo, damit ihn der jeweils andere überrascht finde, – eine berührende Geste ihrer ganz persönlichen Erinnerungskultur.
In 49 Kapiteln begleitet man den Heranwachsenden durch die entscheidende Phase seiner Adoleszenz, wobei es dem Autor gelingt, auch eine Menge Lokalkolorit einzubringen in seine Geschichte. Eine schöne Parabel für Sams Hoffnungslosigkeit handelt von einem magischen Ring mit einer auf jede Lebenslage passenden Gravur: «Auch das geht vorbei». Im letzten Teil des Romans bleibt er allein zurück, alle Freunde sind fort, die Briefe werden kürzer, seltener und bleiben irgendwann ganz aus. Aber nach dem einsam verbrachten Winter kommen schließlich auch wieder die Sommerferien, und die drei Freunde kehren ernüchtert zurück. Ihr Kaff ist doch nicht so schlecht, wie sie gedacht haben, es hat ihnen sogar gefehlt in der Ferne. Und das Ende mit Sam und Kristie lässt dann wunderbar leicht alles offen, ein bittersüßer Roman also, und das absolut kitschfrei, – Chapeau!
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de

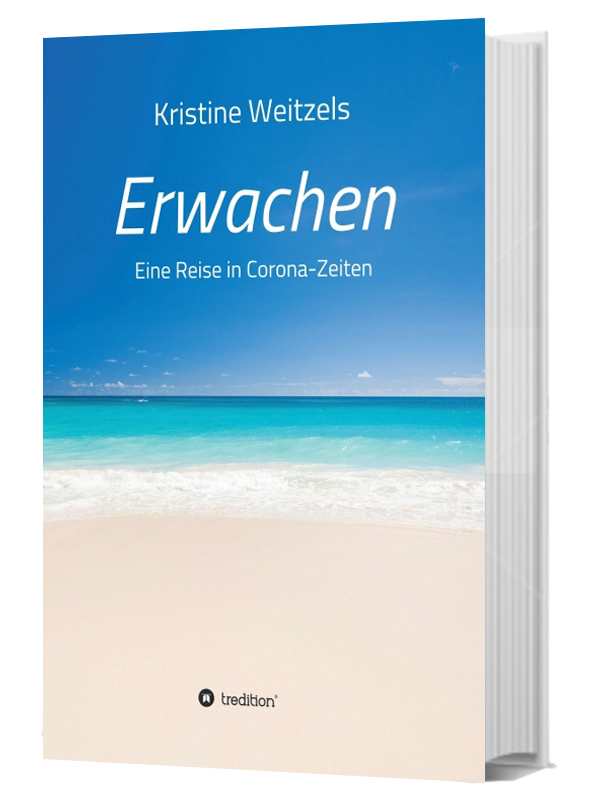
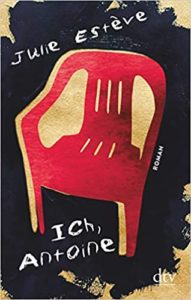

 Nudelsalat ist nicht gleich Nudelsalat
Nudelsalat ist nicht gleich Nudelsalat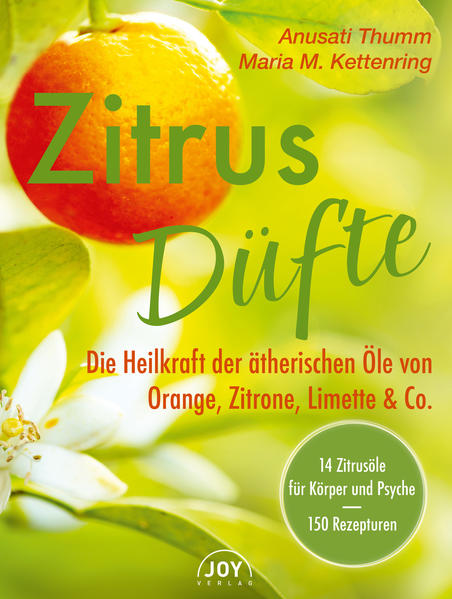 Zitrusfrüchte: Stimmungsaufhellende Farben und Düfte und vieles mehr
Zitrusfrüchte: Stimmungsaufhellende Farben und Düfte und vieles mehr Blutrünstiger Karibik-Thriller
Blutrünstiger Karibik-Thriller
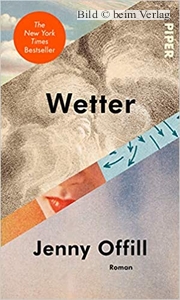 Der neue Roman der im eigenen Land hoch gelobten amerikanischen Schriftstellerin Jenny Offill, an dem sie sieben Jahre lang geschrieben hat, deutet mit seinem Titel «Wetter» schon seine Thematik an. Denn Wetter ist die gegenwärtige Form des langfristigen Phänomens Klima, ein Reizthema also, hinter dem ein Schreckens-Szenario lauert. Analog dazu behandelt die Autorin in ihrem Buch die nicht weniger bedrohliche soziale Wetterlage in den USA. Und so ist denn dieser Roman eine breit angelegte Gegenwarts-Analyse der amerikanischen Gesellschaft unter Trump, mit all ihren Psychosen und apokalyptischen Ängsten, die Phänomene wie die Prepper-Bewegung erzeugen oder den vielen obskuren Sekten immer neue Mitglieder zutreiben.
Der neue Roman der im eigenen Land hoch gelobten amerikanischen Schriftstellerin Jenny Offill, an dem sie sieben Jahre lang geschrieben hat, deutet mit seinem Titel «Wetter» schon seine Thematik an. Denn Wetter ist die gegenwärtige Form des langfristigen Phänomens Klima, ein Reizthema also, hinter dem ein Schreckens-Szenario lauert. Analog dazu behandelt die Autorin in ihrem Buch die nicht weniger bedrohliche soziale Wetterlage in den USA. Und so ist denn dieser Roman eine breit angelegte Gegenwarts-Analyse der amerikanischen Gesellschaft unter Trump, mit all ihren Psychosen und apokalyptischen Ängsten, die Phänomene wie die Prepper-Bewegung erzeugen oder den vielen obskuren Sekten immer neue Mitglieder zutreiben.

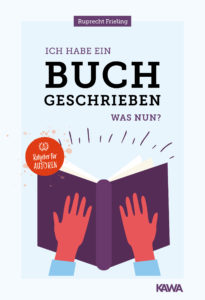
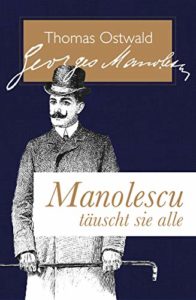

 The Cure. Dunkelbunte Jahre: 2019 wurden The Cure in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das bisher letzte, aktuelle, 13., Studioalbum von der Band aus dem südenglischen Crawley erschien 2008, also schon vor mehr als zehn Jahren. Da es also mit Album #14 noch etwas dauern könnte, können sich die Fans die Zeit bis dahin mit „The Cure. Dunkelbunte Jahre“ vertreiben. Das reich bebilderte, großformatige Werk orientiert sich in seiner Erzählung an der Chronologie der Studioalben. Ideal also auch als Nachschlagewerk für Fans und die es noch werden wollen.
The Cure. Dunkelbunte Jahre: 2019 wurden The Cure in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das bisher letzte, aktuelle, 13., Studioalbum von der Band aus dem südenglischen Crawley erschien 2008, also schon vor mehr als zehn Jahren. Da es also mit Album #14 noch etwas dauern könnte, können sich die Fans die Zeit bis dahin mit „The Cure. Dunkelbunte Jahre“ vertreiben. Das reich bebilderte, großformatige Werk orientiert sich in seiner Erzählung an der Chronologie der Studioalben. Ideal also auch als Nachschlagewerk für Fans und die es noch werden wollen.

