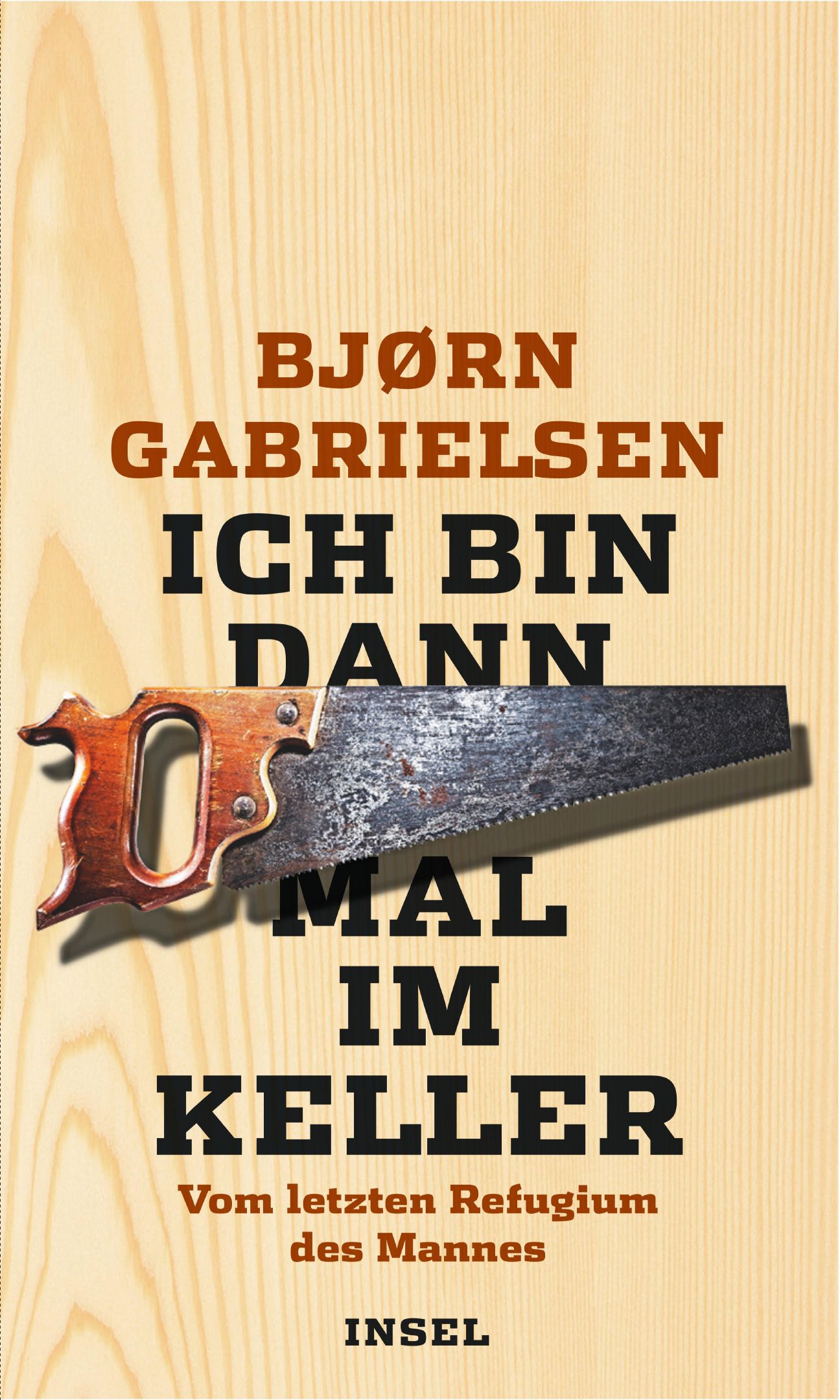Der Autor ist Psychologe und forscht zur neuronalen Entwicklung der Babys. Als Wissenschaftler kennt er die einschlägigen Publikationen der letzten Jahrzehnte und belegt seine Aussagen: Die Literaturliste bringt es auf über dreißig der knapp vierhundert Seiten. Es geht ihm nicht um die motorische Entwicklung, sondern um Gedanken und Gefühle der Babys, und: Warum lachen wir Menschen eigentlich? Manchmal erzählt er auch aus dem Nähkästchen, was Wissenschaftler voneinander halten. Laien bezieht er mithilfe des Internets in seine Forschung ein, manche Eltern erzählen von sich und ihren Gefühlen, die die Babys auslösen und geizen nicht mit Beiträgen über die Leistungen ihrer Kinder.
Der Autor ist Psychologe und forscht zur neuronalen Entwicklung der Babys. Als Wissenschaftler kennt er die einschlägigen Publikationen der letzten Jahrzehnte und belegt seine Aussagen: Die Literaturliste bringt es auf über dreißig der knapp vierhundert Seiten. Es geht ihm nicht um die motorische Entwicklung, sondern um Gedanken und Gefühle der Babys, und: Warum lachen wir Menschen eigentlich? Manchmal erzählt er auch aus dem Nähkästchen, was Wissenschaftler voneinander halten. Laien bezieht er mithilfe des Internets in seine Forschung ein, manche Eltern erzählen von sich und ihren Gefühlen, die die Babys auslösen und geizen nicht mit Beiträgen über die Leistungen ihrer Kinder.
Im Vorwort Was ist so lustig?
wird die Darstellungsweise vorgestellt, die Entwicklung des Lachens bei Kindern wird chronologisch beschrieben: „Letzten Endes soll dieses Buch jedoch das Unmögliche leisten und den wunderbaren Klang eines Babylachens noch zauberhafter machen. Wenn mir das nicht gelingt, suchen Sie sich am besten ein Baby und lassen sie sich von ihm unterhalten.“
An dieser Stelle möchte ich, die Rezensentin, die eigene Entwicklung meiner Wahrnehmung und meines Verstehens von Säuglingen beschreiben. Meine Eltern hatten noch die Bibel der schwarzen Pädagogik von Frau Harrer: „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ im Schrank, auch als ich in den siebziger Jahren Kinderärztin wurde, und bald auch Mutter, wurde den Müttern in Entbindungskliniken das Füttern zu festen Zeiten, mit festen Mengen und auch Fertigmilchproben mit auf den Weg gegeben.
Wenn ich in dieser Zeit die Kampagne „Nestlé tötet Babys“ unterstützte, dann hatte ich die körperliche Entwicklung im Auge: Gerade in Entwicklungsländern war die hohe Säuglingssterblichkeit auch dadurch bedingt, dass hygienische und oft auch finanzielle Mängel dazu führten, dass Flaschenkinder verhungerten oder an Durchfall starben.
Als ich dann mehrere Jahre in Afrika arbeitete, begriff ich, wie viel mehr Fürsorge afrikanische Kinder erfahren durften, auch, welche emotionale Bedeutung das Stillen hat. Mehr noch: Die Kinder hatten kein Gitterbettchen, in das sie abgelegt wurden zum Schlafen, sondern schliefen ein, wo sie gerade saßen, meist war es irgendein Schoß bei Menschen, die mit ihnen in Kontakt waren. Ich ahnte, wie falsch, ja schädlich, viele unserer kinderärztlich begründeten Weisheiten gewesen waren.
Bei Addyman lese ich nun, wie inzwischen einige der Vorstellungen dieser Zeit, auch die „großer Denker“, widerlegt wurden, und, wie es ihn mit Freude und Genugtuung erfüllt, wenn die Bedeutung des Lachens für unsere Seelen bewiesen wird. Ich freue mich dann immer mit.
Eine Zeit vor dem Lächeln
In diesem Kapitel wird das Wissen über die vorgeburtliche Entwicklung zusammengefasst: Vor allem die 4D Ultraschalldiagnostik zeigt, dass Babys etwa 90 % der Zeit Schlafen, dass sie Lächeln und Schmerzen in ihrem Gesicht ausdrücken. Und nach der Geburt werden Babys beruhigt, wenn sie Melodien wiedererkennen, sie sie noch im Mutterleib gehört hatten.
Alles Gute zum Geburtstag
Hier wird das geburtshilfliche Wissen auf dem neuesten Stand beschrieben, wir lesen, dass Kaiserschnittgeburten die Bindung zwischen Mutter und Kind erschweren. Der vor allem im englischen Schrifttum geführte Streit zwischen nature (angeboren) und nurture (erlernt) wird dargestellt, aber auch, der Unterschied zwischen einem echten und einem erzwungenen Lächeln. Das erstere kommt mit einem Muskel weniger aus! Das echte Lächeln zeigt, dass ein Baby glücklich ist. „Aber wenn Neugeborene lächeln, weil sie glücklich sind, lautet die nächste Frage: Was macht sie glücklich?“
Die kleinen Vergnügungen
Alle Primatenbabys mögen Süßes und ziehen Grimassen, wenn sie etwas Bitteres bekommen, wir Menschen also auch. Glück stellt sich auch ein beim Pinkeln oder einem „guten Schiss“. In diesem Kapitel werden Definitionen des Glücks von der Antike bis zur Gegenwart behandelt, auch von Aristoteles und Epikur. Am schlechtesten kommen Ökonomen und Philosophen weg: „Ökonomen und Philosophen machen viel Aufheben um Vergnügen und Lust, aber ich habe den Verdacht, dass das hauptsächlich widerspiegelt, wie langweilig es ist, ein Ökonom oder Philosoph zu sein.“
Freud hat nicht viel zu Kindern geschrieben, und er hielt das Lachen, wie das Kacken, für Triebabfuhr. Auch die Freudschülerinnen Anna Freud und vor allem Melanie Klein mit einem dystopischen Blick auf die Säuglingszeit werden als Anhängerinnen von Vorurteilen dargestellt.
Schlafen?
Hier wurde mir wieder der Unterschied zu den afrikanischen Dorfkindern deutlich: Säuglinge schlafen oder sie sind eben wach, aber an diesem Wachsein zur gefühlten Unzeit leiden hier die Eltern. Es werden viele Studien zum Träumen vorgestellt: „Die beiden Nutzen des Träumens scheinen Lernen und Glück zu sein“ und die meist sinnlosen Ratgeber zum Schlaftraining. Am besten nimmt man die Schlafgewohnheiten des Babys als Eltern mit Humor und „das Aufwachen als das, was es ist: eine abgeschlossene Schlafperiode.“
Die erste Berührung
Hier wird die von Descartes (ein ganz unglücklicher Eigenbrötler war das! Hatte nicht mal eine Frau!) postulierte Trennung zwischen Körper und Geist auseinandergenommen und zusammengefügt, was zusammengehört. Und für die Kleinen gilt: Massage ist Kommunikation, bevor es Sprache gibt.
Spielzeugfreuden
Spielen ist Lernen, es gibt eine Fülle von Studien nicht nur mit Tieren, auch mit Babys, in denen bewiesen wird, wie etwa das dreidimensionale Sehen, das Abschätzen von Entfernung oder die Tiefen von Abgründen durch andauernde Versuche erlernt werden. Gestaunt habe ich (und so ganz will ich es noch nicht glauben), dass es einen großen Unterschied gäbe zwischen dem passiven Sitzen und Ansehen einer Fernsehsendung und dem aktiven Nutzen eines Smartphones schon bei Kleinkindern.
Wir sehen, wie US-amerikanische Pädiater ihre Empfehlungen dazu in den letzten Jahren schrittweise geändert haben. Eine Studie TABLET (Toddler Attentional Behaviours and Learning with Touchscreens) zeigt, dass sie in allen Entwicklungsschritten gleichauf waren mit denen, die nicht mit Smartphones „lernen“ konnten, und dass sie über mehr Kompetenzen verfügten. Ganz allgemein gilt aber, wie für auch Ernährung oder Sport, es nicht zu übertreiben und Kinder dabei zu begleiten!
Überraschung
Warum spielen die kleinen so gerne Kuckuck und Verstecken? Addyman zieht Vergleiche zwischen der Neugier der Babys und der von Wissenschaftler/innen. Dann werden Wissenschaftstheorien vorgestellt.
Lache, und die Welt lacht mit dir
Bei den Navajos gibt es eine Party, wenn ein Baby zum ersten Mal gelacht hat, so als wäre das Baby nun Teil der menschlichen Gemeinschaft geworden. Zum besseren Verständnis der Rolle des Lachens bei Menschen sehen wir uns wieder die Unterschiede zu Primaten an: Unsere Augen haben mehr Weiß als Hintergrund, und das erleichtert den Blickkontakt. Wir machen keine Fellpflege, aber das Lachen ersetzt diese intensive Beziehungspflege. Am besten gefällt mir als Oma die wichtige Rolle der menschlichen Großmütter bei der Weitergabe von Kultur. Durch das jahrzehntelange Leben nach der eigenen Fortpflanzungsphase können wir uns um die Enkel kümmern. Primatinnen gebären bis zu ihrem Tode. Und wir lesen, dass Väter (oder Großväter) in unserer Geschichte kaum eine Rolle als Kulturübermittler spielen: sie sind ja auf der Jagd!
Der Klang des Glückes
Hier geht es um Musik und Tanz. Am besten sehen sie sich die Videos an, als Addyman mit Imogen Heap eine Oper komponiert und dann auch den Happy Song dazu. Auch hier beeindruckt die partizipative Forschungsweise, mit der Eltern als „Mitarbeiter“ gewonnen werden.
Fröhliches Geplauder
Zur Entwicklung der Sprache gibt es beeindruckende Studien, bei denen Schimpansen unter Laborbedingungen Sprache, auch als Gebärdensprache, beigebracht wurde. Ein für Addyman wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung Noam Chomskys mit den Behavouristen. Und er berichtet, was ihn, den Banker, veranlasst hatte, noch einmal mit dem Psychologiestudium anzufangen.
Ja, Nein, Maybe Baby
Bei der Sprachentwicklung gibt es, über die Kulturen hinaus, Muster. Das Wort „nein“ wird früher erlernt, vielleicht, weil die Babys es von ihren Eltern so oft gehört haben? Zum Trost für manche Eltern: während der Trotzphase entwickelt sich auch die Fähigkeit zur Empathie. In seiner Doktorarbeit ging es um die Fähigkeit der Babys, Unterschiede wahrzunehmen. Was für die 8 Monate alten eine leichte Übung ist, überfordert 4 Monate alte. Und wir erfahren, warum seine Arbeit von der angestrebten Zeitschrift nicht publiziert wurde, zum Glück dann aber in einer für Tierforscher …
Freunde
Babys werden geliebt und sie lieben es, andere zum Lachen zu bringen. Gemeinsames Lachen ist Grundlage für Freundschaften. In diesem Kapitel geht es um die Theory of mind, um Autismus als eine andere Form von Empathie zu zeigen. Babys sind hilfsbereit und haben Sinn für Gerechtigkeit. Wie haben wir Erwachsene unsere Freundschaften geschlossen? Das letzte Kapitel endet mit einem Schlusswort: „Freundschaft macht uns glücklich, und Glück bewirkt, dass wir bessere Freunde sind. Freunde sind für uns da, weil wir für sie da sind und das beginnt, sobald wir lächeln können.“
 Batman Death Metal – Band Edition 5 – Sepultura. Andreas Kisser (Gitarre), Derrick Green (Gesang), Paulo Xisto (Bass) und Eloy Casagrande (Schlagzeug) besser bekannt als Sepultura sind die Stars dieser Batman Death Metal Sonderedition, Band Edition 5 (Heft). Zeichner Greg Capullo und Autor Scott Snyder haben dieses Batman Abenteuer der brasilianischen Band aus Belo Horizonte gewidmet, die schon seit 1984 Thrash Metal machen, den sie mit Tribal Elementen zu einer explosiven Mischung verbinden.
Batman Death Metal – Band Edition 5 – Sepultura. Andreas Kisser (Gitarre), Derrick Green (Gesang), Paulo Xisto (Bass) und Eloy Casagrande (Schlagzeug) besser bekannt als Sepultura sind die Stars dieser Batman Death Metal Sonderedition, Band Edition 5 (Heft). Zeichner Greg Capullo und Autor Scott Snyder haben dieses Batman Abenteuer der brasilianischen Band aus Belo Horizonte gewidmet, die schon seit 1984 Thrash Metal machen, den sie mit Tribal Elementen zu einer explosiven Mischung verbinden.
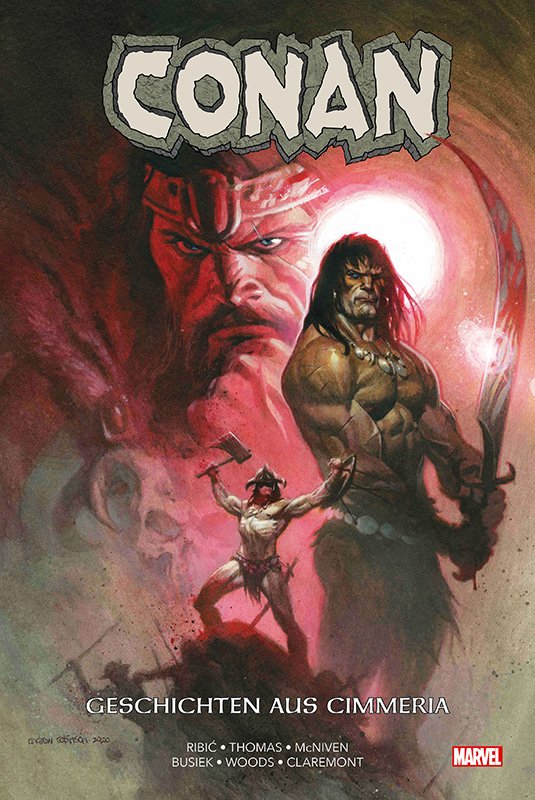
 Conan – Geschichten aus Cimmeria. Die Autoren Esad Ribic, Kurt Busiek, Roy Thomas und Zeichner Esad Ribic, Kevin Eastman sowie Steve McNiven legen mit „Conan – Geschichten aus Cimmeria“ verschiedene Neuinterpretationen zum steinzeitlichen Muskelhelden vor. Conan, selbst Cimmerier, ist schwarzhaarig und düsteren Blickes, stets das Schwert in der Hand. Er ist immer bereit zu plündern, morden, aber auch zu Melancholie und Heiterkeit. Mit Sandalen an den Füßen zertritt er so manchen Thron und macht sich auch bei Anarchisten zunehmend beliebter. Conan strotzt vor Gewalt und das übt eine gewisse Anziehungskraft aus. Aber auch das Gegenteil.
Conan – Geschichten aus Cimmeria. Die Autoren Esad Ribic, Kurt Busiek, Roy Thomas und Zeichner Esad Ribic, Kevin Eastman sowie Steve McNiven legen mit „Conan – Geschichten aus Cimmeria“ verschiedene Neuinterpretationen zum steinzeitlichen Muskelhelden vor. Conan, selbst Cimmerier, ist schwarzhaarig und düsteren Blickes, stets das Schwert in der Hand. Er ist immer bereit zu plündern, morden, aber auch zu Melancholie und Heiterkeit. Mit Sandalen an den Füßen zertritt er so manchen Thron und macht sich auch bei Anarchisten zunehmend beliebter. Conan strotzt vor Gewalt und das übt eine gewisse Anziehungskraft aus. Aber auch das Gegenteil. Mit Klamauk zur Aufklärung
Mit Klamauk zur Aufklärung
 Der Autor ist Psychologe und forscht zur neuronalen Entwicklung der Babys. Als Wissenschaftler kennt er die einschlägigen Publikationen der letzten Jahrzehnte und belegt seine Aussagen: Die Literaturliste bringt es auf über dreißig der knapp vierhundert Seiten. Es geht ihm nicht um die motorische Entwicklung, sondern um Gedanken und Gefühle der Babys, und: Warum lachen wir Menschen eigentlich? Manchmal erzählt er auch aus dem Nähkästchen, was Wissenschaftler voneinander halten. Laien bezieht er mithilfe des Internets in seine Forschung ein, manche Eltern erzählen von sich und ihren Gefühlen, die die Babys auslösen und geizen nicht mit Beiträgen über die Leistungen ihrer Kinder.
Der Autor ist Psychologe und forscht zur neuronalen Entwicklung der Babys. Als Wissenschaftler kennt er die einschlägigen Publikationen der letzten Jahrzehnte und belegt seine Aussagen: Die Literaturliste bringt es auf über dreißig der knapp vierhundert Seiten. Es geht ihm nicht um die motorische Entwicklung, sondern um Gedanken und Gefühle der Babys, und: Warum lachen wir Menschen eigentlich? Manchmal erzählt er auch aus dem Nähkästchen, was Wissenschaftler voneinander halten. Laien bezieht er mithilfe des Internets in seine Forschung ein, manche Eltern erzählen von sich und ihren Gefühlen, die die Babys auslösen und geizen nicht mit Beiträgen über die Leistungen ihrer Kinder.
 11. September 2001: 20 Jahre nach 9/11 („diese aus der US-Schreibweise des Datums zum Symbol geronnene Chiffre“) ist das Ereignis, das den Beginn des 21. Jahrhunderts markiert, tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, schreibt auch der Autor, seines Zeichens Amerikanist und Professor für Zeitgeschichte. In der Reihe „100 Seiten“ des Reclam-Verlages hat er eine bündige Lektüre verfasst, die sich mit allem um 911 beschäftigt, also sowohl der Vor- als auch der Nachgeschichte.
11. September 2001: 20 Jahre nach 9/11 („diese aus der US-Schreibweise des Datums zum Symbol geronnene Chiffre“) ist das Ereignis, das den Beginn des 21. Jahrhunderts markiert, tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, schreibt auch der Autor, seines Zeichens Amerikanist und Professor für Zeitgeschichte. In der Reihe „100 Seiten“ des Reclam-Verlages hat er eine bündige Lektüre verfasst, die sich mit allem um 911 beschäftigt, also sowohl der Vor- als auch der Nachgeschichte. Chancenungleichheit
Chancenungleichheit
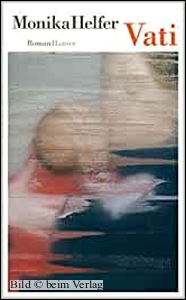 Im Osten nicht Neues
Im Osten nicht Neues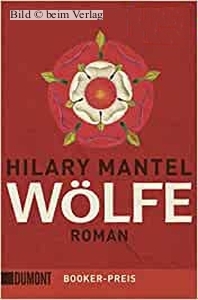 Stilistisch hochmodern
Stilistisch hochmodern
 Behindert ist man nicht, man wird dazu gemacht
Behindert ist man nicht, man wird dazu gemacht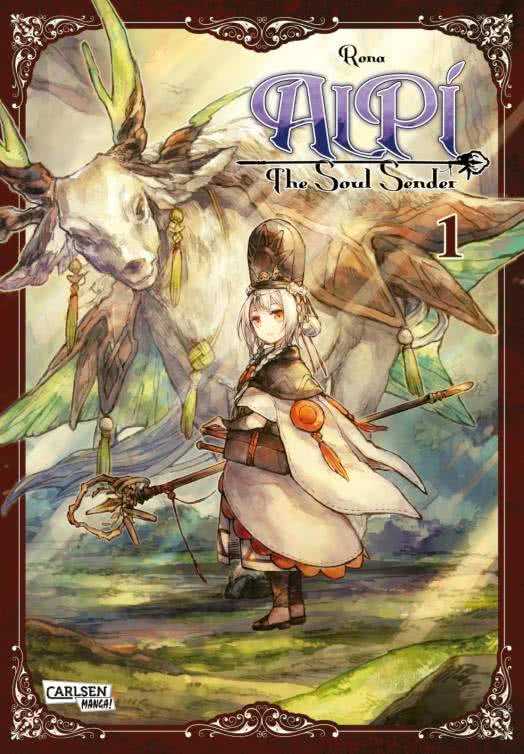 Vom Sterben der göttlichen Wesen
Vom Sterben der göttlichen Wesen