 Schläfenlocken und Dolce Vita
Schläfenlocken und Dolce Vita
Der zweite Roman von Lena Gorelik mit dem Titel «Hochzeit in Jerusalem» wurde für den Deutschen Buchpreis 2007 nominiert. Die vor allem als Journalistin tätige, in Leningrad geborene Autorin mit russisch-jüdischen Wurzeln knüpft mit diesem ebenfalls autobiografisch geprägten Werk an ihren erfolgreichen Debütroman an. Denn auch hier geht es wieder um die Frage, was Jüdischsein in Deutschland heute bedeutet. Es gelingt der Autorin, diesem nach wie vor konfliktreichen Thema auf humoristische Weise die Schärfe zu nehmen, ohne jedoch den bitterernsten Hintergrund damit zu verleugnen.
Die Ich-Erzählerin Anja Buchmann, deren Eltern als russische Juden nach Deutschland ausgewandert sind, ist als Kommunikations-Beraterin tätig. Mal wieder auf der Suche nach einem neuen Partner, lernt sie auf einer jüdischen Single-Internetseite Julian kennen, ein ökologisch orientierter, eher unscheinbarer Hippietyp. Er hat gerade erst erfahren, dass sein Vater Jude ist, wenn auch ein nicht praktizierender, und dass seine Großeltern im KZ ermordet wurden. Nun möchte er mehr darüber wissen und beginnt sich für das Judentum zu interessieren. Zunächst kommuniziert er per E-Mail mit Anja darüber, lernt sie, obwohl er ihr zuweilen auf die Nerven geht, schließlich auch persönlich kennen und begleitet sie sogar in eine Synagoge. Nach dem Studium religiöser Schriften überlegt er nämlich, ob er Jude werden will. Er erfährt aber vom Rabbiner, dass Jude nur ist, wer eine jüdische Mutter hat. Eine Konvertierung in diese Religion wäre zwar möglich, sei aber ein langer und dornenreicher Weg. Als Anja und die gesamte Familie überraschend zur Hochzeit einer entfernten Cousine nach Jerusalem eingeladen werden, nutzt Julian die Gelegenheit und fragt zaghaft, ob er sich anschließen dürfe. Anjas Mutter würde die beiden, bisher nur lose als Freunde verbundenen, mit knapp dreißig aber immer noch Ledigen, bei dieser Gelegenheit gerne verkuppeln, sie stimmt also begeistert zu.
Es gibt wohl kein Klischee russisch-jüdischen Alltagslebens, das in diesem heiteren Roman nicht bedient wird. Sei es die unbekümmerte Art, mit der mehr oder weniger religiös geprägte Juden trickreich allerlei Auswege finden, die strengen Regeln und Gebräuche ihrer Religion zu umgehen. Sei es die weitverbreitete Verachtung aller Palästinenser, die ausgelassene Feierwut und Fresslust jüdischer Familienfeste oder die Streiterei mit der nervtötenden Verwandtschaft im Kontrast zu der ungebremsten Überschwänglichkeit innerhalb der eigenen Sippe. Besonders lustig ist die Episode mit der Anreise zur titelgebenden Hochzeit, bei der Anja mit ihrer beklemmenden Flugangst kämpft, um dann im Bus in Jerusalem auch noch in jedem Araber einen Selbstmord-Attentäter zu vermuten. Unverkennbar ironisch wird auch das touristische Jerusalem geschildert, mit dem Gedrängel vor der Klagemauer und den in der Altstadt herumwuselnden, schwarz gekleideten Ultraorthodoxen mit ihren Schläfenlocken, in absurdem Kontrast stehend zum lockeren Strandleben in Tel Aviv und dem von Konsumgier geprägten Dolce Vita der säkularen Oberschicht.
Mit ihrem dialogreichen, lockeren Erzählstil umschifft die Autorin elegant und selbstironisch so manche Hürde der Banalität, sie schafft es sogar, aus der Freundschaft zwischen Anja und Julian keine kitschige Liebesgeschichte werden zu lassen. Zudem gibt sie auch allerlei, den Zionismus betreffende, politische und gesellschafts-kritische Denkanstöße. Oder sie persifliert beispielsweise genüsslich den Markenwahn auch in der israelischen Konsum-Gesellschaft. Im Epilog sitzt Anja dann wieder im Flugzeug und bekämpft ihre Angst, indem sie mit ihrem MP3-Player die dreitägige Aufzeichnung abhört, in der ihre schon sehr vergessliche Großmutter ihr Leben erzählt: «Geboren wurde ich in einem Schtetl, das weißt du ja. In Weißrussland war das, es war ein Schtetl, wahrscheinlich wie das in Kanada, wohin du fliegst. Warum eigentlich noch mal?» Amüsant also, – mehr aber auch nicht!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
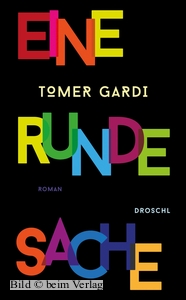 Absolut keine runde Sache
Absolut keine runde Sache Alles auf einem Blech
Alles auf einem Blech Hildegard Knef hatte mit Ende vierzig ihren „Bericht aus einem Leben“ herausgegeben. Dass ich ihn fünfzig Jahre später lesen wollte, liegt an Angela Merkels Wunsch, sich vom Bundeswehrorchester zum Abschied das Lied Für mich soll’s rote Rosen regnen, als Ständchen darbieten zu lassen. Ihre Lieder hatten mir schon lange gefallen, vor allem Von nun an ging’s bergab, nun weiß ich, dass es eine, in ihrem kodderigen Stil gefasste, Kurzbiografie darstellt …
Hildegard Knef hatte mit Ende vierzig ihren „Bericht aus einem Leben“ herausgegeben. Dass ich ihn fünfzig Jahre später lesen wollte, liegt an Angela Merkels Wunsch, sich vom Bundeswehrorchester zum Abschied das Lied Für mich soll’s rote Rosen regnen, als Ständchen darbieten zu lassen. Ihre Lieder hatten mir schon lange gefallen, vor allem Von nun an ging’s bergab, nun weiß ich, dass es eine, in ihrem kodderigen Stil gefasste, Kurzbiografie darstellt … Fataler Mix aus Rasse, Klasse und Geschlecht
Fataler Mix aus Rasse, Klasse und Geschlecht Hochaktuell
Hochaktuell Vielfältige nächtliche Aktivitäten
Vielfältige nächtliche Aktivitäten Peinlich
Peinlich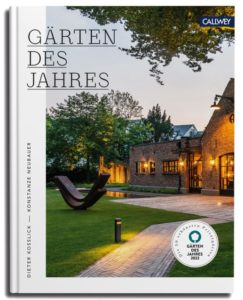 Gespannt war ich auf den Beitrag von Dieter Kosslick, dass er Gärten liebt, wusste ich. Ein wenig enttäuscht war ich, dass es nur eine Art Vorwort war. Geschrieben während des Wahlkampfes 2021, er erinnert daran, wie Kanzlerin Merkel eine Offensive für ökologischen Landbau ausrief und, verständlicherweise, die amtierende Landwirtschaftsministerin nicht dabeihaben wollte, oder wie Herr Lindner noch glaubte, den Profis die Klimakrise überlassen zu können.
Gespannt war ich auf den Beitrag von Dieter Kosslick, dass er Gärten liebt, wusste ich. Ein wenig enttäuscht war ich, dass es nur eine Art Vorwort war. Geschrieben während des Wahlkampfes 2021, er erinnert daran, wie Kanzlerin Merkel eine Offensive für ökologischen Landbau ausrief und, verständlicherweise, die amtierende Landwirtschaftsministerin nicht dabeihaben wollte, oder wie Herr Lindner noch glaubte, den Profis die Klimakrise überlassen zu können.
 Bunte Welt der Zauberei
Bunte Welt der Zauberei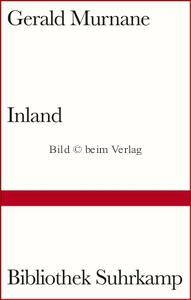 Unterschätzt
Unterschätzt

 Neuanfang in Schottland
Neuanfang in Schottland Mehr Realität als Fälschung
Mehr Realität als Fälschung