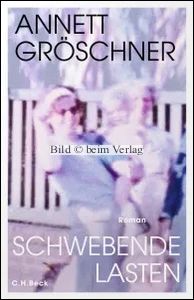 Spiegelbild eines Jahrhunderts
Spiegelbild eines Jahrhunderts
Mit dem seltsamen, aus dem Arbeitsschutz stammenden Begriff «Schwebende Lasten» hat die in Magdeburg geborene Schriftstellerin Annett Gröschner einen Roman betitelt, der am Beispiel ihrer Protagonistin ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte spiegelt. Hanna Krause, die Heldin dieses Romans, 1913 ebenda geboren und als 79Jährige nach dem Mauerfall gestorben, ist eine toughe Frau, deren Credo «anständig bleiben» sich wie ein roter Faden durch die gesamte Erzählung zieht. Sie hat als Blumenbinderin in der Weimarer Republik und Kranfahrerin in der DDR gearbeitet, sechs Kinder geboren und zwei davon frühzeitig verloren, ohne sie begraben zu können, «und starb rechtzeitig, bevor sie die Welt nicht mehr verstand», wie es im Klappentext heißt. Die Autorin setzt mit diesem für den deutschen Buchpreis 2025 nominierten Roman all denen ein Denkmal, die millionenfach Ähnliches erlebt haben, aber unsichtbar geblieben sind. Hanna ist eine, die das Leben nimmt wie es kommt, die sich partout nicht unterkriegen lässt, die ihren versoffenen und nach einem Arbeitsunfall beinamputierten Mann auch noch mit durchschleppt und doch immer auch das kleine Glück erlebt, das die geliebten Blumen für sie verkörpern, mit denen sie in intimen Momenten sogar auch spricht.
Zu den Berührungspunkten der Autorin mit ihrer Erzählung gehört neben Magdeburg, dem Ort der Handlung, auch das verwackelte Coverfoto. Es stammt aus einem Schmalfilm, wie sie im Interview erzählt hat, «den mein Vater gemacht hat, 1963 im Sommer. Und hier vorne, das ist meine Mutter, und in dieser Mutter bin ich». Man könnte den vorliegenden Roman als Pendant zu ihrem Debüt vor 25 Jahren bezeichnen: «Weil ich gedacht habe, ich finde die Konstellation in meiner Familie so interessant, dass der väterliche Teil in so eine industrielle Familie eingeheiratet hat und der mütterliche Teil proletarisch war – was eigentlich im Westen nie zusammen gegangen wäre – ich wollte es einfach erzählen». Bei gleicher Gelegenheit hat ihre Lektorin erklärt: «Sie ahnen nicht, wie entfernt der deutsche Osten wirkte – und zwar von Süddeutschland aus gesehen, von Düsseldorf und von Hamburg aus gesehen». Insoweit ist dieser Roman eine Art Reiseführer durch den Osten Deutschlands, durch eine inzwischen vergangene Welt. Obwohl Hanna zwei Weltkriege erlebt und zwei Diktaturen über sich ergehen lässt, ist sie nie politisch, der Inbegriff eines freien Menschen, der sich trotz allen Widrigkeiten immer beherzt durchs Leben schlägt.
Im Roman ist jedem der 25 Kapitel die Kurzbeschreibung einer Pflanze voran gestellt. Eines Tages verirrt sich im Jahre 1938 ein sehr gut angezogener Mann, der ganz offensichtlich nicht hier wohnt, in ihren kleinen Blumenladen im prekärsten Viertel Magdeburgs. Er zeigt Hanna das Bild eines Gemäldes von Ambrosius Boschaert mit dem Titel «Blumenvase in einer Fensternische» und erteilt ihr den Auftrag, original diesen Blumenstrauß für ihn anzufertigen. Als Vorschuss zahlt er einen großzügig bemessenen Betrag im Voraus, obwohl sie ihn darauf hinweist, dass viele dieser Blumen zu ganz unterschiedliche Zeiten blühen, dieses Stillleben also weitgehend irreal sein dürfte, – er meldet sich dann auch nie wieder bei ihr. Jahrzehnte später fahren ihre Töchter extra mit ihrer alten Mutter nach Holland in das Mauritshuis, in dem dieses Gemälde, das sich in ihrem Kopf regelrecht eingebrannt hat, ausgestellt ist. Und noch später, am Ende des Romans, gelingt es ihr dann sogar, bis auf eine Blume alle gleichzeitig zu bekommen, die modernen Treibhäuser und Transportmittel machen es nach mehr als fünfzig Jahren nun doch möglich, – eine ebenso raffinierte wie anrührende narrative Klammer!
Stilistisch unprätentiös und chronologisch voranschreitend ist dieser Roman einer tapferen Frau in einer angenehm lesbaren Sprache geschrieben. Der kreative Plot wird älteren Lesern in vielen Details bekannt vorkommen, auch und weil die dezenten Seitenhiebe auf Nazi-Diktatur und DDR-Misere überhaupt nicht aufgesetzt wirken und auch Feminismus absolut keine Rolle spielt. Ein gelungener und bereichernder Roman also mit einer überaus sympathischen Alltags-Heldin!
Fazit: erfreulich
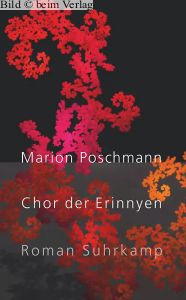 Fanal einer Autistin
Fanal einer Autistin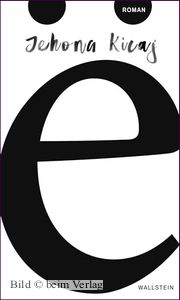 Literarisches Kosovo-Tribunal
Literarisches Kosovo-Tribunal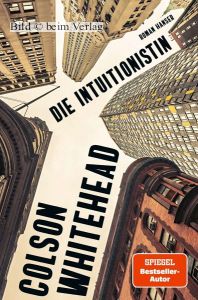 Eher wieder ein Flop
Eher wieder ein Flop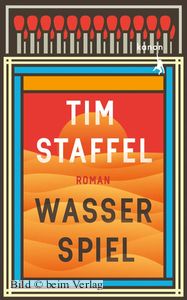 Dystopischer Klima-Roman
Dystopischer Klima-Roman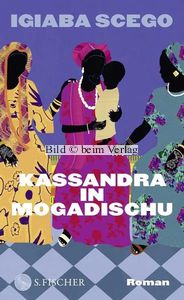 Vom Jirro in der Diaspora
Vom Jirro in der Diaspora 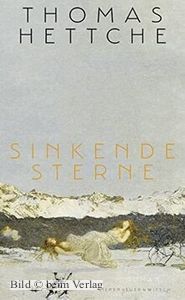 Wirkmächtigkeit von Literatur
Wirkmächtigkeit von Literatur Feministisches Märchen
Feministisches Märchen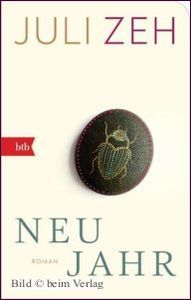 Fiasko der Selbstüberforderung
Fiasko der Selbstüberforderung Coming-of-Age-Geschichte voller Rätsel
Coming-of-Age-Geschichte voller Rätsel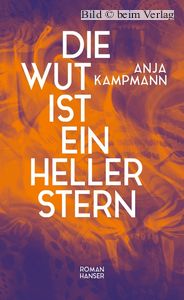 Weder bereichernd noch unterhaltend
Weder bereichernd noch unterhaltend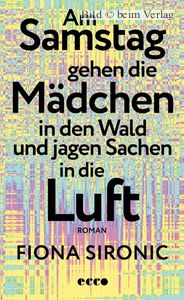 Eine Dystopie mit Wumms
Eine Dystopie mit Wumms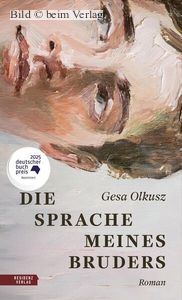 Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit
Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit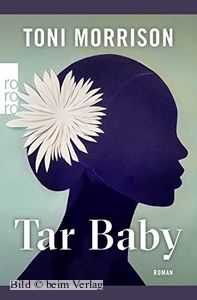 Auf der Suche nach Identität
Auf der Suche nach Identität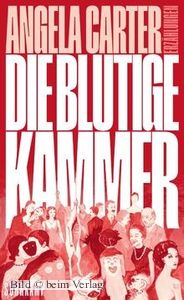 Gruselige Täter-Opfer-Umkehr
Gruselige Täter-Opfer-Umkehr