 Vergegenwärtigung des Vergangenen
Vergegenwärtigung des Vergangenen
Nach vier Jahren ist mit «Tyll» wieder ein Roman von Daniel Kehlmann erschienen, der das Zeug dazu hat, an den großen Erfolg seines Bestsellers «Die Vermessung der Welt» anzuknüpfen, und auch hier wird Realität und Fiktion zu einer unterhaltsamen Geschichte verknüpft. Der Trick dabei, die Eulenspiegelei also, ist eine lässliche Schummelei des Autors: Die legendäre Figur tauchte erstmals gegen Ende des Mittelalters auf, der Roman hingegen weist dem berühmten Schelm gut hundert Jahre später eine Rolle mitten im Dreißigjährigen Krieg zu. Und um den geht es letztendlich auch in diesem historischen Roman.
Kehlmann erzählt seine Geschichte in acht Episoden, beginnend mit einem bösen Streich, bei dem Tyll Ulenspiegel den einfältigen, bisher vom Krieg noch verschonten Bewohnern einer Stadt als Schauspieler, Seiltänzer und Bauchredner das Geld aus den Taschen zieht und die euphorisierte Menge am Ende zu einem kollektiven Schuhwerfen anstiftet. Lachend über das damit angerichtete Chaos zieht der notorische Spötter mit seinem Eselskarren und den zwei Begleiterinnen weiter. Tyll stammt aus einer Müllerfamilie, erfahren wir in der Rückblende des nächsten Kapitels, sein autodidaktisch gelehrter Vater beschäftigt sich mit allerlei Zauber, mit Astrologie und Experimenten, bis er als Hexer denunziert und von einem melancholischen Henker «einfühlsam» zu Tode gebracht wird. Als junger Bengel flüchtet der heimatlos gewordene Tyll daraufhin mit der Bäckertochter Nele in die Welt hinaus, in ein durch den barbarischen Krieg verheertes Land. Sie treffen auf den bösartigen Gaukler Pirmin, der sie mitnimmt und ihnen zwar vieles beibringt, sie aber auch sehr schlecht behandelt, – bis Nele ihm schließlich ein finales Pilzgericht kocht: Einige Hände voll Pfifferlinge, gemischt mit etwas Fliegenpilz und Knollenblätterpilz. Jeden der Giftpilze allein kann man herausschmecken, weiß Nele, mit beiden zusammen aber verliert sich der verräterische Beigeschmack völlig.
Die Figur des Tyll bildet eine lose Klammer um das Geschehen im Roman, das sich kapitelweise allmählich von den Bedrängnissen der kleinen Leute hin zu den oft nicht weniger gebeutelten Majestäten entwickelt. In kürzeren und längeren Episoden wird da beispielsweise von der Schlacht von Zusmarshausen berichtet, ein in seiner Brutalität heute kaum noch vorstellbares Gemetzel, oder von den Prager «Winterkönigen», Friedrich V mit seiner schönen Gemahlin Liz, Elisabeth Stuart, Enkelin der berühmten Maria. Die tragische Geschichte dieses böhmischen Königs wird als einer der Auslöser des verheerenden Glaubenskrieges angesehen. Aber auch der faszinierenden Person des berühmten Jesuiten und Universalgelehrten Athanasius Kircher ist zum Beispiel ein Kapitel gewidmet. Als, Jahrzehnte später, im letzten Kapitel, die inzwischen verwitwete und völlig verarmte Liz, die unbeirrt weiterhin kurfürstliche Rechte für ihren Sohn geltend macht, aus ihrem Exil nach Westfalen reist, zu den Friedensverhandlungen, trifft sie dort auf Tyll, Hofnarr des Kaisers. Sie bietet ihm an, mit ihr nach England zu kommen, «Um der alten Zeiten willen», wie sie sagt. «Du weißt so gut wie ich, dass der Kaiser sich früher oder später über dich ärgert. Dann bist du wieder auf der Straße. Du hast es besser bei mir.» Er erwidert: «Aber weißt du, was besser ist? Noch besser als friedlich sterben?» «Sag es mir.» «Nicht sterben, kleine Liz. Das ist viel besser.» Dem Autor gelingt hier ein versöhnliches Ende ohne jeden Kitsch, Chapeau!
Zur Unsterblichkeit dieser legendären Figur dürfte Kehlmann seinerseits einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten mit seinem kreativ erdachten und grandios erzählten Roman, der ebenso unterhaltsam ist wie bereichernd, sein bester bisher. Eine gelungene Vergegenwärtigung des Vergangenen, sprachlich brillant, herrlich leichtfüßig erzählt, dabei – gottlob – jedwedes Zeitidiom meidend, mit feiner Ironie angereichert zudem, – eine unbedingt empfehlenswerte Lektüre!
Fazir: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
 Für den idealen Leser
Für den idealen Leser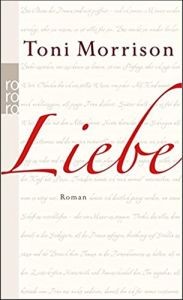 Liebe, Gier, Hass – eine Melange
Liebe, Gier, Hass – eine Melange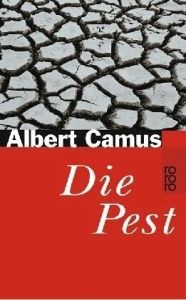 Zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages
Zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages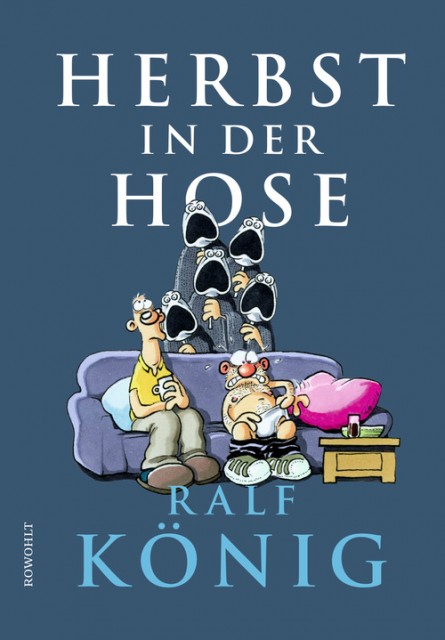
 Neues von der Spottdrossel
Neues von der Spottdrossel Big Apple als Protagonist
Big Apple als Protagonist Vergänglichkeit war noch nie ein vergnügliches Thema
Vergänglichkeit war noch nie ein vergnügliches Thema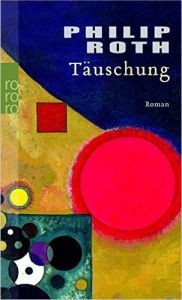 Postkoitales Verwirrspiel
Postkoitales Verwirrspiel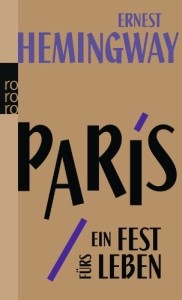 Ein Amerikaner in Paris
Ein Amerikaner in Paris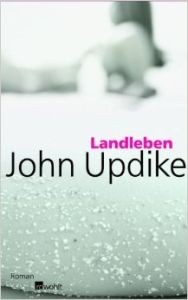 Ein inhomogener Mix
Ein inhomogener Mix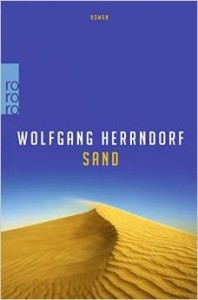 Sie dürfen Watson zu mir sagen
Sie dürfen Watson zu mir sagen Read it four times
Read it four times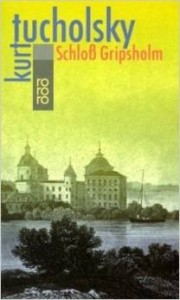 Ich dichte erst ab 12 %
Ich dichte erst ab 12 % Ein literarisches Enschede
Ein literarisches Enschede