 Märkische Behaglichkeit am Niederrhein
Märkische Behaglichkeit am Niederrhein
Im Titel «Dorfroman» hat Christoph Peters die Genrebezeichnung seines neuen Buches bereits benannt, Handlungsort ist nämlich ein kleines Dorf am Niederrhein, nähe Kalkar. Und mit dem Ort wird auch gleich die Thematik deutlich, es geht um den Schnellen Brüter, jenen neuen Kernreaktortyp, der in den 70er Jahren an diesem Standort gebaut wurde. Und wie an den anderen Brennpunkten im Kampf gegen die Atomlobby, so entsteht auch in der kleinen Ortschaft ein improvisiertes Lager streitbarer Atomkraftgegner, direkt gegenüber dem Bauplatz des Atommeilers, auf der anderen Rheinseite.
Der in Berlin lebende Ich-Erzähler besucht seine Eltern in Hülkendonck, dem Ort seiner Kindheit, beide sind schon lange im Ruhestand. Bereits bei der Anfahrt mit dem Auto werden beim Anblick vieler vertrauter Plätze manche Erinnerungen wieder in ihm wach. Vieles hat sich zwar verändert, seit er vor dreißig Jahren dieses Kaff verlassen hat, aber manches ist ihm immer noch wohl vertraut. In seinem ehemaligen Kinderzimmer stößt er dann auf all die Dinge, die dort noch immer für ihn aufbewahrt werden, und mit jedem einzelnen verbinden sich irgendwelche Geschichten aus seinem Leben damals. Sein Vater war Meister in einem Betrieb für Landmaschinen, ist in dem bäuerlich geprägten Dorf geboren und kennt fast jeden. Die Mutter stammte aus der Stadt, als Lehrerin aber ist sie hier schon bald ebenfalls eng verwurzelt. Der geplante Bau des Reaktors spaltet die Dorfgemeinschaft nun in zwei Lager. Der Vater des Ich-Erzählers gehört als Kirchenvorstand, anders als seine Kollegen dort, entschieden zu den Reaktor-Befürwortern. Durch ihren Beschluss, das der Kirche gehörende Baugelände nicht zu verkaufen, blockiert eine deutliche Mehrheit im Kirchenvorstand aber den Verkauf, die Auseinandersetzungen im Dorf eskalieren. Die meisten versprechen sich neue Arbeitsplätze, und die Kirchenoberen freuen sich schon auf das viele Geld, mit dem dann auch die uralte Kirche saniert werden könnte.
Der Roman schildert sehr anschaulich das behütete Leben des Helden, das familiäre Zusammenleben, die Nachbarn, Freunde und all die Bauern, die das Dorfleben prägen. Es ist die Zeit des Wirtschaftswunders mit ihrer spießigen Nierentisch-Romantik. Eine geistige Ödnis, zu der vor allem auch ein naiver Katholizismus beiträgt, von dem er sich aber in der Pubertät allmählich immer mehr abwendet. Entscheidend ist dabei Juliane, eine sechs Jahre ältere Aktivistin aus dem benachbarten Protestcamp, in die er sich als fast Sechzehnjähriger unsterblich verliebt hat und mit der er schließlich auch seine Initiation erlebt. Als Schmetterlings-Sammler mit dem schwärmerischen Berufswunsch ‹Tierschützer› á la Grzimek oder Sielmann entwickelt er sich unter Julianes Einfluss zum Atomkraftgegner. Seinem drögen Leben in dörflicher Idylle wird im Roman mit dem ‹Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll› der skurrilen Typen des Protestcamps ziemlich brutal ein alternativer Lebensentwurf gegenüber gestellt. Der Roman lebt vor allem von diesem extremen Spannungsfeld.
Mit seiner ruhigen Erzählweise erinnert der Autor ein wenig an Fontane, anschaulich schildert er das ländliche Milieu einer wohlversorgten Familie aus dem Mittelstand und die Sitten und Gebräuche am Niederrhein. Die Sprache ist der kindlichen Perspektive seines jugendlichen Helden stimmig angepasst, wobei vor allem dessen naive Naturliebe, die ja in krassem Widerspruch steht zum ökologischen Wahnsinn des Atomreaktors, in wunderbaren Naturbeschreibungen zum Ausdruck kommt. Nicht ganz verständlich ist, warum im Roman von Calcar geredet wird, obwohl die kleine Stadt seit 1936 offiziell Kalkar heißt. Und dass der Heranwachsende mit seiner promiskuitiven Geliebten sich selbst unverändert als Kind bezeichnet ist ebenfalls fragwürdig. Von den Figuren wirkt besonders der Vater als ein stimmig beschriebener, kantiger Charakter fontanescher Prägung überaus sympathisch, märkische Behaglichkeit also auch am Niederrhein!
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de


 Esoterischer Kosmos
Esoterischer Kosmos
 Leserherz, was willst du mehr?
Leserherz, was willst du mehr? Wenn ihr so weitermacht
Wenn ihr so weitermacht
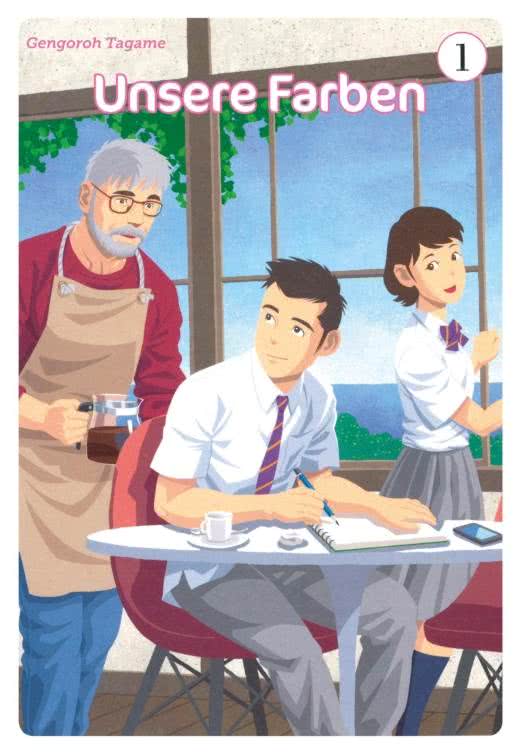



 Ironisches Requiem
Ironisches Requiem
 Selbstverteidigung – Eine Philosophie der Gewalt. In ihrem Prolog zum Buch stellt die Philosophie-Professorin eine Foltermethode des beginnenden 19. Jahrhunderts den Geschehnissen um die Ermordung von Rodney King durch das LAPD im 20. Jahrhundert gegenüber. In beiden Fällen galt, dass je mehr sich der „Delinquent“ wehrte, desto mehr wurde er geschlagen oder gefoltert. Der Prozess um die Polizisten endete mit einem Freispruch. Rodney King hatte sich verteidigt, doch indem er sich verteidigte, wurde er unverteidigbar. Der Inhalt des Zeugen-Videos wurde in seiner Bedeutung einfach umgedreht. Schuldumkehr.
Selbstverteidigung – Eine Philosophie der Gewalt. In ihrem Prolog zum Buch stellt die Philosophie-Professorin eine Foltermethode des beginnenden 19. Jahrhunderts den Geschehnissen um die Ermordung von Rodney King durch das LAPD im 20. Jahrhundert gegenüber. In beiden Fällen galt, dass je mehr sich der „Delinquent“ wehrte, desto mehr wurde er geschlagen oder gefoltert. Der Prozess um die Polizisten endete mit einem Freispruch. Rodney King hatte sich verteidigt, doch indem er sich verteidigte, wurde er unverteidigbar. Der Inhalt des Zeugen-Videos wurde in seiner Bedeutung einfach umgedreht. Schuldumkehr.