Mao – der Trump der Kommunisten?
Neulich hat mich Mao angelächelt. Auf einem Buch, das an einen Zaun gelehnt zum Mitnehmen stand. Das passiert im Viertel hier häufig, dass Menschen die Bücher nicht wegwerfen, sondern zum Mitnehmen vors Haus stellen.
Ich habe Mao mitgenommen. Über Stalin wusste ich schon immer viel, die Begeisterung der Marxisten-Leninisten für ihn in den Siebzigern habe ich nie geteilt.
Aber Mao, der schien nicht so schlimm zu sein. Selbst viele Konservative fanden ihn toll.
Und für uns Jugendliche klang Kulturrevolution so verführerisch. Wir haben sie 1968 und später geliebt. Aufstehen gegen eingerostete Kultur, eingerostete Institutionen, Bürokraten. Nicht nur ich, auch viele andere junge Leute haben daran geglaubt.
Das Mao-Buch allerdings erzählt eine Geschichte darüber, die ich so nicht kannte.
Die Kulturrevolution war eine geschickte Intrige Maos. 1958-61 hatte er den großen Sprung nach vorne ausgerufen, überall brannten kleine Hochöfen und sämtliche nützlichen Dinge aus Eisen wanderten dort hinein. Den Bauern wurden die Lebensmittel abgepresst, die Mao ins Ausland verkaufte, um Geld für seinen Traum, die chinesischen Atombombe, zu bekommen. Er glaubte wirklich, dass China mit dem Eisen aus Mini-Hochöfen zur Großmacht werden würde.
1962 wagten dann doch einige Funktionäre den Aufstand. Erstmals kam zur Sprache, dass Millionen beim großen Sprung verhungert waren. Dass Maos Vorstellung, man müsse nur viel Stahl erzeugen, um zur Weltmacht zu werden und die USA zu überholen, ein gigantischer Schwindel war. Mao musste klein beigeben und den großen Sprung abblasen. Natürlich schob er anderen die Schuld in die Schuhe, den örtlichen Funktionären, der Sowjetunion und den Planungskommissionen. Nur einer war unschuldig; der Erfinder des großen Sprungs vorwärts, der Schrott produzierte und Millionen verhungern ließ:
Gott vergibt. Mao niemals. Liu chao Shi, der zweite Mann in der KP Chinas, hatte ihm widersprochen. Und mit ihm viele andere Funktionäre. Widerspruch vertrug Mao nicht und vergaß ihn nie.
So rief er die Kulturrevolution aus. Die Jugend sollte gegen die Bürokraten und die alte Kultur aufstehen. Sie tat es gerne, die Bürokratie war verhasst. Wie immer delegierte Mao die Aufgabe, diesmal an seine Frau Jiang Qin und an seinen Verteidigungsminister Lin Biao. Liu chao Shi wurde gedemütigt und in Isolationshaft genommen. Zahlreiche Funktionäre wurden durch die roten Garden gefoltert, getötet oder, wenn sie Glück hatten, nur öffentlich gedemütigt und zu »Selbstkritik« gezwungen.
Mao legte Quoten fest, die vorgaben, wie viele in jedem Bezirk verhaftet, wie viele ermordet werden mussten. Wer zu wenige erschoss, war ganz sicher ein Rechtsabweichler und musste ebenfalls verfolgt werden.
Das Ganze war nicht neu. Wie Stalin benutzte Mao andere Menschen und ließ sie beseitigen oder ins Arbeitslager schaffen. Die Taktik hatte er bereits seit der Gründung des ersten kommunistischen Staats 1931 in einer chinesischen Provinz angewandt. Um seinen Traum vom »neuen Menschen« zu verwirklichen, der allen Egoismus fahren ließ, nur für das Kollektiv lebte, immer die gleiche Meinung wie alle vertrat und sich auch gleich wie alle anderen kleidete. Wie Ché Guevara hasste Mao Individualismus.
Und wie viele Puritaner predigte er Wasser und trank Wein. Er selbst hungerte nie. Den Chinesen waren Bücher verboten, außer der roten Mao-Bibel. Mao wollte die Kultur nicht revolutionieren, er wollte sie »ermorden«. Unnützes Zeug, das die Menschen von der gesellschaftlich nützlichen Arbeit abhielt.
Er selbst besaß ein eigens konstruiertes Bett, damit die vielen Bücher, die er dort stapelte, nicht in der Nacht auf ihn fielen.
Jung Chang und Jon Halliday schildern Mao ausführlich mit zahlreichen Quellenangaben in »Mao – das Leben eines Mannes, das Schicksal eines Volkes«. Ein trauriges, aber notwendiges Buch, das den Aufstieg eines Intriganten schildert, der die Welt beherrschen wollte, jeden Widerspruch brutal unterdrückte und die Chinesen hungern ließ.
Das Buch zeichnet Maos Weg gut nach, leider verliert es einiges dabei aus den Augen. Anfang der Zwanziger hatte die KP Chinas knapp über vierzig Mitglieder, Anfang der Dreißiger konnte sie ihren ersten kommunistischen Staat in China gründen, Ende der Vierziger beherrschte sie das chinesische Festland.
Mao beherrschte die KP. Der Frage, warum so viele ihm nachgelaufen sind, geht das Buch leider nicht nach. Und auch nicht der Frage, warum das Konzept der leninistischen Partei, der »Führung der Arbeiterklasse«, nicht nur Mao und Stalin, sondern auch massenhaft weitere Bürokraten, Intriganten und Opportunisten hervorbrachte.
Auch in anderen Gesellschaften wimmelt es von Opportunisten und Intriganten in der Politik. Mit Trump haben wir gerade ein eindrückliches Beispiel erlebt. Genau wie Mao vertrug er keinerlei Widerspruch, glaubte, alles besser zu wissen als die Fachleute, schlug jeden Ratschlag in den Wind und entließ jeden, der ihm auch nur ein bisschen widersprach.
Aber die USA hatten seit langem Gewaltenteilung und Meinungsfreiheit, die selbst ein Trump nicht abschaffen konnte, obwohl er es immer wieder versucht hat. Lenin hat beides bei seinem Revolutionskonzept völlig außer Acht gelassen. Die Rechnung wurde bald präsentiert, als Stalin an die Macht kam. Und später bei Mao wiederholte es sich. Kein unabhängiges Gericht konnte ihnen auf die Finger klopfen, keine freie Presse die gefälschten Erfolgszahlen anprangern, die Hungersnot und die Morde der Geheimpolizei aufdecken.
Das Buch hat mich traurig gestimmt, ich konnte es nur nach und nach lesen, weil es mich an meinen Idealismus und den zahlreicher Anderer erinnert hat. Und die Frage aufwirft, warum so viele Intellektuelle diesem Kriminellen nachgelaufen sind, überall sein Loblied sangen und jeden verteufelten, der ihnen widersprach. Schon damals gab es eine Cancel-Culture, die unbequeme Wahrheiten lieber unter der Decke halten wollte.

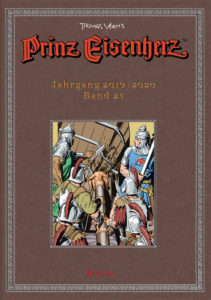 Prinz Eisenherz Yeates-Jahre Band 25: Im 25. Band der Nachfolgezeichner Hal Fosters zeichnet Thomas Yeates für Text und Zeichnungen verantwortlich. Er hat nicht nur Aleta, der Frau von Prinz Eisenherz, Zauberkräfte verliehen, sondern ihr auch zwei Raben zur Seite gestellt, die ihr manche Schwierigkeit abnehmen. In vorliegendem Abenteuer ist auch Prinz aus Thule froh, dass er eine Gefährtin gefunden, die so gut zu ihm passt. Und ihm auch noch drei Söhne und die Zwillingstöchter geschenkt hat.
Prinz Eisenherz Yeates-Jahre Band 25: Im 25. Band der Nachfolgezeichner Hal Fosters zeichnet Thomas Yeates für Text und Zeichnungen verantwortlich. Er hat nicht nur Aleta, der Frau von Prinz Eisenherz, Zauberkräfte verliehen, sondern ihr auch zwei Raben zur Seite gestellt, die ihr manche Schwierigkeit abnehmen. In vorliegendem Abenteuer ist auch Prinz aus Thule froh, dass er eine Gefährtin gefunden, die so gut zu ihm passt. Und ihm auch noch drei Söhne und die Zwillingstöchter geschenkt hat. Über die Ekelgrenze hinaus
Über die Ekelgrenze hinaus Hören versus Schwerhörigkeit
Hören versus Schwerhörigkeit
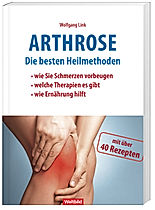
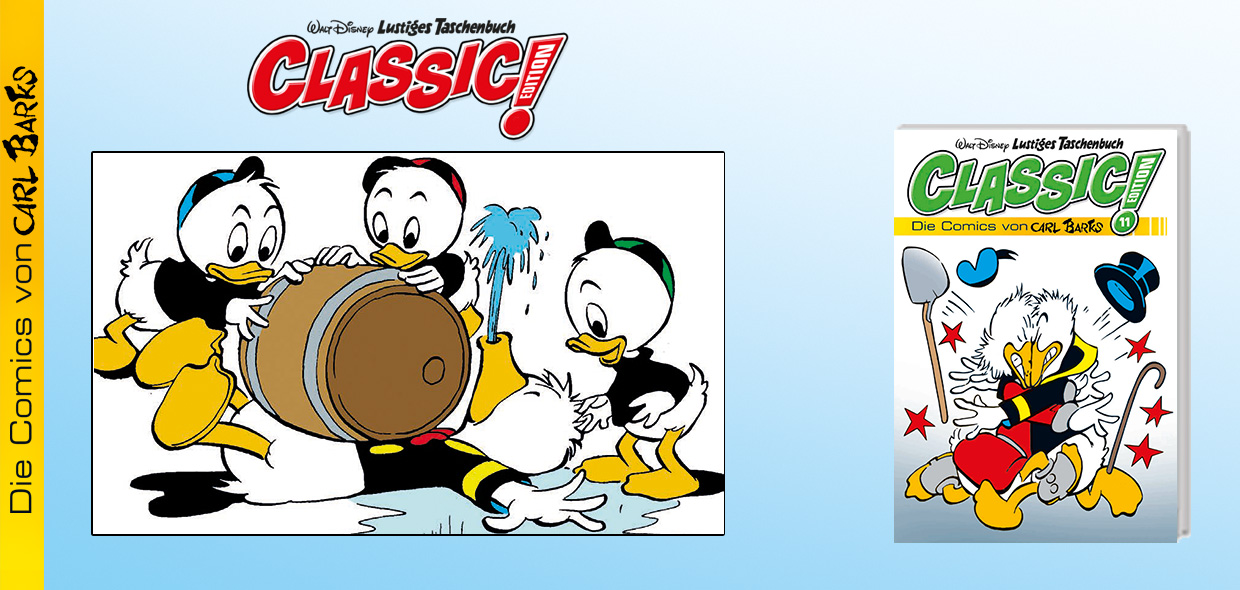

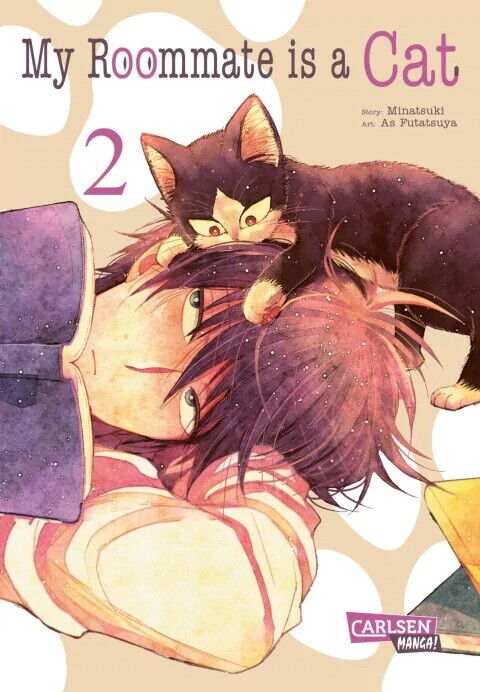

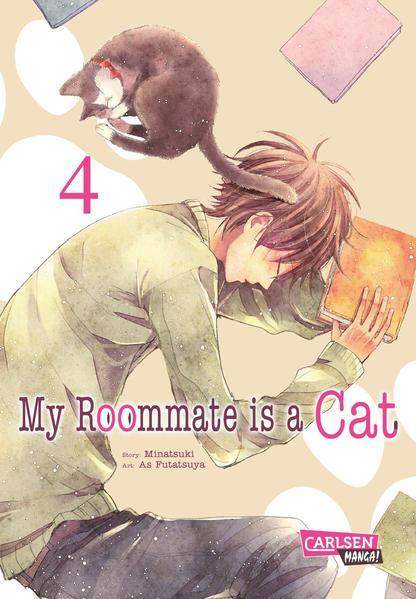
 Einen Wondrak für alle Lebenslagen: Mit 88 Jahren verkündete Janosch in der deutschen Wochenzeitschrift ZEIT, dass er keine Wondraks mehr publizieren werde. Über 350 Wondrak-Zeichnungen waren bis dahin schon erschienen. Über 300 Bücher hatte Janosch zeit seines Lebens publiziert, viele seiner Geschichten waren in 40 Sprachen übersetzt worden. Mit „Wondrak für alle Lebenslagen“ kann man nochmals zurückblicken und sich erinnern. Der Reclam Verlag macht’s möglich.
Einen Wondrak für alle Lebenslagen: Mit 88 Jahren verkündete Janosch in der deutschen Wochenzeitschrift ZEIT, dass er keine Wondraks mehr publizieren werde. Über 350 Wondrak-Zeichnungen waren bis dahin schon erschienen. Über 300 Bücher hatte Janosch zeit seines Lebens publiziert, viele seiner Geschichten waren in 40 Sprachen übersetzt worden. Mit „Wondrak für alle Lebenslagen“ kann man nochmals zurückblicken und sich erinnern. Der Reclam Verlag macht’s möglich.
 Randschaften. Auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit: Wien vor 40 Jahren. In den Achtzigern. Die Stadt war damals grau und verlassen und eine Menge Seniorinnen mit ihren Hunden bevölkerten die ansonsten leeren Straßenbahnen. Meist trugen sie Pelzmäntel und waren grantig. Der typische Wiener Grant, den es damals auch noch an den Häuserfassaden gab. Ein nostalgischer Rückblick „auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit“ anhand von Fotografien und kurzen Texten zeigt in vorliegender Publikation, dass der goldene Westen auch einmal grau war. Dafür aber voller Charme.
Randschaften. Auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit: Wien vor 40 Jahren. In den Achtzigern. Die Stadt war damals grau und verlassen und eine Menge Seniorinnen mit ihren Hunden bevölkerten die ansonsten leeren Straßenbahnen. Meist trugen sie Pelzmäntel und waren grantig. Der typische Wiener Grant, den es damals auch noch an den Häuserfassaden gab. Ein nostalgischer Rückblick „auf der Suche nach dem Wien unserer Kindheit“ anhand von Fotografien und kurzen Texten zeigt in vorliegender Publikation, dass der goldene Westen auch einmal grau war. Dafür aber voller Charme. Vom Ende der Geduld
Vom Ende der Geduld Fanal der Selbstbehauptung
Fanal der Selbstbehauptung
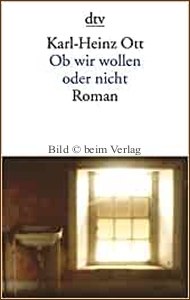 Alles eine Frage der Sprache
Alles eine Frage der Sprache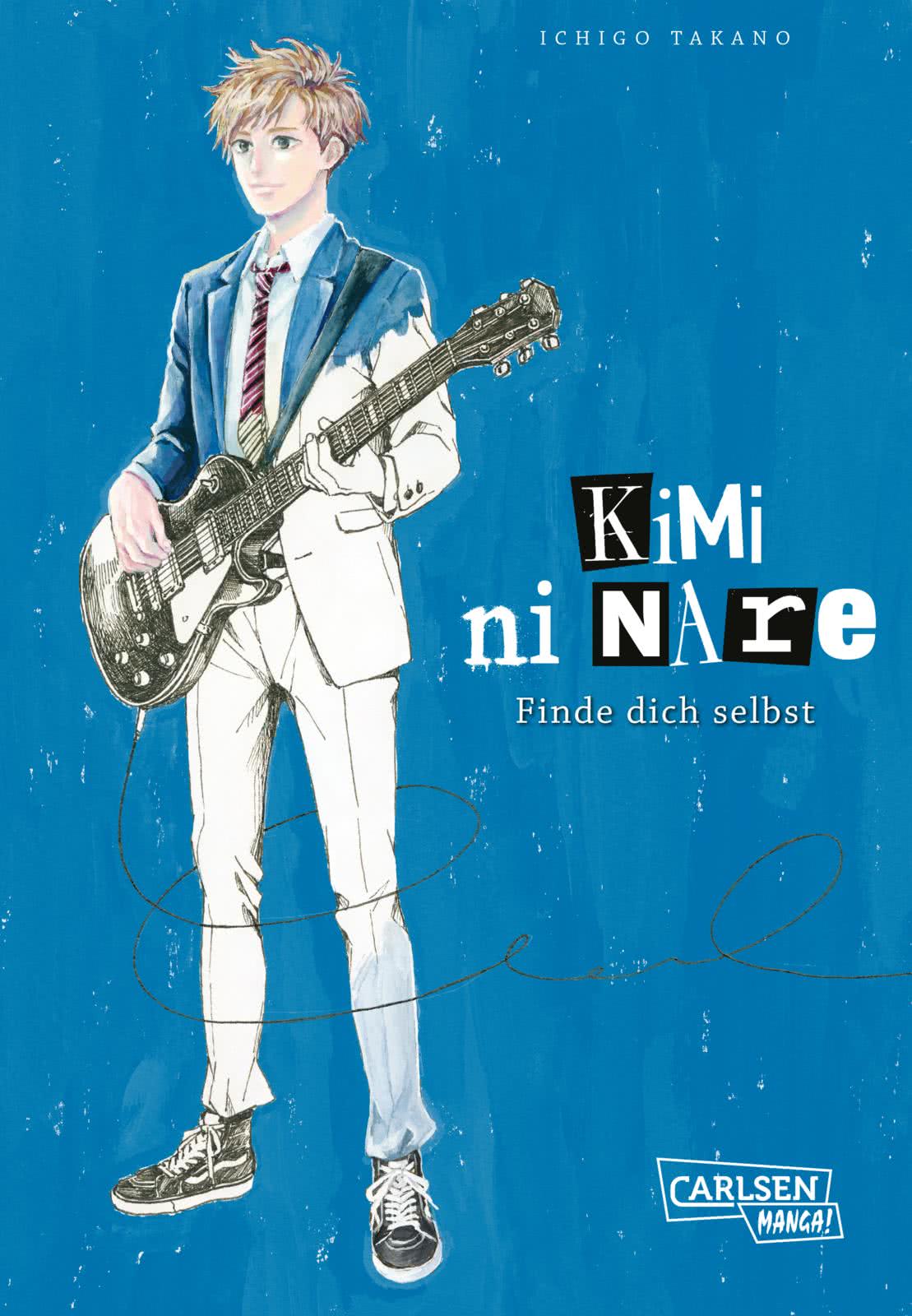 Finde dich selbst
Finde dich selbst