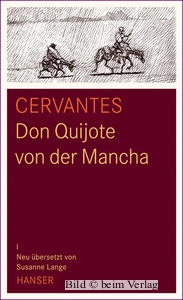 Das Buch für die Insel
Das Buch für die Insel
«Don Quijote» von Miguel de Cervantes gilt als der erste moderne Roman, das 1605 und 1615 erschienene, zweiteilige Werk ist mit bisher über 500 Millionen Auflage aber auch der mit Abstand meistverkaufte Roman aller Zeiten. Er wurde zudem 2002 bei einer vom Nobelinstitut in Stockholm veranstalteten Umfrage unter hundert berühmten und anerkannten Schriftstellern aus der ganzen Welt als bester jemals geschriebener Roman gekürt. Mit seinem Kampf gegen die Windmühlen ist der Ritter von der traurigen Gestalt auch Urheber geworden für das vielzitierte Sprichwort über die vergeblichen Mühen des Bürgers im Umgang mit bräsigen Bürokraten.
Die «Vorrede» des Autors beginnt mit dem Satz: «Unbeschwerter Leser, auch ohne Eid darfst du mir glauben, wie sehr ich mir wünschte, dies Buch, dies Kind meines Geistes wäre das schönste, stolzeste und klügste, das man sich nur denken kann». Im Dialog mit einem Freund teilt der spanische Autor dort voller Spott dann auch jede Menge Seitenhiebe gegen das damals in höchster Blüte stehende Genre der kitschigen Ritterromane aus. Es wird deutlich, dass der «Don Quijote» als Parodie dieser seinerzeit so beliebten Literatur gedacht ist. Reine Satire also, und nicht nur vom Inhalt her, sondern auch stilistisch auf die Spitze getrieben durch persiflierenden Wortwitz und eine der Zeit geschuldete, gedrechselte, aber eben auch amüsante Diktion. Der Protagonist Don Quijote gesteht denn auch gleich zu Beginn, dass er selbst, dem Publikums-Geschmack folgend, jeden Ritterroman gelesen habe, den er in die Hände bekommen konnte, sein Haus sei voll davon. Er identifiziert sich vollständig mit den hehren Zielen der Ritterorden und beschließt, selbst ein Ritter zu werden. Und das geschieht nur deshalb, weil er in seiner Einfalt den Lug und Trug der Romane nicht von der Realität unterscheiden kann, weil er naiv Wort für Wort an das glaubt, was er gelesen hat. Für Cervantes ist sein Roman auch ein Beleg dafür, dass übermäßige Lektüre von Schundromanen letztendlich nur den Verstand raubt, worauf Denis Scheck übrigens aktuell auch in seiner Bestseller-Bibel hingewiesen hat, wo eine aktuelle Studie benannt ist, die das tatsächlich belegt.
Also zieht der Held auf Rocinante, seinem Klepper, in die Welt hinaus, um Gutes zu tun und Böses zu verhindern, begleitet von seinem Schildknappen Sancho Panza, der auf einem Esel reitet. Und er will natürlich auch Dulcinea finden, seine erträumte Herzensdame. Er erlebt zahlreiche haarsträubende Abenteuer und richtet überall da, wo er auftaucht, ein schlimmes Chaos an. Seinen rohen Gegnern unterliegt er immer und siegt nur dort, wo er gegen völlig Unschuldige und Ahnungslose zu Felde zieht. Im zweiten Teil des Romans ist Don Quijote der anerkannte Schriftsteller des ersten Teils geworden, der nun mit Sancho Pansa weitere Abenteuer besteht, seine Dulcinea aber leider auch nicht findet. Ganz am Ende verliert er einen Zweikampf und kehrt in sein Dorf zurück, wo er seine Lebenslüge erkennt und desillusioniert an Wundfieber stirbt.
Die Handlung des Romans wird ergänzt durch viele in sich abgeschlossene Episoden, deren aberwitziges Geschehen für sich allein steht. Besonders amüsant sind die Passagen, in denen Cervantes gegen die Schriftsteller zu Felde zieht, indem er zum Beispiel Zweifel an seinem Buch bekundet, «… wo ich doch sehe, dass andere Bücher, einerlei wie herbeiphantasiert und profan, nur so von Sprüchen des Aristoteles strotzen, von Platon und dem ganzen Philosophentross, und damit ihre Leser staunen machen, und die halten derlei Schreiber dann für belesene, beredte und gelehrte Männer». Wie wahr! Der «Don Quijote» ist übrigens einer der seltenen Romane, die man ohne Abstriche in kleinsten Portionen über längere Zeiträume hinweg goutieren kann, denn jeder Abschnitt des Buches ist für sich allein eine literarische Preziose. Es wäre in der Gesamtausgabe in einem Band mit fast 1500 Seiten insoweit auch das viel beschworene, nie langweilig werdende, ideale «Buch für die Insel».
Fazit: erstklassig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
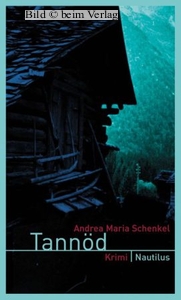 Chapeau!
Chapeau!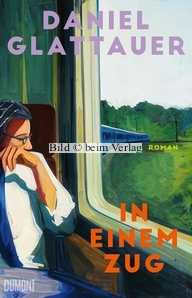 Unterhaltung ohne Tiefgang
Unterhaltung ohne Tiefgang Epochenroman des literarischen Kanons
Epochenroman des literarischen Kanons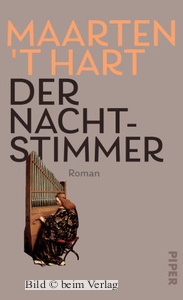 Schwachsinn im Buch der Bücher
Schwachsinn im Buch der Bücher Feministischer Schelmenroman
Feministischer Schelmenroman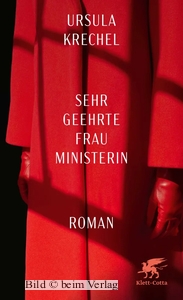 Narrativ unausgewogen
Narrativ unausgewogen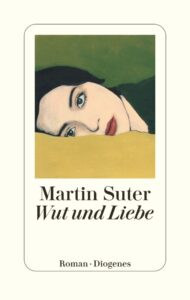
 Schicksalslosigkeit nach Auschwitz
Schicksalslosigkeit nach Auschwitz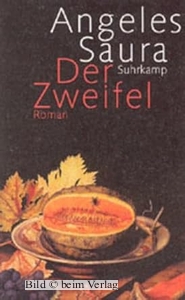 Wissenschaftlicher Super-GAU
Wissenschaftlicher Super-GAU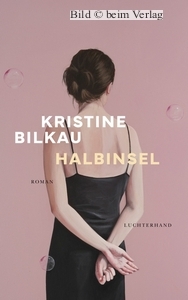 Feminine Sinnkrisen
Feminine Sinnkrisen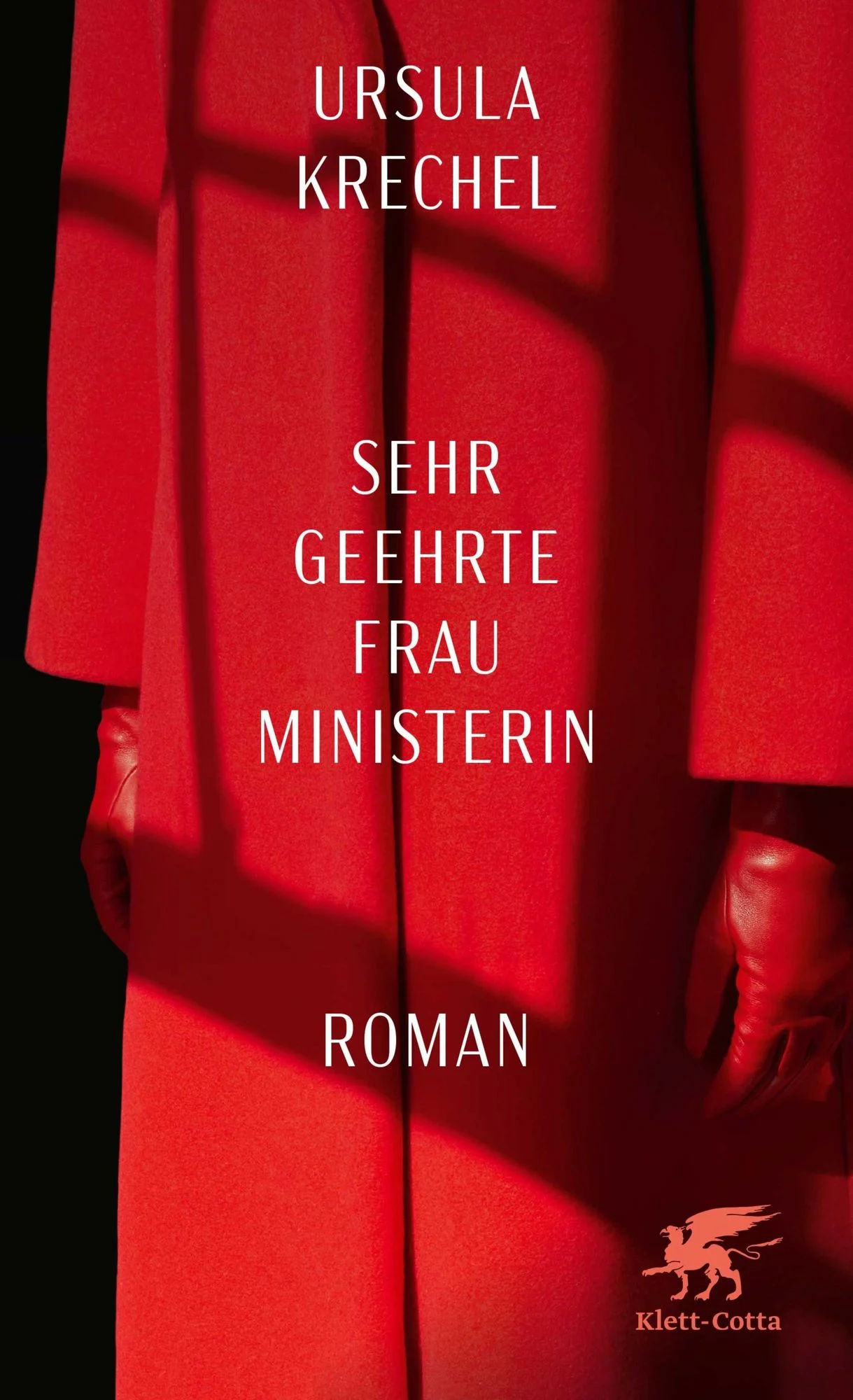
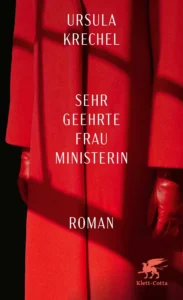 Dass ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, schien anfangs unwahrscheinlich. Erst ging es, in einem Kapitel mit dem Titel: „Eva,“ detailliert um den römischen Kaiser Nero und wie er seine Mutter Agrippina verbannen und umbringen ließ. Dabei erfuhr ich, dass Seneca sein Tutor war, den er aber auch verbannte. Aber, wollte ich das lesen?
Dass ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, schien anfangs unwahrscheinlich. Erst ging es, in einem Kapitel mit dem Titel: „Eva,“ detailliert um den römischen Kaiser Nero und wie er seine Mutter Agrippina verbannen und umbringen ließ. Dabei erfuhr ich, dass Seneca sein Tutor war, den er aber auch verbannte. Aber, wollte ich das lesen?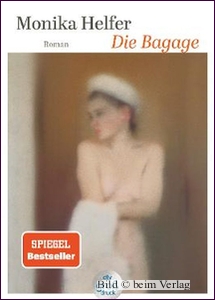 Kuckuckskind
Kuckuckskind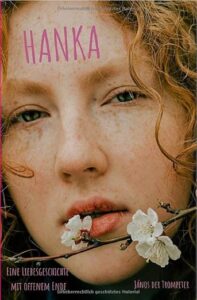
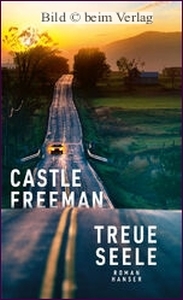 Eine Hochzeit, mit der niemand gerechnet hat
Eine Hochzeit, mit der niemand gerechnet hat