200 Jahre Karl Marx: Der am 5. Mai 1818 in Trier geborene Philosoph wird 2018 vom Reclam mit gleich mehreren Neuauflagen seiner Werke gefeiert. Darunter befindet sich nicht nur eine handliche Ausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei, sondern auch eine Sammlung seiner philosophischen und ökonomischen Schriften, eine Auswahl aus der deutschen Ideologie, sowie eine 100-Seiten Kurzbiographie (Reihe: „100 Seiten“) zu Leben und Wirken des umstrit tenen Gründers des Kommunismus.
tenen Gründers des Kommunismus.
Karl Marx: Die deutsche Ideologie
„Die deutsche Ideologie“ wurde 1845/46 veröffentlicht und bekämpfte die Weltabgewandtheit etwa der Junghegelianer ihrer Zeit, die damals vorherrschende Ideologie. Mit dieser Schrift begründeten sie auch den Begriff des historischen Materialismus, der sich gegen den Idealismus Hegels wandte und eine Veränderung der Lebensbedingungen forderte. Nicht das Bewusstsein schafft das Sein, sondern das Sein das Bewusstsein ist eine der zentralen Thesen des Materialismus. Gefordert wird der „praktischen Umsturz der realen gesellschaftlichen Verhältnisse“ aus denen diese „idealistischen Flausen“ hervorgegangen seien.

Jäger, Fischer, Kritiker
Das im Anschluss an das Erscheinen sehr einflussreiche Werk, dessen zentrale Passagen in dieser knappen Auswahl hier angeboten werden, liefert genug Munition auch für das 21. Jahrhundert für diejenigen, die sich der herrschenden Ideologie widersetzen wollen. Aus der „deutschen Ideologie“ stammt auch einer meiner Lieblingsstellen bei Marx. Im Kapitalismus sei der Mensch nur entweder oder „Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker“, „während in der kommunistischen Gesellschaft, wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je ein Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker zu werden“.
Philosoph, Ökonom, Kritiker
Die „Philosophischen und ökonomischen Schriften“ widmen

Grundlagen zu Karl Marx
sich einerseits der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, dem Manifest der Kommunistischen Partei und der Kritik der politischen Ökonomie bis hin zum zentralen Werk Marxens, dem Kapital. Die vorliegende Ausgabe des Reclam Verlages will dem Leser einen historisch-kritisch edierten Text zur Verfügung stellen, um eine neue Lektüre Marxens nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus zu ermöglichen. Johannes Rohbeck erläutert im Nachwort die Bedeutung der ausgewählten Text und beschwört einen Marx für das 21. Jahrhundert, der wieder frei von ideologischem Schrott gelesen werden kann. Er sieht die Bedeutung von Marx auch als Vorläufer der erst später entstandenen Soziologie, denn auch die Strukturalisten und Systemtheoretiker des 20. Jahrhunderts hätten bei angedockt. „Mit seinen Analysen des Weltmarktes, der internationalen Arbeitsteilung bis hin zu einer globalen Kultur ist er einer der ersten Theoretiker der Globalisierung“, so Rohbeck. Die positive Antwort nach dem Vermächtnis von Marx liege in der kritischen Analyse des vorhandenen Kapitalismus und weniger in der Utopie des Zusammenbruchs desselben. „Aus der Tatsache, dass sich die Hoffnungen auf eine sozialistische Gesellschaft nicht erfüllt haben, folgt keineswegs, dass sich die Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft erübrigt habe“, so Rohbeck.
Das Manifest aller Revolutionäre

Das Manifest aller Revolutionäre
„Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“ ist der letzte Satz des „Kommunistischen Manifests“, das noch vor vor der französischen Februar-Revolution und der deutschen März-Revolution 1848 erschien. Im „Manifest“ entwickelten Marx und Engels den sog „Marxismus“, der vorerst vor allem in der Kritik des Kapitalismus bestand und dazu ein begriffliches Instrumentarium zur Verfügung stellte. Ebenfalls in diesem Band enthalten sind die „Grundsätze des Kommunismus“ von Friedrich Engels. Der erste davon lautet: „Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats“. Und der erste des Kommunistischen Manifests lautet: „Ein Gespenst geht um in Europa.“ Jetzt wohl nicht mehr. Das Kommunistische Manifest gehört immer noch – nach Bibel und Koran – zu den vier meistverkauften Büchern der Welt: 500 Millionen sind seit 1848 verkauft worden.
Karl Marx: Leben und Werk
In „100 Seiten Karl Marx“ von Dietmar Darth erwähnt der Autor die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, die von Marx angestrebt wurde und auf den Erfahrungen der Commune de Paris basierte. Der Zusammenhang zwischen Commune und der Bezeichnung Kommunismus für die neue Gesellschaftsform, die aus der Commune von 1871 hervorgehen sollte führte Marx auch schlüssig zum Begriff der „Diktatur des Proletariats“, der vielfach missverstanden wurde. „Nun gut, ihr Herren“, soll Marxens Kampfgenosse Friedrich Engels einmal geschrieben haben, „wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.“ Die sehr persönlich gehaltene Publikation von Dietmar Darth deckt auch neues Quellenmaterial auf, etwa einen Brief von Karl Marx an den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln bezüglich des amerikanischen Bürgerkrieges. Denn Marx war nicht nur der erste Kommunist, sondern auch der Begründer der internationalen Solidarität, wie Darth an weiteren Beispielen erfolgreich demonstriert. Sein Zerwürfnis mit den Junghegelianern wird ebenso thematisiert wie die wichtigsten Begriffe aus Marxens Universums, etwa Dialektik, Materialismus oder tendenzieller Fall der Profitrate und Mehrwert. Dass bei all der Theorie von Ökonomie, Philosophie und Politik Karl Marx auch eine große Portion Humor besaß, beweist eine Anekdote, in der er mit einem Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer ausruft: „Arme Hunde! Man will euch wie Menschen behandeln!“
Marx, Karl; Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie
Eine Auswahl. [Was bedeutet das alles?]
96 S.
ISBN: 978-3-15-019510-9
Reclam Verlag
6,00 €
Marx, Karl: Philosophische und ökonomische Schriften
Hrsg.: Rohbeck, Johannes; Breitenstein, Peggy H.
390 S.
ISBN: 978-3-15-018554-4
Reclam
10,80 €
Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei
[Was bedeutet das alles?]
115 S.
ISBN: 978-3-15-019266-5
Reclam Verlag
5,00 €
Dath, Dietmar: Karl Marx. 100 Seiten
Originalausgabe
Broschiert. Format 11,4 x 17 cm
100 S. 11 Abb. und Infografiken
ISBN: 978-3-15-020454-2
Reclam Verlag
10,00 €
 Andrej Tarkovskij: Der Regisseur von Filmen Iwanowo detstwo (Iwans Kindheit), Andrej Rubljow, Soljaris (Solaris), Serkalo, Stalker, Nostalghia und Offret (Sacrificatio; Opfer) ist zwar schon seit mehr als 30 Jahren tot, sein Werk wird aber wohl die Ewigkeit überdauern. In einer neuen Publikation des Schirmer/Mosel Verlages wird nun noch einmal Rückblick und Einkehr gehalten, auf das Vermächtnis einer der bedeutendsten Regisseure unseres Jahrhunderts. Das Werk ist auf Deutsch und Englisch mit unterschiedlichen Titeln erhältlich.
Andrej Tarkovskij: Der Regisseur von Filmen Iwanowo detstwo (Iwans Kindheit), Andrej Rubljow, Soljaris (Solaris), Serkalo, Stalker, Nostalghia und Offret (Sacrificatio; Opfer) ist zwar schon seit mehr als 30 Jahren tot, sein Werk wird aber wohl die Ewigkeit überdauern. In einer neuen Publikation des Schirmer/Mosel Verlages wird nun noch einmal Rückblick und Einkehr gehalten, auf das Vermächtnis einer der bedeutendsten Regisseure unseres Jahrhunderts. Das Werk ist auf Deutsch und Englisch mit unterschiedlichen Titeln erhältlich.

 Wagenbach, prononcierter Kafka-Kenner und ehemaliger Verlagsleiter des gleichnamigen Verlages hat sich Zeit seines Lebens über „die Schulweisheit vom dunklen Kafka geärgert“ und immer wieder einen Kafka voll hintergründigem Humor, unerwarteter Wendungen, mit einer Vorliebe für das Paradoxe und mit einer Neigung zur Ironie des Absurden ausgegraben und hervorgekehrt. Dies ist auch das Anliegen dieser Auswahl an Auszügen aus seinen Romanen und Kurzgeschichten, die der Herausgeber hier zusammengestellt hat.
Wagenbach, prononcierter Kafka-Kenner und ehemaliger Verlagsleiter des gleichnamigen Verlages hat sich Zeit seines Lebens über „die Schulweisheit vom dunklen Kafka geärgert“ und immer wieder einen Kafka voll hintergründigem Humor, unerwarteter Wendungen, mit einer Vorliebe für das Paradoxe und mit einer Neigung zur Ironie des Absurden ausgegraben und hervorgekehrt. Dies ist auch das Anliegen dieser Auswahl an Auszügen aus seinen Romanen und Kurzgeschichten, die der Herausgeber hier zusammengestellt hat.








 tenen Gründers des Kommunismus.
tenen Gründers des Kommunismus.



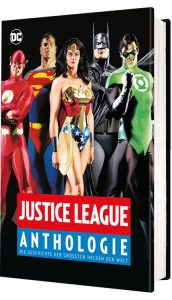





 Bücherbilder von Tomi Ungerer: Der in Straßburg geborene Illustrator ist besonders durch seine Umschlagvignetten für den Diogenes Verlag bekannt geworden. Aus Anlass der 60-jährigen Zusammenarbeit erschien die hier vorliegende Sammlung von Bücherbildern, eine Box mit 60 Postkarten, die man auch als kleine Tomi-Ungerer-Ausstellung verstehen kann.
Bücherbilder von Tomi Ungerer: Der in Straßburg geborene Illustrator ist besonders durch seine Umschlagvignetten für den Diogenes Verlag bekannt geworden. Aus Anlass der 60-jährigen Zusammenarbeit erschien die hier vorliegende Sammlung von Bücherbildern, eine Box mit 60 Postkarten, die man auch als kleine Tomi-Ungerer-Ausstellung verstehen kann.