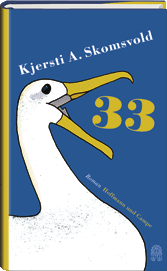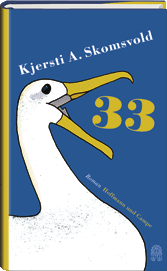 Eine Frau, zwei Männer, einer davon tot und noch kein Kind. Um dieses fragile Universum kreist die Erzählerin. Sie ist eine lungenkranke Frau, die dem Leser nur als K. vorgestellt wird. Gerade ist sie 33 geworden, das Alter, das im Himmel alle haben, so hat sie es jedenfalls gelernt.
Eine Frau, zwei Männer, einer davon tot und noch kein Kind. Um dieses fragile Universum kreist die Erzählerin. Sie ist eine lungenkranke Frau, die dem Leser nur als K. vorgestellt wird. Gerade ist sie 33 geworden, das Alter, das im Himmel alle haben, so hat sie es jedenfalls gelernt.
Die große Liebe der K., Ferdinand, hat Selbstmord begangen, was K. aber nicht daran hindert, eifrige Schwätzchen mit dem Dahingeschiedenen zu halten. Zeit hat sie genug, sie arbeitet zwar als Lehrerin, aber in ihrem Fach, der Mathematik braucht man das Rad ja nicht täglich neu zu erfinden. Und ihr aktueller Mann, der Ire Samuel, ist in einem Endlos-Cricket-Match gefangen. Sie horcht in ihren kranken Körper und malt Horrorvisionen darüber, was in und mit diesem alles passiert. Und dann der Wunsch nach einem Kind. Kann sie das überhaupt, darf sie das überhaupt, was wird das mit ihrem Körper, ihrer Seele machen? Schon die Unsicherheit, was es mit ihr macht, wenn die Nabelschnur gekappt ist! Noch größer aber ist ihre Angst davor, das (ungezeugte) Kind in ihren Eierstöcken könne unentbunden bleiben und sie damit unerlöst. Zum Üben schafft sie sich ein Haustier an und nennt es “dasKind“. Was für ein Tier “dasKind” ist, bleibt unklar, aber es scheint in eine Plastiktüte zu passen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht real, vielleicht aber doch. Genau wie der Albatros, den sie sieht und der ihr einfach kein klares Zeichen geben will.
K. ist eine ausgesprochen merkwürdige junge Frau und “33” ein ausgesprochen merkwürdiger Text. Mit Absicht steht hier der übergeordnete Begriff “Text” und nicht Roman. Denn ein Roman ist es nicht. Ein Roman ist qua Definition eine Erzählung und erzählt wird hier ausgesprochen wenig. Es ist eher eine Ansammlung von Satzfragmenten, schwankend zwischen Lyrik und abgegriffenen Weisheiten a la “Sentimentalität ist die Schwester der Brutalität.” Zu Beginn ist das Buch noch einigermaßen klar und begreifbar. Die Betonung liegt auf einigermaßen! Doch je weiter K. in ihrer Larmoyanz fortschreitet, desto mehr verliert sie ihren roten Faden, mäandert zwischen tatsächlichen Ereignissen, die sie aber sofort überhöht, Alb- und Wachträumen und vollkommen absurden Vorstellungen, wie der, dass sie Ferdinand in sich eingenäht habe und nun amputiert werden müsse. Intention war es wohl, Momente einzufangen, die alles verändern und der Frage nachzugehen, ob man es wagen kann, sich fallen zu lassen, wenn man nicht weiß, ob einen jemand fängt. Dies bezogen vor allem auf die Frage einer eventuellen Mutterschaft. Man kommt nicht umhin, zu denken, dass einem das Kind schon vor der Zeugung leid tut. Wer Mutterschaft schon vorher derart thematisiert und problematisiert, sollte es wirklich besser bleiben lassen.
Kjersti Annesdatter Skomsvold wird nach wie vor als große Nachwuchshoffnung der norwegischen Literatur gehandelt, auch wenn sie mittlerweile mehrere Werke veröffentlicht hat. Ihr Debütroman “je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich” war ein verstörendes, aber auch berührendes, versponnenes Märchen. “33” nun ist zwar auch noch versponnen, aber zumindest mich hat es nicht berührt. “33” ist vor allem verstörend. Wo ist die Leichtigkeit hin, mit der sie in ihrem ersten Roman erzählte? In diesem Buch gelang noch die Mischung aus Melancholie, Empathie und Witz. In “33” gelingt ihr diese Mischung nicht. Was dort bleibt, ist unterm Strich nichts als Larmoyanz. Natürlich – der Erzählerin ist viel zugestossen, sie hat es nicht leicht. Aber durchgehendes Selbstmitleid hilft nun mal nicht. Weder der K. noch einem ungeborenen Kind.
Stilistisch ist Kjersti A. Skomsvold durchaus begabt. Sie handhabt ihr Handwerk mittels Bildern und Allegorien gekonnt und die Fähigkeit, Schmerz und körperliche Empfindungen in Worte zu kleiden, ist nur wenigen Autoren derart gegeben. Wenn diese Fähigkeit aber nur dazu dient, Selbstmitleid auszukleiden, ist es nicht genug, um die ersehnten surrealistischen Sphären auch nur zu streifen. Da helfen auch die mehr oder weniger subtilen Hinweise auf Samuel Beckett nichts.
Der Roman ist krampfhaft um Exzentrik bemüht. Aber Exzentrik muss man sich erstmal leisten können. Souverän gehandhabtes Handwerk reicht dafür nicht. Um Exzentrik zu goutieren, müssen dem Leser schon mehr als exzessiv gelebtes Selbstmitleid und ausformulierte Mätzchen geboten werden. Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich keinen Roman lese, sondern allenfalls Zeuge exzessiver literarischer Übungen werde.